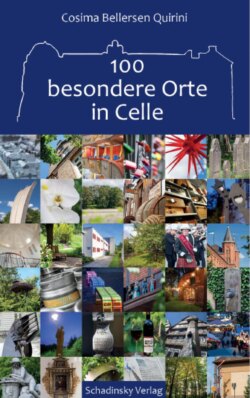Читать книгу 100 besondere Orte in Celle - Cosima Bellersen Quirini - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление19 Das Atelier des Künstlers Fritz Graßhoff
Schlager versus Halunkenpostille
Von 1946 bis 1967 lebte der Autor und Maler Fritz Graßhoff (Jahrgang 1913) in Celle in der Bahnhofstraße. In seinem bis heute bestehenden Atelier, das inmitten eines idyllischen Gartens liegt, schuf er in jenen Jahren einige seiner bekanntesten Liedertexte wie „Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise“, einst gesungen von Hans Albers – und dessen berühmtestes Lied. Er dichtete seinerzeit für viele weitere namenhafte Interpreten, sie alle verhalfen ihm dabei zu großer Bekanntheit.
Graßhoffs Ruhm gründete sich lange auf diese eingängigen Schlagertexte, die für ihn Mittel zum Zweck des Broterwerbs waren: „Davon lebe ich, damit ich schreiben und malen kann, was mir Spaß macht!“ war sein Credo. Auf die Frage, was für ihn der Unterschied zwischem einem Song und einer Ballade sei, antwortete er, es sei der gleiche Unterschied wie zwischen einer Spitzen- und einer Matrosenbluse. Das Dichten sicherte seinen Lebensunterhalt, doch damit lebte er seine Leidenschaften aus: malen, zeichnen, schreiben, übersetzen und reisen. Ob Südschweden, Griechenland oder Türkei, stets brachte er sich geistig verwertbares Material von den Reisen, die oft monatelang dauerten, mit, Bilder und Zeichnungen beispielsweise, die Texte des schwedischen Nationaldichters Carl Michael Bellman oder Passagen aus römischen und griechischen Werken, die er jeweils ins Deutsche übersetzte. Sein letztes Werk dazu war die Übersetzung des römischen Satirikers Martial.
Seine lyrischen Texte jedoch, geprägt von Kriegserlebnissen, erzielten weniger Erfolg, umso mehr neben den Schlagertexten die teils derben und frechen Balladen und Moritaten wie in der „Halunkenpostille“ niedergeschrieben und vielfach vertont wurden. Graßhoff war als Autor und Maler gleichermaßen begabt, über zwanzig Gedichtbände stammen aus seiner Feder, die erste Kunstausstellung gab er in der Kestnergesellschaft in Hannover. Es folgten andere in Köln, Duisburg und Hamburg. Auch hier fanden die Kenner zum Vergleich berühmte Namen. Als Einzelkämpfer und Nonkonformist in der Kunstwelt ziemlich verschrien, hielt er sich jedoch von allen Vereinsmeiereien fern und pflegte eine noble Distanz zum „Betrieb“. 1980 veröffentlichte er seinen autobiographischen Roman „Der blaue Heinrich“ und niemand scherte sich darum. Da kehrte er, den die Liebe einst nach Celle verschlagen hatte, siebzigjährig Deutschland den Rücken und wanderte nach Kanada aus, wo er bis zu seinem Tode im Februar 1997 wohnen blieb. Dort „von allen meinen sogenannten Heimaten, vermutlich nun mehr meiner letzten, dürfte mir diese am meisten zusagen“, widmete sich der Künstler überwiegend der Malerei. Am Ufer des Hudson Rivers fand er seinen inneren Frieden – und sein langes Schaffen schließlich auch den angemessenen Platz in Literatur und Kunst. „Wohlan, ich bin kein Zuckerbäcker, sondern ein Brotbäcker in Hemdsärmeln, der mit Humor, Satire und Gesellschaftskritik würzt“ ...