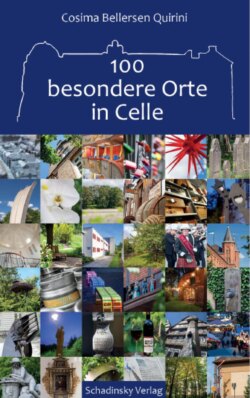Читать книгу 100 besondere Orte in Celle - Cosima Bellersen Quirini - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление11 Die Burgenanlagen in Altencelle
Frühmittelalterliche Spuren vor der heutigen Stadt
Drei Burgen lagen einst an einer Strecke von nur zweieinhalb Kilometern in der Nähe von „Kellu“, später „Tsellis“ genannt, der Vorgängersiedlung der heutigen Stadt Celle im Stadtteil Altencelle: die Brunonenburg, die Nienburg und der Ringwall in Burg. Die bislang durch mehrere Grabungen gewonnenen Erkenntnisse verweisen teils auf die Zugehörigkeit zu umgebenden Ansiedlungen und eben jenem frühmittelalterlichen Ort mit Kirche (die Gertrudenkirche steht heute noch) und möglicherweise einem Hafen. Bauliche Überreste und Fundstücke von Alltagsgegenständen (im Bomann-Museum und im Landesmuseum Hannover zu sehen) dokumentieren, dass die städtischen Überreste mitsamt den Burganlagen zu den bedeutendsten frühmittelalterlichen Kulturdenkmälern der näheren Umgebung und ganz Niedersachsen zählen. Ihr herausragendes Potential lockt immer wieder Archäologen hierher, um die exakte zeitliche Einordung sowie die tatsächliche räumliche Ausdehnung weiter zu erforschen.
Die Datierung des Burger Ringwalls wird im 10. Jahrhundert vermutet. Einst auf einer Sanddüne in den unzugänglichen Niederungsgebieten der Fuhse gelegen, diente die leicht oval geformte und etwa 70 x 85 Meter große Anlage wahrscheinlich als Fluchtburg. Ihr oblag auch die Sicherung (vor allem vor Angriffen allzu eroberungswütiger Ungarn) einer nahe gelegenen Siedlung und möglicherweise einer Furt durch die Fuhse, letzteres ist jedoch unter Fachleuten umstritten. Der ursprünglich cirka drei Meter hohe Wall bestand aus Plaggen (durchwurzelter Oberboden) und Holzversteifungen, die Bebauung aus Toranlage mit Erdbrücke und drei Häusern in Pfostenbauweise; die Bauten mit nachgewiesenen Herd- und Feuerstellen waren in mehrere Räume unterteilt. Ein sechs Meter breiter und zwei Meter tiefer Graben führte rund um den Wall und war am Grund ebenfalls mit Plaggen befestigt. Literarisch verewigt ist der Wall in Hermann Löns Roman „Der Werwolf“, die Handlung spielt im Dreißigjährigen Krieg.
Die Gründung der Brunonenburg vermuten Forscher im Jahr 986 n. Chr., historisch ist dies jedoch noch nicht hundertprozentig abgesichert. Sie geht möglicherweise zurück auf Bruno VI., Markgraf von Kaiser Otto III.. Andere Quellen weisen auf Heinrich I., der die Anlage umschließende und in Resten noch erkennbare Wall wird hierzulande auch als „Heinrichswall“ bezeichnet. Heute liegt auf dem Grundstück eine Hofanlage. Es sind Fundamentreste von mehreren Gebäuden aus drei Bauphasen von 916–936, um 1000 und um 1300 nachgewiesen: steinerner Wohnturm und Palas, mehrere Häuser mit Ofen- und Brunnenresten, Kapelle mit Friedhof und Grabresten. Brandspuren lassen die Vermutung zu, dass die Anlage durch Feuer vernichtet wurde.
Die Nienburg nahe der Aller stand wahrscheinlich auf einem eckig-ovalen Plateau von etwa 150 x 80 Metern und war natürlichen Ursprungs, möglicherweise ist es eine Sanddüne. Sie diente wohl einst als Befestigungsanlage. Manche Forscher vermuten dahinter auch ein Kastell Karls des Großen, was bislang jedoch noch unbelegt ist. Auch eine Verwendung als Verteidigungsstellung im Dreißigjährigen (1618 – 48) oder Siebenjährigen Krieg (1756 – 63) ist denkbar, 1749 wird die Anlage als „Alte Schanze“ betitelt.