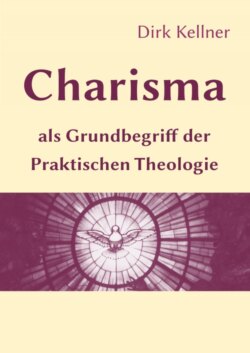Читать книгу Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie - Dirk Kellner - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.4 Peter Zimmerling: Die charismatischen Bewegungen als (praktisch-) theologische Herausforderung
ОглавлениеDie pfingstlerisch-charismatische Bewegung[318], der sich nach einem in der Kirchengeschichte einzigartigen Wachstum gegenwärtig fast ein Sechstel der gesamten Christenheit zurechnet,[319] ist von ihren Anfängen vor einem Jahrhundert bis heute durch das Auftreten spektakulärer Geistesgaben geprägt. Die Zungenrede erlangte bereits in der Erweckung innerhalb der Azusa-Street-Mission (Los Angeles) im Jahre 1905, dem «Ausgangspunkt der weltweiten traditionellen Pfingstbewegung»[320], die Bedeutung eines Beweises für die empfangene Geisttaufe. Sie gilt bis heute in den meisten Pfingstkirchen als «initial sign» der persönlichen Pfingsterfahrung.[321] Daneben erfahren andere spektakuläre Charismen wie Prophetie, Heilungen und Wundertaten eine besondere Wertschätzung und nehmen eine zentrale Rolle im Gemeindeleben ein. Besonders bei den Charismatikern der «Dritten Welle», z.B. John Wimber und C. Peter Wagner, werden die Zeichen und Wunder zur Evangelisationsmethode («power evangelism»).[322]
Die charismatische Bewegung, die sich Anfang der 60er Jahren als innerkirchliche Erneuerungsbewegung bildete, ist wie die traditionellen Pfingstkirchen und neopfingstlichen Gruppen durch die Wertschätzung und Praktizierung der neutestamentlichen Charismen gekennzeichnet. Die spektakulären Geistesgaben werden in ihr nicht abgelehnt, spielen aber eine weniger zentrale Rolle im Selbstverständnis der Bewegung. Sie werden in das charismatische Wirken des gesamten Leibes Christi in seinen unterschiedlichen Funktionen und Diensten eingeordnet. Die innerkirchlichen charismatischen Bewegungen «betonten von Anfang an nicht einzelne spektakuläre Geistesgaben, sondern die charismatische Dimension des Christseins als Ganzes und die ekklesiologische Ausrichtung der Charismen»[323]. Durch diese Zurückhaltung und Ausrichtung gewann die Bewegung Sympathien und Einfluss bei zahlreichen Vertretern der traditionellen Kirchen. So berichtet Pfr. Arnold Bittlinger, einer der Schlüsselfiguren der späteren «Geistlichen Gemeindeerneuerung» (GGE), von seiner Reise in die Vereinigte Staaten im Jahr 1962:
«Ich hatte Gelegenheit, in mehreren Gemeinden dieses neuerwachte charismatische Leben kennenzulernen und war vor allem beeindruckt von den Gebetsgottesdiensten, in denen die Geistesgaben, von denen Paulus in 1. Kor 12–14 spricht (also z.B. Prophetie, Offenbarung, Zungenrede und Interpretation), in großer Disziplin und Ordnung und in einer feierlichen liturgischen Schönheit praktiziert wurden.»[324]
Bei den innerkirchlichen charismatischen Bewegungen kam es bereits in ihren ersten Jahren zu Versuchen, die neuen Erfahrungen biblisch-theologisch zu klären und mit der jeweils eigenen theologischen Tradition in Verbindung zu setzen. Dokumente dieser Auseinandersetzung sind u.a. die Veröffentlichungen zweier ökumenischer Tagungen,[325] zu denen Vertreter aus der syrisch-orthodoxen, russisch-orthodoxen, römisch-katholischen, anglikanischen, evangelisch-lutherischen und evangelisch-reformierten Kirche ihr Verständnis der Charismen auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen theologischen Tradition vortrugen.[326] Bei allen unterschiedlichen und sich zum Teil widersprechenden Akzentsetzungen fallen die gemeinsame Betonung der Universalität der Charismen und die Relativierung der spektakulären Geistesgaben auf.[327] Inwieweit sich in neuester Zeit die innerkirchlichen charismatischen Kreise durch die starke Betonung der «Zeichen und Wunder» im Zusammenhang der sogenannten Dritte Welle beeinflussen lassen oder in Zukunft lassen werden, ist kaum pauschal zu beantworten.[328] Die letzte offizielle Veröffentlichung der GGE zu den Charismen scheint dieser von Christian Möller befürchteten Tendenz[329] zu widersprechen. Die Autoren Friedrich Aschoff und Paul Toaspern wenden sich jedenfalls explizit gegen eine Theologie, nach der «die Gaben des Geistes als ‹übernatürlich› eingegeben und ‹senkrecht von oben› empfangen» werden, ohne dass die menschlichen Bedingungen und kulturelle Prägungen berücksichtigt werden. Charismen sind vielmehr «Dienstgaben, die auch ‹auf unsere Natur aufbauen›»[330]. Obwohl sich Aschoff v.a. den «auffälligere[n] Gaben»[331] Prophetie, Sprachengebet und Heilung widmet, entfaltet und beschreibt er im einleitenden Kapitel die biblische Vielfalt der Charismen. Besondere Wertschätzung erfährt dabei die «Diakonia» als «Gabe der Dienst- und Hilfsleistung», die meistens im Verborgenen geschehe und oft mehr zum Bau des Reiches Gottes beitrage als andere Gaben.[332] Dem Charisma, Wunder zu tun, wird zwar gegenwärtige Bedeutung zugeschrieben. Es sei aber «kirchengeschichtlich eher besonderen Situationen zuzuordnen, wie beispielsweise der Mission oder in Zeiten der Verfolgung» und unterliege der Gefahr, von der Verkündigung gelöst zu werden bzw. zu einem Personenkult zu führen.[333]
Die pfingstlerisch-charismatische Bewegung und ihre «Wiederentdeckung der charismatischen Dimension von Gemeinde» können als Reaktion auf und zugleich als kritische Anfrage an Praxis und Theorie der traditionellen Kirchen gewertet werden.[334] Nach Peter Zimmerling machen sie «ein schweres Defizit der reformatorischen Kirchen» offenbar, die trotz der Theorie des allgemeinen Priestertums «keine Überwindung der Pfarrerzentriertheit des Gemeindelebens» erreichten.[335] Darüber hinaus konfrontieren sie die Praktische Theologie mit der Verlegenheit, dass die Charismenlehre bis heute kaum zum Gegenstand praktisch-theologischer Reflexion geworden ist.