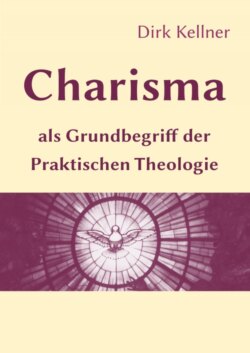Читать книгу Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie - Dirk Kellner - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.1 Hintergrund: Die ökumenische Studienarbeit zur «missionarischen Gemeinde»
ОглавлениеSeit der ersten Weltmissionskonferenz in Edinburgh (1910) wurde in unterschiedlichen Zweigen der ökumenischen Bewegung die Frage nach der missionarischen Verkündigung erörtert. Die Diskussion weitete sich in den 50er und 60er Jahren aus und befasste sich nun grundsätzlich mit der Entwicklung missionsgemäßer Strukturen in Gemeinde und Kirche. Auf der dritten Vollversammlung des ÖRK in Neu-Delhi (1961) wurde dem Referat für Fragen der Verkündigung der Auftrag gegeben, der Frage intensiv nachzugehen.[365] In drei regionalen Arbeitsgemeinschaften (in Europa, Nordamerika und der damaligen DDR) konnten erste theologische Erkenntnisse gewonnen und auf der vierten Vollversammlung des ÖRK in Uppsala (1968) vorgestellt werden. Der theologische Ertrag der Studienarbeit reicht von einer grundsätzlichen Neufassung des Wesens der Kirche und ihrer «Mission» (1.) bis hin zu konkreten Vorschlägen für eine strukturelle Kirchenreform (2.).
1. Die ökumenischen Studien lehnen das herkömmliche Verständnis von Mission im Sinne einer Verkündigung des Evangeliums, die auf Erweckung des persönlichen Glaubens und Integration in die bestehende Kirche ausgerichtet ist, als ekklesiozentrische und anthropozentrische Verengung ab.[366] Mission ist nicht Missionierung, sondern Teilhabe an der Mission Gottes (missio Dei). Theologischer Ausgangspunkt des revidierten Missionsbegriffs ist nicht mehr die Ekklesiologie, sondern die Gotteslehre. Werner Krusche brachte diesen Paradigmenwechsel auf die bekannte Formel: «Mission ist nicht eine Funktion der Kirche, sondern Kirche ist eine Funktion der Mission Gottes.»[367] Die missio Dei wird dabei verstanden als die «alles umfassende Sendungsökonomie»[368] Gottes, die in der Sendung Jesu Christi und des Geistes ihr Zentrum hat und auf die Herstellung des «Schalom», d.h. auf die ganzheitliche Versöhnung der ganzen Schöpfung, ausgerichtet ist.[369] In der fortschreitenden Transformation der Welt zum Guten hin nimmt Gott die Kirche als ein (nicht aber als das einzige) Werkzeug seiner Mission in Dienst. Die Kirche ist nicht das Ziel der Wege Gottes, sondern nur ein Instrument zur Verwirklichung des «Schalom».
«Gottes missionarisches Handeln richtet sich nicht primär auf die Kirche und durch sie auf die Welt, sondern es richtet sich primär auf die von ihm geschaffene Welt, die auch als von ihm abgefallene nicht aufgehört hat, seine Welt zu sein […]. Die Welt ist nicht für die Kirche, sondern die Kirche ist für die Welt da.»[370]
Das «Sein für andere» wird zur entscheidenden nota ecclesiae.[371] Kirche ist nicht primär die unter Wort und Sakrament versammelte Gemeinde, sondern die Kirche-in-Mission, die sich ganz aus ihrer «Pro-Existenz»[372] versteht, sich die Tagesordnung von der Welt geben lässt und solidarisch und verantwortlich in den Nöten der Welt präsent ist. Bis zur kenotischen Selbstpreisgabe ihrer eigenen Identität verwirklicht sie ihr Dasein für andere durch den solidarischen Dienst in der Welt. Kirche ist «Kirche für andere»[373].
2. In Ablehnung eines sogenannten morphologischen Fundamentalismus[374], der überkommene kirchliche Strukturen nicht in ihrer geschichtlichen Kontingenz wahrnimmt und sie nicht beständig auf ihre gegenwärtige Funktionalität überprüft, betont die ökumenische Studienarbeit: Die Struktur der Kirche muss ihrem Auftrag dienen und ist ständig an ihm zu messen. «Es gibt keine normativen, ein für allemal gültigen Strukturen; normativ für alle Strukturen ist vielmehr ihre Tauglichkeit für die missionarische Bewegung.»[375]
Die Mission ist somit das alleinige «Strukturprinzip» der Kirche.[376] Alle Lebensformen und Institutionen der Kirche sind so zu strukturieren, dass sie die Teilhabe an der missio Dei nicht hindern, sondern fördern. «Häretische Strukturen»[377], d.h. Strukturen, die die Erfüllung des Auftrages hemmen oder unmöglich machen, sind abzubauen. Dazu wird nicht nur die Parochialstruktur, die Verhaftung in Komm- statt Geh-Strukturen und die einseitig auf Sammlung und Erbauung ausgerichtete Gottesdienststruktur gezählt; auch die Betreuungsstruktur und Pfarrerzentrierung der Gemeinden wird als problematisches Hindernis verstanden.[378]
In der durch zunehmende gesellschaftliche Differenzierung und Spezialisierung gekennzeichneten Welt kann die Kirche ihren missionarischen Auftrag nur in einer ebenso spezialisierten und differenzierten Vielzahl von Diensten wahrnehmen.[379] Der Ortspfarrer kann «unmöglich den Entscheidungszusammenhang voll übersehen, der das Leben der Gesellschaft in ihren vielen spezialisierten, säkularen Berufen und Rollen ausmacht»[380]. Dem Engagement der Laien kommt daher eine grundlegende Bedeutung zu. Sie sind als «Träger der Mission»[381] mit ihrer «weltlichen Kompetenz in ihren Berufen, ihren Familien, ihrem Engagement, in Bürgerschaftsfragen und in der Politik»[382] präsent. «Es ist in der Tat der Laie, der berufen ist, der Missionar unserer Zeit zu sein.»[383]
Da jeder Christ in der Taufe die «Ordination zum apostolischen, charismatischen und opfernden Dienst der Kirche»[384] empfangen hat, ist die Rolle des ordinierten Pfarrers neu zu bestimmen. Sein Dienst ist eingeordnet in die Vielzahl der Dienste und nimmt eine Funktion in dem einen, gemeinsamen Amt der Kirche wahr. Als «Befähiger (enabler)»[385] bringt er seine theologische Kompetenz ein und dient der Ausbildung der Laien zum missionarischen Wirken. Der Begriff «Laienschulung» wird bewusst abgelehnt.[386] Der Pfarrer steht nicht als Dozierender einer Gruppe von lediglich rezeptiven Laien gegenüber. Er ist vielmehr selbst ein Empfangender und steht in einem wechselseitigen Befähigungsprozess, in dem auch die Laien die Kompetenzen einbringen, die sie in ihren differenzierten Lebensbezügen erworben haben.
«Demgegenüber ist es vielmehr Sache aller Glieder der Gemeinde, sich gegenseitig zuzurüsten, um auf diese Weise zur Erleuchtung und Bereicherung des Leibes Christi von den verschiedenen Gesichtswinkeln her beizutragen. Letztlich geht es darum, dass die ganze Gemeinde sich dem zurüstenden Handeln des Heiligen Geistes in ihrer Mitte öffnet, der sie dazu befähigt, das missionarische Volk zu sein.»[387]
Das Leitbild der ökumenischen Studien ist eine missionarische Kirche, die sich durch einen gegenseitigen Befähigungsprozess selbst erbaut. Alle ihre Glieder sind «sich ihrer Berufung als christliche Zeugen in ihren je spezifischen säkularen Rollen»[388] bewusst und setzen ihre individuellen Gaben ein, um durch verantwortliches Handeln in ihrem jeweils eigenen Umfeld ein Stück vom umfassenden Schalom Gottes zu verwirklichen. Dieses Leitbild lehnt sich an das paulinische Bild vom Leib Christi als einer charismatischen Gemeinschaft an. Allerdings bleiben die theologischen Bezüge meist nur formelhaft und lassen keine ausgearbeitete Konzeption erkennen.[389] So geht zum Beispiel im Studienbuch von Margull die «biblische Begründung» der «ökumenischen Laientheologie» nicht auf die Charismenlehre ein, sondern beschränkt sich mit einem Hinweis auf den Begriff λάος und λαϊκός.[390] Der Versuch, den «Laiendienst» pneumatologisch bzw. charismatisch zu fundieren, wird nicht unternommen.
Eine Ausnahme bildet lediglich Werner Krusche. Bereits in dem nur zwei Seiten kurzen Beitrag zu Margulls Studienbuch und später in vielen weiteren Veröffentlichungen zur missionarischen Gemeinde fordert er in Orientierung an grundlegenden neutestamentlichen Texten wie 1Kor 12–14, Röm 12 und Eph 4 ein Verständnis von Gemeinde als einer charismatischen Gemeinschaft, in der jeder Einzelne durch den Geist ein Charisma zum Dienst in Gemeinde und Welt erhält bzw. erhalten hat.[[391]