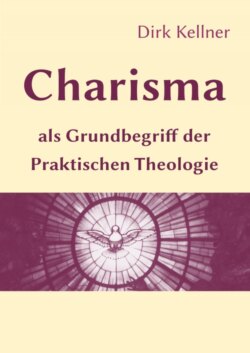Читать книгу Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie - Dirk Kellner - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1.2 Zur Auswahl der oikodomischen Entwürfe
ОглавлениеIm Folgenden wird die Rezeption nachgezeichnet, die die Charismenlehre in der oikodomischen Diskussion erfahren hat. Die kaum zu übersehende Fülle von Veröffentlichungen macht ein exemplarisches Vorgehen notwendig. Dabei werden ein bzw. zwei Konzepte jeweils eines Gemeindeaufbau-Ansatzes ausgewählt, in denen die Rezeption der Charismenlehre in besonderer Weise greifbar wird. Die Differenzierung der oikodomischen Ansätze orientiert sich an der idealtypischen Unterscheidung zwischen «volkskirchlichem» und «missionarischem» Gemeindeaufbau. Sie kann mit Christian Möller für die «einfachste und einleuchtendste»[357] gehalten werden, ist allerdings zu präzisieren und weiter zu entwickeln. Aufgrund der unterschiedlichen Missionsverständnisse ist mit Michael Herbst zwischen dem missionarisch-ökumenischen und dem missionarisch-evangelistischen Ansatz zu differenzieren.[358] Des Weiteren ist nicht von einem «volkskirchlichen», sondern präziser von einem «volkskirchlich-konziliaren» Gemeindeaufbau zu sprechen. Denn auch die missionarischen Konzeptionen bekennen sich in der Regel zu einem «Ja zur Volkskirche»[359] und wollen nicht Gemeinde abseits von ihr bauen. Das Charakteristikum dieses Ansatzes liegt vielmehr in der prinzipiellen Bejahung des innerkirchlichen Pluralismus, der durch den Grundsatz der Konziliarität zusammengehalten wird. Somit ergibt sich eine Dreier-Typologie:
1. Der missionarisch-ökumenische Ansatz versteht Kirche aus ihrer Proexistenz für die Welt und verpflichtet sie auf die Herstellung des weltumfassenden Schalom. Werner Krusche nimmt dieses Anliegen auf, plädiert aber für eine Orientierung an der paulinischen Charismenlehre. Sie verhilft ihm zu einer kritischen Korrektur der einseitigen aktionistischen Ausrichtung.
2. Der volkskirchlich-konziliare Ansatz ist durch die prinzipielle Offenheit für möglichst viele Frömmigkeitsformen und Beteiligungsintensitäten der Gemeindeglieder gekennzeichnet. Durch das Prinzip der Konziliarität soll die polyzentrische Gemeinde in einen umfassenden Kommunikationsprozess zusammengehalten werden. Christof Bäumler ist einer der (wenigen) Vertreter, die sich in der theologischen Begründung dieses Anliegens auf die paulinische Charismenlehre beziehen. Daneben ist Ralph Kunz zu nennen, der neben der Konziliarität die Koinonia zum zweiten Grundprinzip erhebt und in Aufnahme des Weber’schen Charismabegriffs sein Verständnis des Gemeindeaufbaus als einer charismatischen Revitalisierungsbewegung entwickelt.
3. Der missionarisch-evangelistische Ansatz ist im Gegensatz zum volkskirchlich-konziliaren nicht von einer polyzentrischen Denkstruktur geprägt, sondern von einer konzentrischen.[360] Im Zentrum des Gemeindeaufbaus steht ein entschiedener und engagierter Mitarbeiterkreis. In ihm leistet jede und jeder seinen Beitrag, damit Zweifelnde in ihrem Glauben vergewissert, Fernstehende zum Glauben eingeladen und distanzierte Kirchenmitglieder zur aktiven Teilnahme am Gemeindeleben ermutigt werden. Die verschiedenen Entwürfe des missionarisch-evangelistischen Gemeindeaufbaus sind im Unterschied zu den Entwürfen des missionarisch-ökumenischen oder volkskirchlich-konziliaren Ansatzes von Anfang an durch einen Rückbezug auf die Charismenlehre gekennzeichnet. Besondere Beachtung findet sie vor allem in den Veröffentlichungen von Fritz und Christian A. Schwarz. Für beide ist Gemeindeaufbau «letztlich nichts als Charismatik»[361].
Neben diesen drei Ansätzen ist auf Christian Möller einzugehen, der den Gegensatz von volkskirchlichem und missionarischem Gemeindeaufbau als «falsche Alternative» überwinden will. Sein Ansatz könnte als «gottesdienstlich-integrativ» bezeichnet werden,[362] denn er geht vom Gottesdienst als Ursprung, Mitte und Ziel des Gemeindeaufbaus aus. In seiner Argumentation nimmt er immer wieder Bezug auf die paulinische Charismenlehre.