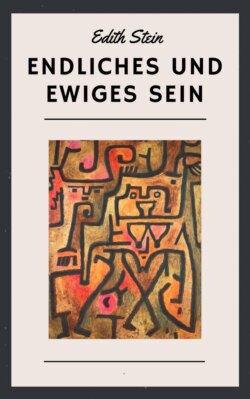Читать книгу Edith Stein: Endliches und ewiges Sein - Edith Stein - Страница 10
§ 2. Die Tatsache des eigenen Seins als Ausgangspunkt der sachlichen Untersuchung
ОглавлениеWem mittelalterliches Denken fremd ist, dem mögen die Gegenstände, die der hl. Thomas zur Untersuchung des Seins heranzieht, unerreichbar fern erscheinen: Gott und die Engel – was wissen wir von ihnen und woher? »… Cherubim und Seraphim: … wie Abwesende glauben wir sie, gemäß dem Wort, das uns von gewissen himmlischen Gewalten kündet.« Aber es gibt etwas, das uns ganz anders nahe ist, ja unentrinnbar nahe. So oft der Menschengeist bei seinem Forschen nach der Wahrheit nach einem unbezweifelbar gewissen Ausgangspunkt gesucht hat, ist er auf dieses unentrinnbar Nahe gestoßen: die Tatsache des eigenen Seins. »… wieviel von allem, was wir wissen, bleibt, das wir so wissen, wie wir wissen, daß wir leben? In diesem Wissen fürchten wir gar nicht, durch irgendeinen Wahrheitsanschein getäuscht zu werden, da doch gewiß ist, daß auch, wer sich täuscht, lebt.« Wir sind hier aller Sinnestäuschungen enthoben. »… denn hier sieht man ja nicht mit den Augen des Fleisches. Innerlichstes Wissen ist es, darin wir um unser Leben wissen, und da kann auch kein Zweifler sagen: vielleicht schläfst du und weißt es nicht … Wer gewiß ist im Wissen um sein Leben, sagt hierin nicht: ich weiß, daß ich wache, sondern: ich weiß, daß ich lebe – ob er schläft oder wacht: er lebt.«
Als Descartes in seinen »Meditationes de prima philosophia« es unternahm, die Philosophie als eine zuverlässige Wissenschaft auf einem unbezweifelbar gewissen Grunde neu aufzubauen, da begann er mit dem bekannten allgemeinen Zweifelsversuch. Er schaltete alles aus, was sich – als der Täuschung unterworfen – bezweifeln läßt. Es blieb ihm als unstreichbarer Rest die Tatsache des Zweifelns und – allgemein gefaßt – des Denkens selbst, und in dem Denken das Sein: cogito, sum. In verwandter Weise hat Edmund Husserl bei seinen Bemühungen um die Begründung der phänomenologischen Methode Urteilsenthaltung (ἐποχή) gegenüber all dem verlangt, was wir in »natürlicher Einstellung«, als in der Welt unserer Erfahrung lebende Menschen, unbefangen gläubig einfach hinnehmen, gegenüber der gesamten Existenz der natürlichen Welt und der Geltung der bestehenden Wissenschaft. Was als Feld der Untersuchung übrig bleibt, ist das Feld des Bewußtseins im Sinne des Ichlebens: ich kann es dahingestellt sein lassen, ob das Ding, das ich mit meinen Sinnen wahrnehme, wirklich existiert oder nicht – aber die Wahrnehmung als solche läßt sich nicht durchstreichen; ich kann bezweifeln, ob die Schlußfolgerung, die ich ziehe, richtig ist – aber das schlußfolgernde Denken ist eine unbezweifelbare Tatsache; und so all mein Wünschen und Wollen, mein Träumen und Hoffen, mein Freuen und Trauern – kurz alles, worin ich lebe und bin, was sich als das Sein des sein{{er}} selbst bewußten Ich selbst gibt. Denn überall – in dem »Leben« Augustins, in dem »ich denke« Descartes', im »Bewußt-sein« oder »Erleben« Husserls –, überall steckt ja ein »ich bin«. Es wird nicht daraus erschlossen, wie es die Formel »cogito, ergo sum« anzudeuten scheint, sondern es liegt unmittelbar darin: denkend, fühlend, wollend oder wie immer geistig mich regend, bin ich und bin dieses Seins inne. Diese Gewißheit des eigenen Seins ist – in einem gewissen Sinne – die ursprünglichste Erkenntnis: nicht die zeitlich erste, denn die »natürliche Einstellung« des Menschen ist vor allem anderen der äußeren Welt zugewandt, und es braucht lange, bis er sich einmal selbst findet; auch nicht im Sinne eines Grundsatzes, aus dem sich alle anderen Wahrheiten logisch ableiten ließen oder auf dem, wie an einem Maßstab, alle anderen zu messen wären; sondern im Sinne des mir Nächsten, von mir Unabtrennbaren und damit eines Ausgangspunktes, hinter den nicht weiter zurückgegangen werden kann. Diese Seinsgewißheit ist eine »unreflektierte« Gewißheit, d. h. sie liegt vor allem »rückgewandten« Denken, mit dem der Geist aus der ursprünglichen Haltung seines den Gegenständen zugewandten Lebens heraustritt, um auf sich selbst hinzublicken. Versenkt sich aber der Geist in solcher Rückwendung in die einfache Tatsache seines Seins, so wird sie ihm zu einer dreifachen Frage: Was ist das Sein, dessen ich inne bin? Was ist das Ich, das seines Seins inne ist? Was ist die geistige Regung, in der ich bin und mir meiner und ihrer bewußt bin? Wende ich mich dem Sein zu, so zeigt es, wie es in sich ist, ein Doppelgesicht: das des Seins und des Nichtseins. Das »Ich bin« hält dem Blick nicht stand. Das »worin ich bin« ist jeweils ein anderes, und da das Sein und die geistige Regung nicht getrennt sind, da ich »darin« bin, ist auch das Sein ein jeweils anderes; das Sein von »vorhin« ist vergangen und hat dem Sein von »jetzt« Platz gemacht. Das Sein, dessen ich als meines Seins inne bin, ist von Zeitlichkeit nicht zu trennen. Es ist, als »aktuelles« Sein – d. h. als gegenwärtig-wirkliches – punktuell: ein »Jetzt« zwischen einem »Nicht mehr« und einem »Noch nicht«. Aber indem es sich in seinem fließenden Charakter in Sein und Nichtsein spaltet, enthüllt sich uns die Idee des reinen Seins, das nichts von Nichtsein in sich hat, bei dem es kein »Nicht mehr« und kein »Noch nicht« gibt, das nicht zeitlich ist, sondern ewig.
So sind ewiges und zeitliches Sein, unwandelbares und wandelbares, und ebenso Nichtsein Ideen, auf die der Geist in sich selbst stößt, sie sind nicht von andersher entlehnt. Eine Philosophie aus natürlicher Erkenntnis hat hier einen rechtmäßigen Ausgangspunkt. Auch die analogia entis, als Verhältnis des zeitlichen zum ewigen Sein verstanden, wird an diesem Ausgangspunkt bereits sichtbar. Das »aktuelle Sein« ist in dem Augenblick, in dem es ist, etwas von der Art des Seins schlechthin, des vollen, das keinen Wandel der Zeit kennt. Aber weil es nur für einen Augenblick ist, ist es auch im Augenblick nicht volles Sein, seine Hinfälligkeit steckt schon in dem augenblicklichen Sein, dieses selbst ist nur ein »Analogon« des ewigen Seins, das unwandelbar und darum in jedem Augenblick volles Sein ist: d. h. ein »Abbild«, das Ähnlichkeit mit dem Urbild hat, aber weit mehr Unähnlichkeit.