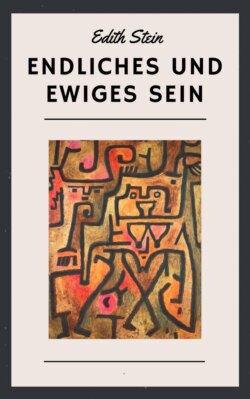Читать книгу Edith Stein: Endliches und ewiges Sein - Edith Stein - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 12. Wesenhaftes und ewiges Sein
ОглавлениеBlicken wir zurück auf den Weg, den wir gegangen sind. Wir gingen von der unstreichbaren Tatsache unseres eigenen Seins aus. Es erwies sich als ein flüchtiges, von Augenblick zu Augenblick gefristetes und darum undenkbar ohne ein anderes, in sich gegründetes, schöpferisches, das Herr alles Seins, das Sein selbst ist. Wir stießen außerdem auf etwas anderes, was in unserm fließenden und flüchtigen Sein erwächst, was wir, nachdem es erwachsen ist, als Ganzes, als ein umgrenztes Gebilde umfassen und festhalten können. Obgleich im Fluß der Zeit erwachsen, erscheint es nun diesem Fluß enthoben, als zeitlos. Der zeitliche Fluß, das Erleben, in dem die Einheit in mir und für mich erwächst, steht unter Gesetzen, die seinen Verlauf bestimmen und nicht selbst wiederum ein Fließendes und Flüchtiges, sondern ein Festes und Ruhendes sind. Es ist eine Mannigfaltigkeit inhaltlich unterschiedener und gegeneinander abgegrenzter Sinneinheiten. Die »wirkliche Welt« mit ihrer Mannigfaltigkeit werdender und vergehender Gebilde, die Welt des fließenden, stets zugleich wirklichen und möglichen Seins, ist in diesem »Reich des Sinnes« begründet, hat darin den Grund ihrer Möglichkeit. Die Sinneinheiten sind endlich, sofern sie »etwas und nicht alles« sind. Aber es besteht für sie keine Möglichkeit des Anfangens und Endens in der Zeit. Stehen wir damit vor etwas, was nicht zeitlich, aber auch nicht ewig im Sinne des allumfassenden Seins ist? War es ein voreiliges »Entweder-Oder«, das Hedwig Conrad-Martius als Hauptergebnis ihrer Untersuchungen über die Zeit ausgesprochen hat: »Entweder ein Seiendes existiert in wesenhafter Kommensurabilität mit dem Nichts – dann ist es eo ipso eine ewige Allperson! Oder es existiert in faktischer Gegensetzung gegen das Nichts; dann ist es – ontisch isoliert genommen! – eo ipso der konstitutiven Spannung zwischen Sein und Nichtsein und damit der nur punktuellen Berührungsexistenz ausgeliefert, ein Endliches im spezifischen Sinn?« Die »Kommensurabilität mit dem Nichts« bedeutet, daß jeder »mögliche Abgrund des Nichts« durch das ewige Sein »eo ipso … eingenommen« ist. »Das bedeutet aber die unmittelbare Seinssouveränität über jedes mögliche Nichtsein. Das Schaffen ist der selbstverständliche Ausdruck dieser Souveränität in seiner faktischen Wirksamkeit.« Das »flüchtige« Sein ist nicht im Besitze des Seienden, das flüchtig ist: es muß ihm immer neu geschenkt werden. Schenken kann aber nur, wer das Sein wahrhaft besitzt, wer darüber Herr ist. Herr sein kann nur eine Person. Herr des Seins aber wäre sie nicht, wenn sich etwas ihrer Seinsmacht entzöge: wenn es unabhängig von ihr Sein oder Nichtsein gäbe. So kann auch das Sein der Sinneinheiten nicht unabhängig von Gott sein. Verfällt es damit dem Fluß der Zeit? Das ist gleichfalls nicht möglich. Der »Sinn« erwies sich ja als das diesen Fluß beherrschende, in sich ruhende Gesetz. Aber ruhen die Sinneinheiten wirklich »in sich?« Ist das Sein, das wir ihnen zuschreiben, ihr Sein? Wenn eine Erlebniseinheit in mir wirklich wird, so bin ich das, was mit dem Sein beschenkt wird, und durch das mir geschenkte Sein wird sie wirklich. Es ist aber nicht der sie gestaltende Sinn, der mir das Sein schenkt, sondern mit dem Sein wird mir dieser Sinn geschenkt und werde ich durch ihn gestaltet. Das, was mir das Sein gibt und ineins damit dies Sein mit Sinn erfüllt, muß nicht nur Herr des Seins, sondern auch des Sinnes sein: im ewigen Sein ist alle Sinnfülle enthalten, nirgends anders her als aus sich selbst kann es den Sinn »schöpfen«, mit dem jedes Geschöpf erfüllt wird, indem es ins Dasein gerufen wird. So ist das Sein der Wesenheiten und Washeiten nicht als ein selbständiges neben dem ewigen zu denken. Es ist das ewige Sein selbst, das in sich selbst die ewigen Formen gestaltet – nicht in einem zeitlichen Geschehen –, nach denen es in der Zeit und mit der Zeit die Welt schafft. Das klingt rätselhaft und doch altvertraut:
»Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ΛόγοϚ« – so antwortet die Ewige Weisheit auf die Rätselfrage des Philosophen. Die Theologen übersetzen: »Im Anfang war das Wort« (Joh 1, 1), und verstehen darunter das Ewige Wort, die zweite Person in der Dreifaltigen Gottheit. Wir tun aber den Worten des hl. Johannes keine Gewalt an, wenn wir, im Zusammenhang der Überlegungen, die uns hierher geführt haben, mit Faust zu sagen versuchen: »Im Anfang war der Sinn«. Man pflegt ja das Ewige Wort dem »inneren Wort« der menschlichen Rede zu vergleichen und erst das menschgewordene Wort dem »äußeren«, gesprochenen Wort. Wir fügen noch hinzu, was die Ewige Weisheit durch den Mund des Apostels Paulus spricht: »… αὐτόϚ ἐστιν πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν – Er ist vor allen Dingen, und alle Dinge haben in Ihm ihren festen Bestand und Zusammenhang.«
Offenbar tragen diese beiden Schriftworte uns weit über das hinaus, was uns der forschende Verstand erschlossen hat. Aber vielleicht kann uns der philosophische Sinn des Logos, zu dem wir vorgedrungen sind, den theologischen Sinn des Logos verstehen helfen, und andrerseits die offenbarte Wahrheit in den philosophischen Schwierigkeiten weiterhelfen. Wir versuchen zunächst, uns den Sinn der beiden Schriftstellen klar zu machen. Mit Sinn bezeichnet das Johannesevangelium eine göttliche Person, also nicht etwas Unwirkliches, sondern das Wirklichste, was es gibt. Er fügt auch sogleich hinzu: »πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο – Durch Ihn sind alle Dinge geworden.« Und daran schließt sich sinngemäß die angeführte Paulusstelle, die den Dingen »im Logos« »Bestand und Zusammenhang« zuschreibt. So haben wir unter dem göttlichen ΛόγοϚ ein wirkliches Wesen zu verstehen: nach der Trinitätslehre das göttliche Wesen. Daß es Sinn genannt wird, versteht sich daraus, daß es das göttliche Wesen als verstandenes ist, als Gehalt der göttlichen Erkenntnis, als ihr »geistiger Sinn«. Es kann auch Wort genannt werden, weil es der Inhalt dessen ist, was Gott spricht, der Gehalt der Offenbarung, also sprachlicher Sinn; noch ursprünglicher: weil der Vater sich darin ausspricht und es durch sein Sprechen hervorbringt. Dieser Sinn aber ist wirklich, und es ist nicht möglich, sein wesenhaftes von seinem wirklichen Sein zu trennen, weil das ewige Sein wesenhaft wirklich ist und als das erste Sein Urheber alles Seins. Daß sein wesenhaftes Sein nicht angefangen haben kann, das liegt schon im wesenhaften Sein und im Sinn als solchen. Es ist aber auch vom göttlichen Geist her zu verstehen. Das wirkliche (= aktuelle) Sein des Geistes ist Leben und ist lebendiges Verstehen. Gott als »reiner Akt« ist wandellose Lebendigkeit. Geistiges Leben, Verstehen ist aber nicht möglich ohne einen Gehalt, ohne »geistigen Sinn«. Und dieser Sinn muß gleich ewig und gleich wandellos sein wie der göttliche Geist selbst. Ist es überhaupt möglich, auch nur gedanklich das wesenhafte Sein des ΛόγοϚ von seinem wirklichen Sein zu trennen, wie es bei dem endlichen Wesen möglich ist? Die Dreifaltigkeit als solche scheint eine derartige Trennung zu bedeuten. Der Sohn wird als gleich-ewig (coaeternus) mit dem Vater bezeichnet, aber als »vom Vater erzeugt«, und das besagt, daß er sein ewiges Sein vom Vater empfängt. Das göttliche Wesen ist eines, kann also nicht als erzeugt bezeichnet werden. Was erzeugt wird, ist die zweite Person, und das Sein, das sie damit empfängt, kann nicht das wesenhafte Sein des göttlichen Wesens sein, sondern nur sein Wirklichsein in einer zweiten Person. Weil die Person des Sohnes und ihr Wirklichsein etwas »Neues« ist gegenüber der Person des Vaters, darum kann man von ihr auch sagen, daß sie das Wesen empfängt. Aber das Wesen empfängt nicht sein wesenhaftes Sein. Selbst das ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ΛόγοϚ läßt eine solche Deutung zu, wenn wir an die Bedeutung denken, die ἀρχή in der griechischen Philosophie hat. Es ist ja nicht »Anfang« als »Beginn der Zeit«, sondern das »erste Seiende«, das Ur-Seiende. So bekommt der geheimnisvolle Satz den Sinn: Im ersten Seienden war der Logos (der »Sinn« oder »das göttliche Wesen«) – im Vater der Sohn –, der Sinn vom Ur-Wirklichen umschlossen. Die »Zeugung« bedeutet die Setzung des Wesens in die neue Person-Wirklichkeit des Sohnes, die allerdings keine Hinaus-Setzung aus der Ur-Wirklichkeit des Vaters ist.
Die bildlichen Redewendungen, die zur Herausstellung des Verhältnisses zwischen den göttlichen Personen gebraucht werden, klingen fast so, als sollte man nicht nur eine gedankliche, sondern sogar eine wirkliche Trennbarkeit von wesenhaftem und wirklichem Sein annehmen. (Tatsächlich kann das nicht in Frage kommen, weil es sich ja bei beiden um ewiges Sein handelt.) Andererseits scheint die Auflassung des ersten Seienden als des Seienden, dessen Wesen das Sein ist, nicht einmal eine gedankliche Trennung zuzulassen. Die Untrennbarkeit des Wesens vom wirklichen Sein war es, durch die der hl. Thomas das erste Seiende von jedem anderen schied. Alles Endliche empfängt sein Sein (wir müssen nach unserer Auffassung sagen sein wirkliches Sein) als etwas zu seinem Wesen Hinzukommendes. Damit ist eine wirkliche Trennbarkeit von Wesen und wirklichem Sein ausgesprochen. Das wesenhafte Sein schien uns vom Wesenswas nicht wirklich, aber wohl gedanklich trennbar. Wenn aber das erste Seiende das Sein zum Wesen hat, dann ist es unmöglich, es auch nur ohne das Sein zu denken. Es bliebe nichts übrig, wenn man das Sein wegdächte – kein Was, als das man das Nicht-Seiende denken könnte. Was, Wesen und Sein sind hier nicht zu unterscheiden. Wenn man diesen Gedanken in aller Klarheit zu fassen vermöchte, so hätten wir darin die Grundlage für einen »ontologischen Gottesbeweis«, die noch tiefer läge und noch einleuchtender wäre als der Gedanke des ens »quo nihil majus cogitari possit«, des denkbar vollkommensten Wesens, von dem der hl. Anselmus ausgeht. Man könnte es freilich nicht eigentlich einen »Beweis« nennen. Wenn man sagt: Gottes Sein ist sein Wesen; Gott ist nicht ohne das Sein denkbar; Gott ist notwendig, so liegt nicht eine eigentliche Folgerung, sondern nur eine Umformung des ursprünglichen Gedankens vor. Die Richtigkeit dieser Umformung wird auch von dem hl. Thomas, der den ontologischen Beweis Anselmus' bekanntlich abgelehnt hat, nicht bestritten. Er gibt zu, daß der Satz »Es gibt einen Gott« an sich unmittelbar einleuchtend sei, weil Gott sein Sein ist. »Weil wir aber nicht wissen, was Gott ist, so ist der Satz vom Dasein Gottes für uns nicht unmittelbar einleuchtend (oder selbst-verständlich), muß vielmehr bewiesen werden aus den Wirkungen Gottes, die zwar der Ordnung der Natur nach später als die Ursache, also weniger selbst-verständlich, unserm Erkennen aber früher gegeben als die Ursache, also leichter zugänglich sind.« Ohne Zweifel ist es uns nicht selbstverständlich, Gott als »den Seienden« oder gar als »den, dessen Wesen das Sein ist«, zu denken. Es ist der Weg der Gottesbeweise von den Wirkungen her, auf dem Thomas zu diesem Gedanken emporführt. Wenn man diesen Gedanken gefaßt hat, so ergibt sich die Notwendigkeit des göttlichen Seins unausweichlich. Aber können wir diesen Gedanken wirklich fassen? »Si comprehendis, non est Deus«, sagt Augustinus. (Wenn du begreifst, so ist es nicht Gott.) Und »… mit welcher Kraft der Einsicht faßt der Mensch Gott, da er diese Kraft der Einsicht selber, mit der er Ihn fassen will, noch nicht faßt?« Wenn wir sagen: Gottes Sein ist sein Wesen, so können wir damit wohl einen gewissen Sinn verbinden. Aber wir gelangen zu keiner »erfüllenden Anschauung« dessen, was wir meinen. Ein Wesen, das nichts anderes ist als Sein, können wir nicht fassen. Wir rühren gerade noch daran, weil unser Geist über alles Endliche hinauszielt – und durch das Endliche selbst dahin geführt wird, darüber hinauszuzielen – auf etwas, was alles Endliche in sich begreift, ohne sich darin zu erschöpfen. Kein Endliches vermag ihn zu erfüllen, auch alles Endliche zusammengenommen nicht. Aber das, was ihn zu erfüllen vermöchte, vermag er selbst nicht zu fassen. Es entzieht sich seiner Anschauung. Der Glaube verheißt uns, daß wir es im Glorienlichte schauen werden. So oft wir uns hier seiner zu bemächtigen suchen, bekommen wir immer nur ein endliches Gleichnis zu fassen – ein Endliches, in dem Was, Wesen und wirkliches Sein auseinanderfallen.
In dieser dem Menschengeist eigenen Paradoxie, seinem Ausgespanntsein zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, scheint mir das eigentümliche Schicksal des ontologischen Gottesbeweises begründet: daß sich immer wieder neue Verteidiger und immer wieder neue Gegner für ihn finden. Wer bis zu dem Gedanken des göttlichen Seins – des Ersten, Ewigen, Unendlichen, des »reinen Aktes« – vorgedrungen ist, der kann sich der Seinsnotwendigkeit, die darin eingeschlossen ist, nicht entziehen. Sucht er es aber zu fassen, wie man erkenntnismäßig etwas zu fassen pflegt, so weicht es vor ihm zurück und erscheint nicht mehr als ausreichende Grundlage, um darauf das Gebäude eines Beweises zu errichten. Dem Gläubigen, der im Glauben seines Gottes gewiß ist, erscheint es so unmöglich, Gott als nichtseiend zu denken, daß er es zuversichtlich unternimmt, selbst den »insipiens« vom Dasein Gottes zu überzeugen. Der Denker, der den Maßstab der natürlichen Erkenntnis anlegt, schrickt immer wieder vor dem Sprung über den Abgrund zurück. Aber ergeht es den Gottesbeweisen a posteriori, den Schlüssen von den geschaffenen Wirkungen auf eine ungeschaffene Ursache, viel besser? Wieviel Ungläubige sind denn schon durch die thomistischen Gottesbeweise gläubig geworden? Auch sie sind ein Sprung über den Abgrund: der Gläubige schwingt sich leicht hinüber, der Ungläubige macht davor halt.
Um wieder auf unsere Fragen zurückzukommen: Zweifellos ist in der Gleichsetzung des göttlichen Seins und des göttlichen Wesens die gedankliche Untrennbarkeit beider und damit zugleich die Untrennbarkeit von wesenhaftem und wirklichem Sein in Gott ausgesprochen: Gottes wesenhaftes Sein ist das wirkliche, ja das allerwirklichste Sein: der reine Akt. Aber weil Gott für uns weder als Sein noch als Wesen faßbar ist, weil wir uns Ihm immer nur mit Hilfe endlicher »Abbilder« nähern, in denen Sein und Wesen getrennt ist, so geschieht diese Annäherung bald von der Seite des Wesens, bald von der Seite des Seins her, und darum sprechen wir wie von etwas Getrenntem von dem, was an sich nicht trennbar ist.
Wie ist aber diese Untrennbarkeit vereinbar mit der Trennbarkeit, die uns durch die Trinitätstheologie nahegelegt schien? Kann ich die Personen und ihr unterschiedenes Personsein vom göttlichen Wesen trennen, wenn Wesen und Sein untrennbar ist? Ich sehe keine andere Lösung, als daß das Sein in drei Personen selbst als wesenhaft zu betrachten ist. Damit wird freilich auch die Trennbarkeit von Wesen und Sein, wesenhaftem und wirklichem Sein beim Logos zu einer bloßen Gleichnisrede. Aber wie könnten wir anders als in Gleichnissen von dem größten aller Glaubensgeheimnisse sprechen?
Diese Gleichnisreden führen uns nun auch zum Verhältnis des göttlichen Logos zum »Sinn« der endlichen Wesen. Wir fanden den Namen »Logos« für die zweite göttliche Person darin begründet, daß er das göttliche Wesen als erkanntes, als das vom göttlichen Geist umfaßte, zum Ausdruck bringt. Das sind Gleichnisreden, die vom menschlichen Erkennen und Benennen endlicher Dinge hergenommen sind. Wir weisen dem Logos in der Gottheit die Stelle zu, die dem »Sinn« als dem sachlichen Gehalt der Dinge und zugleich als dem Gehalt unserer Erkenntnis und Sprache im Bereich des uns Faßbaren entspricht. Das ist die analogia, die Übereinstimmung-Nichtübereinstimmung, zwischen ΛόγοϚ und λόγοϚ, Ewigem Wort und Menschenwort. Es wird aber in den Schriftstellen, die wir heranzogen, nicht nur eine Gleichnisbeziehung behauptet, die es uns ermöglicht, »das unsichtbare Wesen Gottes … durch das, was geschaffen ist, verstehend zu erschauen, sondern es wird ausgesprochen, daß das Geschaffene durch den Logos geschaffen sei und in Ihm Zusammenhang und Bestand habe. Was gemeint ist, wird auch noch erläutert durch die Lesart von Joh. 1, 3–4, die im Mittelalter üblich war. Wir lesen heute: »… sine ipso factum est nihil, quod factum est.« – »… ohne Ihn (den Logos) ist nichts gemacht worden, was gemacht ist.« Damals verband man: »Quod factum est, in ipso vita erat.« – »Was gemacht worden ist, war in Ihm Leben.« Damit scheint ausgesprochen, daß die geschaffenen Dinge im göttlichen Logos ihr Sein – und zwar ihr wirkliches Sein – haben. In der so gedeuteten Schriftstelle ist offenbar die »augustinische« Auffassung der Ideen als »schöpferischer Wesenheiten im göttlichen Geist« vorgebildet.
Wie wir das Sein der Dinge im Logos nicht zu verstehen haben, das ist in einer kirchlichen Lehrentscheidung ausgesprochen: Die geschaffenen Dinge sind nicht in Gott wie die Teile im Ganzen, und das wirkliche Sein der Dinge ist nicht das göttliche Sein, sondern ihr eigenes, vom göttlichen unterschiedenes. Was kann dann ihr »Bestand und Zusammenhang« im Logos bedeuten? Versuchen wir zunächst das con-stare, das Zusammen der Dinge im Logos zu verstehen. Es besagt offenbar die Einheit alles Seienden. Unsere Erfahrung zeigt uns die Dinge als in sich geschlossene und voneinander getrennte Einheiten, allerdings in wechselseitigen Abhängigkeitsbeziehungen, die uns zu dem Gedanken eines allgemeinen ursächlichen Zusammenhanges aller wirklichen Dinge hinführen. Aber der ursächliche Zusammenhang erscheint wie etwas Äußeres. Wenn wir den Aufbau der dinglichen Welt zu erforschen suchen, so stoßen wir wohl darauf, daß es im Wesen der Dinge begründet ist, in welche ursächlichen Zusammenhänge sie eintreten können; andererseits sind es die ursächlichen Zusammenhänge, die uns etwas vom Wesen enthüllen. Beides zeigt aber, daß das Wesen etwas Tieferliegendes ist als die ursächlichen Zusammenhänge. So bedeutet der allgemeine ursächliche Zusammenhang noch keinen allgemeinen Sinnzusammenhang aller Dinge. Dazu kommt noch, daß die Gesamtheit aller wirklichen Dinge noch nicht alles endliche Seiende überhaupt umschließt. Zur Gesamtheit alles Seienden gehört auch vieles »Unwirkliche«: Zahlen, geometrische Gebilde, Begriffe u. a. m. Sie alle werden von der Einheit des Logos umschlossen. Der Zusammenhang, in dem »alles« im Logos steht, ist als die Einheit eines Sinn-Ganzen zu denken.
Der Zusammenhang unseres eigenen Lebens ist vielleicht am besten geeignet, um zu veranschaulichen, was gemeint ist. Man unterscheidet in der gewöhnlichen Redeweise »Planvolles« – und das gilt zugleich als »sinnvoll« und »verständlich« – und »Zufälliges«, was in sich sinnlos und unverständlich erscheint. Ich habe ein bestimmtes Studium vor und suche mir dafür eine Universität aus, die mir besondere Förderung in meinem Fach verspricht. Das ist ein sinnvoller und verständlicher Zusammenhang. Daß ich in jener Stadt einen Menschen kennen lerne, der »zufällig« auch dort studiert, und eines Tages »zufällig« mit ihm auf weltanschauliche Fragen zu sprechen komme, erscheint mir zunächst nicht durchaus als verständlicher Zusammenhang. Aber wenn ich nach Jahren mein Leben überdenke, dann wird mir klar, daß jenes Gespräch von entscheidendem Einfluß auf mich war, vielleicht »wesentlicher« als mein ganzes Studium, und es kommt mir der Gedanke, daß ich vielleicht »eigens darum« in jene Stadt »gehen mußte«. Was nicht in meinem Plan lag, das hat in Gottes Plan gelegen. Und je öfter mir so etwas begegnet, desto lebendiger wird in mir die Glaubensüberzeugung, daß es – von Gott her gesehen – keinen »Zufall« gibt, daß mein ganzes Leben bis in alle Einzelheiten im Plan der göttlichen Vorsehung vorgezeichnet und vor Gottes allsehendem Auge ein vollendeter Sinnzusammenhang ist. Dann beginne ich mich auf das Licht der Glorie zu freuen, in dem auch mir dieser Sinnzusammenhang entschleiert werden soll. Das gilt aber nicht nur für das einzelne Menschenleben, sondern auch für das Leben der ganzen Menschheit und darüber hinaus für die Gesamtheit alles Seienden. Ihr »Zusammenhang« im Logos ist der eines Sinn-Ganzen, eines vollendeten Kunstwerkes, in dem jeder einzelne Zug sich an seiner Stelle nach reinster und strengster Gesetzmäßigkeit in den Einklang des gesamten Gebildes fügt. Was wir vom »Sinn der Dinge« erfassen, was »in unseren Verstand eingeht«, das verhält sich zu jenem Sinnganzen wie einzelne verlorene Töne, die mir der Wind von einer in weiter Ferne erklingenden Symphonie zuträgt. In der Sprache der Theologen heißt der Sinnzusammenhang alles Seienden im Logos der »göttliche Schöpfungsplan« (ars divina). Das Weltgeschehen von Anbeginn ist seine Verwirklichung. Hinter diesem »Plan« aber, hinter dem »künstlerischen Entwurf« der Schöpfung, steht (ohne davon seinsmäßig getrennt zu sein) die ewige Fülle des göttlichen Seins und Lebens.
Darin ist schon die Antwort auf die weitere Frage beschlossen: Wie ist das »con-stare« der Dinge, ihr »Bestehen« oder »Leben« im Logos aufzufassen? Es wurde schon erwähnt, daß darunter nicht ihr wirkliches Sein zu verstehen sei – sonst hätte ja auch die Rede von einem »Plan« und seiner »Verwirklichung« keinen Sinn mehr. Der Name »Logos« weist darauf hin, daß ihr wesenhaftes Sein gemeint sein könnte: daß der »Sinn« der Dinge, von dem wir ja sagen mußten, daß er »ungeworden« sei, im göttlichen Logos seine Heimat habe. Das, was als ein Glied im göttlichen Schöpfungsplan von Ewigkeit her Bestand hat, wird den Dingen als ihr Sinn »mitgeteilt« und in ihnen verwirklicht. Es gehört ja zum wesenhaften Sein, daß das, was in dieser Weise ist, »mitgeteilt« und in einer Vielheit von Einzeldingen wirklich werden kann. Aber mit dem wesenhaften Sein, wie wir es in den Dingen angetroffen haben, kann das Sein der Dinge im Logos nicht erschöpfend gekennzeichnet sein. Sonst verdiente es nicht, »Leben« genannt zu werden, und es könnte nicht von »schöpferischen Wesenheiten« gesprochen werden. Außerdem erinnern wir uns, daß in Gott wesenhaftes und wirkliches Sein nicht zu trennen ist, und schließlich daran, daß das Johannes-Evangelium vom Logos sagt, durch ihn sei alles gemacht worden. Was in den Dingen wirklich wird, ist im Logos nicht nur als ein »Unwirkliches« vorgezeichnet, sondern ist in Ihm wirklich und wirksam: das Wirklichwerden in den Dingen ist die Wirkung dieser Wirksamkeit. So ist die Deutung der »Ideen« als schöpferischer Urbilder im göttlichen Geist zu verstehen.
Damit sind aber keineswegs alle Rätsel gelöst. Nach der früher gegebenen Kennzeichnung des wesenhaften Seins müßten wir sagen: Es ist »dasselbe«, was in »urbildlicher Wirklichkeit« von Ewigkeit her in Gott war und was in der Zeit in den Dingen wirklich wird. In den Dingen nun ist die Trennung des Was und des Wesens von seiner Verwirklichung, des wesenhaften vom wirklichen Sein möglich. In Gott aber erwies sie sich als unmöglich. Mit dieser Schwierigkeit hängt eine andere, auch schon früher erwähnte, nahe zusammen: die Einheit des göttlichen Wesens und die Vielheit der »Ideen«. Wir verglichen den Zusammenhang alles Seienden im Logos einem wohlgeordneten Kunstwerk, einer gegliederten Mannigfaltigkeit von vollendeter Einheit und Geschlossenheit. Wie verträgt sich das mit der Einfachheit des göttlichen Wesens, das nichts anderes ist als das göttliche Sein? Thomas sucht die Lösung der Schwierigkeit darin, daß das eine und einfache göttliche Wesen die Ursache der Dinge sei und daß die Vielheit durch die Beziehung auf die Mannigfaltigkeit der Dinge hineinkomme: »… der Verstand Gottes, der alles wirkt, bringt alles nach dem Bilde seines Wesens hervor; darum ist sein Wesen die Idee der Dinge. … Die geschaffenen Dinge aber bilden das göttliche Wesen nicht vollkommen ab; darum wird das Wesen vom göttlichen Verstand nicht absolut als Idee der Dinge genommen, sondern im Verhältnis zu dem Ding, das nach dem göttlichen Wesen selbst geschaffen werden soll, je nachdem es dahinter zurückbleibt oder es nachbildet. Verschiedene Dinge aber bilden es auf verschiedene Weise nach und jedes auf seine eigene Weise, da es einem jeden eigen ist, von dem andern unterschieden zu sein; und so ist das göttliche Wesen selbst, wenn die verschiedenen Verhältnisse der Dinge zu ihm hinzugedacht werden, die Idee eines jeden Dinges. Da nun die Verhältnisse verschieden sind, muß es notwendig eine Vielheit von Ideen geben; und es ist zwar, von seiten des Wesens gesehen, eines für alle; doch die Vielheit findet sich auf seiten der verschiedenen Verhältnisse der Geschöpfe zu ihm.«
Es tut der Einheit und der Einfachheit des göttlichen Wesens keinen Abbruch, daß der göttliche Geist die Mannigfaltigkeit alles Seienden als Mannigfaltigkeit umspannt: es geschieht dies ja »uno intuitu«, mit einem einzigen Blick von Ewigkeit her – unwandelbar. Dieser Blick umspannt alles, »was war, ist und sein wird«: »Was« und »Wesen« in ihrer Verwirklichung in den Dingen, aber auch alles Mögliche, was niemals wirklich wird, und – beides umgreifend – alles Mögliche und Wirkliche ungeachtet seines nur möglichen oder wirklichen Seins, das bloße Was oder den »Sinn« als alles umfassende Sinn-Mannigfaltigkeit. In dieser Sinn-Mannigfaltigkeit hat alles Seiende seine Stelle, das Endliche als in sich geschlossene und abgegrenzte Sinn-Einheit, das Wirkliche als »vorausgedachter Gedanke Gottes«.
So kommen wir doch zu einer doppelten Bedeutung des Seins des Endlichen im Ewigen: zu einem Umfaßtsein alles »Sinnes« durch den göttlichen Geist, und zu einem urbildlich-ursächlichen Begründetsein alles Seienden im göttlichen Wesen.
Von hier aus öffnet sich auch die Möglichkeit zur Lösung einer Schwierigkeit, die gelegentlich gestreift wurde: die Möglichkeit, die Gegenstände, die nicht wirklich und nicht geworden, aber auch nicht bloß gedacht sind, doch als »geschaffen« anzusehen. Wir haben öfters von »idealen Gegenständen« gesprochen und sie in das Gebiet des »wesenhaften Seins« eingeschlossen. Geometrische Gebilde – der Punkt, die Gerade, das Dreieck, der Kreis; ebenso ihre »Vereinzelungen«: das seiner Länge nach bestimmte Stück einer Geraden, das Dreieck von bestimmter Seitenlänge und Winkelgröße – sind nicht »wirklich«: ihre »Verwirklichungen«, die Ecken, Kanten und Flächen wirklicher Körper, sind tatsächlich keine Verwirklichungen, sondern »unvollkommene Abbilder«, Annäherungen an die reinen geometrischen Gebilde. Sie als »bloß gedacht« zu bezeichnen, geht nicht an, wenn ich darunter ein willkürliches Erdenken verstehe. Ich kann den Begriff »dreieckiger Kreis« bilden. Aber das ist ein widerspruchsvoller Begriff, den ich nicht zu erfüllender Anschauung bringen kann. Trotzdem hat er ein »gedankliches Sein«. Ich kann »mir« jedoch einen dreieckigen Kreis »nicht denken« (d. h. ich kann ihn mir nicht in geometrischer Anschauung vor das geistige Auge führen), weil es »so etwas nicht gibt«. Und das heißt nicht bloß, daß es in Wirklichkeit nicht vorkommt, sondern daß es in sich unmöglich ist, daß ihm jenes Sein mangelt, das den geometrischen Gebilden als solchen eigen ist. Dieses Sein ist aber auch nicht das Sein des »Wesens« in dem festgelegten Sinn »Wesen von etwas«. Das Wesen bedarf eines Gegenstandes, worin es sein kann; sein Sein ist ein unselbständiges. Das Dreieck dagegen (d. h. das einzelne letztbestimmte Dreieck) ist selbst ein Gegenstand, es bedarf keines andern zu dem ihm eigentümlichen Sein. Jedes Dreieck hat sein Wesen, das in ihm – nicht »verwirklicht«, aber zu »geometrischer Existenz gelangt« ist. Das »Gelangen« ist kein Werden in der Zeit.
Die geometrische Existenz hat keinen zeitlichen Anfang. Wenn wir ein Dreieck »konstruieren«, so bedeutet es nicht, daß wir es »erzeugen« oder »schaffen«. Wir suchen vielmehr das Gebilde auf, in dem sich die uns bekannten Teilstücke finden. (Das geschieht in der »Analyse«.) Die »Konstruktion« ist ein möglichst getreues »Nachbilden« des gefundenen geometrischen Gebildes in einem wirklichen Material oder ein »Hineindeuten« des Gebildes in den Raum. In diesem Hineindenken sind wir in der Tat »frei«, weil das Gebilde beliebige Lagen annehmen kann. So ist die Lage an einem bestimmten Ort etwas, was für das Gebilde anfangen und aufhören kann; wir haben die Möglichkeit, es »im Raum zu bewegen«, seine Lage zu verändern; von ihm aus gesehen ist das etwas, was mit ihm geschehen kann, was es zuläßt. Aber es ist keine wirkliche Bewegung und kein wirkliches Geschehen. Was wir mit dem Dreieck vornehmen, ist ein geistiges Tun. Das legt den Gedanken nahe, daß vielleicht die Lage dem geometrischen Gebilde selbst gar nicht zukomme, sondern daß sie ihm nur von uns »zugedacht« sei. Daß sie ihm anders zukomme als Gestalt und Größe, ist ja schon ausgesprochen worden. Da aber die Lage das Einzige ist, wodurch sich zwei gleiche Dreiecke unterscheiden, so taucht die weitere Frage auf, ob nicht auch das Einzelsein den geometrischen Gebilden nur »zugedacht« sei. Der letztbestimmte Gegenstand, dem geometrische Existenz zukommt, wäre dann das Dreieck von bestimmter Seitenlänge und Winkelgröße; sein Einzeldasein in dieser oder jener Lage oder auch in verschiedenen Lagen zugleich wäre etwas »bloß Gedachtes«. Das ist aber offenbar nicht zutreffend. Die sechs gleichen Quadrate, die einen Würfel begrenzen, sind sechs, und jedes von ihnen hat seine eigene geometrische Existenz, wir können nicht sagen, es sei eigentlich nur eines, das sechsmal gedacht sei; dagegen ist es wohlberechtigt, zu sagen, »dasselbe« Quadrat (seinem wesenhaften Sein nach) komme an dem Würfel sechsmal vor. Allerdings ist die Frage, ob dieses »Vorkommen« schon als echtes Einzeldasein aufzufassen sei. Der Würfel mit seinen sechs gleichen Seitenflächen kann ja wiederum vielmals im Raum »gedacht« werden. Den Seitenflächen kommt im Aufbau eines Körpers, den Begrenzungslinien im Aufbau eines flächenhaften Gebildes eine bestimmte Lage zu. Aber den Körpern – und ebenso den andern Gebilden, wenn sie als selbständige aufgefaßt werden, nicht als aufbauende Teile von Körpern – kommt im Raum keine bestimmte, sondern »irgendeine« Lage zu. Es gehört zu ihm die Möglichkeit, in bestimmter Lage zu sein. Wenn diese Lage ihm nur »zugedacht« ist, so ist auch sein Einzelsein ein »nur gedachtes«. Gibt es dagegen im Raum ein Naturding, in dem das geometrische Gebilde »verwirklicht« ist, so liegt eine echte Vereinzelung vor, nicht eine »bloß gedachte«. Dabei ist das Einzelsein des geometrischen Gebildes von dem wirklichen Sein des Dinges, an dem es zur Abhebung kommt, noch zu unterscheiden. Die Dinge sind ja unvollkommene Verwirklichungen der geometrischen Gebilde, und die »reinen Gestalten« müssen aus ihnen in einer eigentümlichen Anschauungsweise herausgeholt werden.
Wir brauchen die Frage des Einzelseins geometrischer Gebilde hier nicht weiter zu verfolgen. Worauf es in unserm Zusammenhang ankommt, das ist das eigentümliche Sein der »idealen Gegenstände« – für die uns die geometrischen Gebilde als Beispiel dienten – in seinem Unterschied zum wirklichen Sein einerseits, zum bloßen Gedachtsein auf der andern Seite zu erfassen. Diese Gebilde können in der Zeit »verwirklicht« oder »gedacht« werden, aber sie haben unabhängig davon ein zeitloses Sein, sie selbst, als in sich bestimmte Gebilde, werden nicht. Kann es dann noch einen Sinn haben, sie als »geschaffen«, als Verwirklichungen schöpferischer Gottesgedanken« zu bezeichnen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns den Doppelsinn des Seins der »Ideen« »in Gott« vor Augen halten. Die Ideen sind einmal das »Was« alles Seienden, so wie es als gegliederte SinnMannigfaltigkeit vom göttlichen Geist umspannt ist. Darin haben auch die Ideen ihre bestimmte Stelle. Ihr eigenes Sein ist gegenüber diesem »Sein im Logos« nicht etwas Späteres und Abgeleitetes, sie werden mit ihrem eigenen Sein, das ein zeitloses und wandelloses ist im Unterschied zum anfangenden und fließenden wirklichen Sein der Dinge, vom Logos umfaßt. Die Ideen als Ursache alles endlichen Seienden sind das eine einfache göttliche Wesen, zu dem alles Endliche in einem eigentümlichen Abbildverhältnis steht; dieses Abbildverhältnis muß für alles endliche Seiende angenommen werden, für das zeitlose wie für das zeitliche. Sofern das »Urbild« das Erste ist und die »Abbilder« das Abgeleitete, das durch das Abbildverhältnis seinen Daseinssinn empfängt, ist alles Endliche als durch das Ursprüngliche und Einfache in sein Sondersein hineingesetzt und in diesem Sinn als geschaffen anzusehen.
Von daher leuchtet wieder der nahe Zusammenhang zwischen dem »Logos« und der Schöpfung auf. Der Logos nimmt eine eigentümliche MittelStellung ein; er hat gleichsam ein doppeltes Antlitz, wovon eines das eine und einfache göttliche Wesen widerspiegelt, das andere die Mannigfaltigkeit des endlichen Seienden. Er ist das göttliche Wesen als erkanntes und ist die Sinn-Mannigfaltigkeit des Geschaffenen, die von göttlichem Geist umspannt wird und das göttliche Wesen abbildet. Von daher ist ein Weg zum Verständnis einer doppelten sichtbaren Offenbarung des Logos: im menschgewordenen Wort und in der geschaffenen Welt. Und von da aus führt ein weiterer Schritt zum Gedanken der untrennbaren Zusammengehörigkeit des menschgewordenen und des »weltgewordenen« Logos in der Einheit des »Haupt und Leib – ein Christus«, wie sie uns in der Theologie des Apostels Paulus und in der Lehre vom Königtum Christi bei Duns Scotus entgegentritt. Aber das sind schon rein theologische Fragen, die über unsern Rahmen hinausgehen.
Die herangezogenen Glaubenswahrheiten – der Trinität und der Erschaffung alles endlichen Seienden durch den göttlichen Logos – sollten Licht geben in der Schwierigkeit, in die uns die rein philosophische Erforschung der Seinsfrage führte: wir waren auf der einen Seite, vom endlichen Seienden und seinem Sein herkommend, auf ein erstes Seiendes gestoßen, das Eines und einfach sein muß, Was, Wesen und Sein in Einem; auf der andern Seite gelangten wir, vom Was des endlichen Seienden ausgehend, zu einer Mannigfaltigkeit letzter Wesenselemente. Rein philosophisch zum Verständnis dieses doppelten Antlitzes des »ersten Seienden« zu gelangen, ist nicht möglich, weil uns keine erfüllende Anschauung des ersten Seienden zu Gebote steht. Die theologischen Überlegungen können zu keiner rein philosophischen Lösung der philosophischen Schwierigkeit führen, d. h. zu keiner unausweichlich zwingenden »Einsicht«, aber sie eröffnen den Ausblick auf die Möglichkeit einer Lösung jenseits der philosophischen Grenzpfähle, die dem entspricht, was noch philosophisch zu erfassen ist, wie andererseits die philosophische Seinserforschung den Sinn der Glaubenswahrheiten aufschließt.