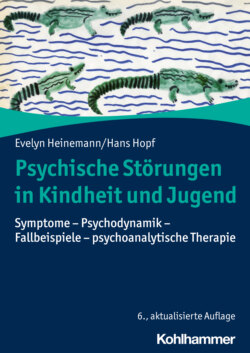Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3 Psychoanalytische Pädagogik in den USA
ОглавлениеDer Krieg führte zur Vertreibung vieler Psychoanalytiker, vor allem nach England und in die USA. Der soziale Kontext, in dem sich Psychoanalyse im Exil entwickelte, war ein anderer. In den USA wurde konsequent eine Medizinalisierung der Psychoanalyse betrieben, und es wurden bereits 1938 keine Pädagogen mehr zur psychoanalytischen Ausbildung zugelassen. Die Arbeiten von Bettelheim und Redl blieben so die vereinzelten, aber bedeutsamen Ansätze einer psychoanalytischen Pädagogik in den USA. In England wurde die klassische Kindertherapie weiterentwickelt, vor allem in der Hampstaed Child-Clinic und der Tavistock Clinic ( Kap. 5).
Bettelheim (1971; 1978) übernahm 1944 die Leitung der Orthogenic School der Universität von Chicago und blieb ihr Leiter bis 1973, einer der wenigen psychoanalytischen Erziehungsversuche, die nicht schon nach kurzer Zeit eingestellt werden mussten. Bettelheims Konzept der Milieutherapie versuchte ein therapeutisches Klima in einer Einrichtung zu gestalten, in der 34 psychisch schwerst gestörte, psychotische, autistische und verwahrloste Kinder bis 18 Jahre untergebracht waren. Auf einzigartige Weise hat Bettelheim das räumliche und menschliche Umfeld für die Kinder durchdacht und gestaltet. Die Räumlichkeiten sollten in Form von stummen Botschaften den Kindern die Einstellungen ihrer Beziehungspersonen vermitteln. Die Badezimmer waren so gestaltet, dass sie farblich ansprechend und in ihnen Platz für Gespräche waren. Die Treppenhäuser, Symbole für Regression und Progression (Auf- und Absteigen), waren ansprechend und bilderreich bemalt, die Kinder konnten ihre Zimmer selbst gestalten, es gab auf jeder Wohngruppe Kochmöglichkeiten, Süßigkeiten waren immer vorhanden, den Kindern wurden Porzellanteller sowie Messer und Gabel gegeben. So sollte ihnen symbolisch vermittelt werden, dass sie anerkannt und wertgeschätzt werden. Das Heim bot die Möglichkeit der Regression, psychotische Kinder durften etwa in den Papierkorb urinieren, wenn die Ängste vor der Toilette zu groß waren. Die Alltagssituationen wurden immer in ein psychoanalytisches Verstehen und eine pädagogische Antwort eingebunden.
Ein Beispiel aus dem Fall Joey, einem autistischen Jungen ( Kap. 27): »In den ersten Wochen, die Joey bei uns verbrachte, beobachteten wir ihn genau – zum Beispiel wie er den Speisesaal betrat. Zuerst entledigte er sich einer unsichtbaren Drahtspule, die ihn mit seiner elektrischen Energiequelle verbinden würde. Dann spulte er diesen unsichtbaren Draht ab und legte ihn bis zum Esstisch, um sich dort zu isolieren. Nun steckte er den unsichtbaren Draht in die Steckdose. (Er hatte versucht, echten Draht zu benutzen, doch das durften wir nicht zulassen, denn er hätte sich dadurch einen Schaden zufügen und wir hätten über die auf dem Fußboden ausgelegten Drähte stolpern können) … Seine Pantomime war so gekonnt und seine Konzentration derart ansteckend, dass die, die ihm dabei zuschauten, ihre eigene Existenz zu vergessen schienen und zu Augenzeugen einer anderen Realität wurden … So wie der Säugling den Kontakt zur Mutter herstellen muss, um gestillt zu werden, musste Joey den Kontakt zur Elektrizität herstellen, bevor er funktionieren konnte … So wie keiner von uns die stillende Mutter und ihr Kind stören möchte, weil hier ein lebensspendender Kreislauf am Werk ist, bemühten sich unsere Kinder und unsere Mitarbeiter unwillkürlich, nicht auf Joeys unsichtbare Drähte zu treten, damit der Strom nicht unterbrochen und seinem Leben kein Ende gesetzt wurde« (1983, S. 309 f.).
Das Heim bot Raum für Regression und Darstellung der Symptome, die von den Mitarbeitern verstanden wurden; dabei wurden auch die Gefühle der Mitarbeiter, deren Gegenübertragungen, auch wenn Bettelheim dieses Wort selten verwendet, reflektiert. Waren die Symptome verstanden, wurden sie dem Kind gedeutet; dabei konnte die Deutung auch in Form der pädagogischen Reaktion gegeben werden.
Als Joey einmal seiner Beraterin sagte, dass der Strom ausgefallen und die Leitungen tot seien, bot sie ihm ihre Hilfe an und fügte spontan hinzu: »Möchtest du einen Bonbon oder Kaugummi, bis die Sache wieder klappt?« Während Joey sich das Bonbon holte, warf er einen Blick auf den Apparat und sagte: »Jetzt sind die Drähte wieder okay« (ebd., S. 328). Der Kontakt war wiederhergestellt, aber er war menschlicher geworden. Psychoanalytische Pädagogik bietet bei Bettelheim Raum für Regression und für das Verstehen der Bedeutung der Symptome. Sie werden den Kindern verbal oder nonverbal durch Reaktionen gedeutet, und allmählich setzt auch bei Bettelheim eine Ich-Stärkung durch Förderung der Progression ein. So wurde Joey irgendwann vorgeschlagen, die Röhren beim Essen zu reduzieren oder beim Toilettengang nur noch eine Taschenlampe mitzunehmen, statt des ganzen Apparates. Durch zahlreiche Gespräche, zum Beispiel, wenn Joey in der Badewanne lag, ergaben sich Möglichkeiten, die Ängste und Fantasien zu verbalisieren. Entscheidend für das Angebot der Ich-Stärkung war, dass die Ängste zuvor bearbeitet waren, d. h. Joey Vertrauen und menschlichen Kontakt herstellen konnte, bevor er angeregt wurde, auf seine Symptome zu verzichten. Die Mitarbeiter passten sich dem Tempo des Kindes an. Gleichzeitig blieb der Rahmen pädagogisch, mit den Kindern wurde Alltag gestaltet und gelebt.
Redl war vor seiner Emigration in die USA in Wien als Lehrer tätig und erhielt ab 1928 eine psychoanalytische Ausbildung. Seit 1930 war er Leiter der Wiener Erziehungsberatungsstellen und als Schulpsychologe in einem Landerziehungsheim tätig. Wahrscheinlich aufgrund seiner reichhaltigen pädagogischen Erfahrungen sind Redls Bücher, wie kein anderes Werk der psychoanalytischen Pädagogik, an pädagogischen Fragestellungen orientiert, die psychoanalytisch verstanden und so differenziert und alltagsnah beschrieben werden, dass sie viele Anregungen für die Praxis geben, ohne dem Fehler zu verfallen, Rezepte bieten zu wollen. 1941 wurde Redl Professor für Sozialarbeit in Detroit. Redl und sein Mitarbeiter Wineman gründeten 1946 das »Pioneer House«, in dem fünf schwer gestörte hyperaggressive Jungen im Alter von acht bis elf Jahren von 10 Pädagogen betreut wurden (Fatke 1974). Die Jungen kamen alle aus Familien der unteren Einkommensgruppen und hatten durchschnittliche Intelligenz. Bereits nach 19 Monaten musste das Projekt aufgrund finanzieller Schwierigkeiten wieder aufgegeben werden.
Redl zweifelte nie am Nutzen der Psychoanalyse für die Pädagogik. »Warum sollte nicht ein Stück analytischen Prozesses in den Dienst der Erziehung gestellt werden können?« (Redl 1932, S. 529). Zweck des Erziehens bleibt auch bei Redl die Herstellung einer gewissen Triebunterdrücktheit und Sublimiertheit. Als Erziehungsmittel muss jedoch nicht immer die Triebunterdrückung dienen. Was wir aufgrund der durch die Psychoanalyse gewonnenen Einsichten pädagogisch tun, bleibt immer noch Erziehung. Unter psychoanalytischer Pädagogik versteht Redl die Verwertung analytischer Forschungsergebnisse, die Erfüllung pädagogischer Aufgaben und die Bearbeitung pädagogischer Probleme.
Redl und Wineman entwickelten ihr Konzept der Milieutherapie auf den Theorien der Ich-Psychologie. Nach dem Konzept von Redl und Wineman (1984, S. 29) leiden aggressive Kinder unter spezifischen Störungen des Ich und Über-Ich. »Um herauszubekommen, wie man sie heilen kann, müssen wir uns daher zunächst ein wirklich gründliches Bild davon machen, was diese Ich-Störungen und Fehlentwicklungen des Über-Ich sind, welche Ich-Funktionen noch intakt und welche gestört sind, und wir müssen auch genau wissen, welche Abwehrmechanismen sie entwickelt haben, um sich gegen die Einwirkungen ihrer Umwelt zu wehren« (ebd., S. 30). Psychoanalytische Pädagogik ist bei ihnen Unterstützung und Stärkung der geschädigten Ich-Funktionen. Erst wenn die Abwehr aufgelöst sei, können Therapiemethoden ausprobiert werden. Alle pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen sollen Kontrollen von innen erzeugen, das Ich unterstützen bzw. gestörte Ich-Funktionen wiederherstellen helfen. Es bedarf eines speziellen Heim-Klimas (z. B. Gewähren von Befriedigung durch Freizeit und liebevolle Zuwendung), einer Programmgestaltung zur Ich-Unterstützung (strukturierte Freizeitprogramme) und der therapeutischen Nutzbarmachung von Ereignissen des täglichen Lebens (ebd., S. 36 ff.). Redl und Wineman (1986) beschreiben beispielsweise 17 »antiseptische Techniken zur Ich-Unterstützung«, z. B. Wiedergutmachungsmaßnahmen zur Verminderung von Schuldgefühlen und Aggressionen oder die Interpretation durch Umstrukturierung der Realität, die im Alltag eingesetzt werden und das Ich des Kindes über die pädagogische Reaktion stärken sollen. Die pädagogische Reaktion wird analytisch reflektiert und ist quasi eine indirekte Deutung. Ähnlich wie bei Zulliger, der die Bedeutung kleiner Besprechungen in Schulalltag hervorhob, werden bei Redl die Konflikte im pädagogischen Alltag psychoanalytisch reflektiert, der Rahmen bleibt aber ein pädagogischer.