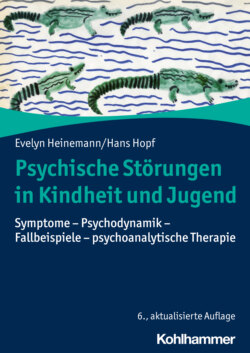Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Psychoanalytische Therapie bei Kindern und Jugendlichen 5.1 Rückblick
ОглавлениеAbgesehen von Freuds Schrift »Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben« (1909, Kap. 4 und Kap. 10), die wir als ersten im engeren Sinne psychoanalytisch-pädagogischen Erziehungsversuch beschrieben haben, blieb Freud auf jeden Fall skeptisch, was eine Analyse von Kindern anging, da er keine therapeutischen Mittel sah, welche die Sprache ersetzen könnten. Der Versuch einer Bewältigung dieses zentralen Problems – der Kampf um die Technik – zog sich durch alle kinderanalytischen Versuche der Anfangszeit. Ferenczi schien ganz nahe an der Bewältigung dieses Problems zu sein. 1913 stellte er in seiner Fallgeschichte »Ein kleiner Hahnemann«, parallel zum »kleinen Hans«, wie zu vermuten ist, den vierjährigen Arpád vor, dessen eigenartiges Symptom des ständigen Krähens er als Folge von Kastrationsdrohungen wegen seiner Onanie und der Wut auf den Hahn bzw. den Vater interpretierte. Interessant ist, dass Ferenczi dem Jungen Bleistift und Papier gab, damit er seine Ängste in Gestalt des bedrohlichen Hahns aufzeichnen könnte. Ein psychoanalytisches Gespräch »langweilte« den kleinen Patienten jedoch rasch, und er wollte »zu seinen Spielsachen zurück« (1913, S. 166). Jene deutlichen Hinweise auf eine dem Kind gemäße Sprache und seinen Wunsch nach Kommunikation konnte Ferenczi damals weder erkennen noch aufgreifen: Er ging im Anschluss daran davon aus, dass eine direkte psychoanalytische Untersuchung des Arpád nicht möglich gewesen sei.
Als erste Kinderanalytikerin gilt die 1871 geborene Hermine Hug-Hellmuth. Nach dem Studium der Naturwissenschaften und einem Lehrerstudium ließ sie sich bereits 1910 vorzeitig pensionieren, um sich ausschließlich ihren psychoanalytischen Interessen zu widmen. 1913 wurde Hug-Hellmuth Mitglied der Wiener psychoanalytischen Vereinigung und für Sigmund Freud eine begehrte Bezugsperson, die ihm unermüdlich Fallmaterial zur Bestätigung seiner Sexualtheorien lieferte (Stephan 1992, S. 115). Bereits 1920 publizierte sie einen Aufsatz über »Die Technik der Kinderanalyse«, der noch stark unter pädagogischem Einfluss stand. Die Psychoanalyse des Kindes ist bei ihr »heilerziehliche Analyse«. Die jungen Patienten sollen unter der erzieherischen Führung des Analytikers zu zielbewussten, willenskräftigen Menschen erstarken. Hug-Hellmuth ging von Anfang an davon aus, dass das identische Ziel von Erwachsenen wie Kinderanalyse die Herstellung der psychischen Gesundheit sei. Unterschiede resultierten ihrer Meinung nach allerdings aus der noch nicht vorhandenen Reife der Kinder, die weder aus eigenem Antrieb zur Behandlung kommen, noch an ihrer Vergangenheit leiden oder sich gar ändern möchten. Als bedeutendste Neuerung führte Hug-Hellmuth ein, neben den Träumen auch auf das Spiel der Kinder einzugehen. Sie war der Auffassung, dass sich in den Spielformen manche Symptome, Eigenheiten und Charakterzüge erkennen ließen; bei jugendlichen Patienten (diesen Sieben-Achtjährigen, E. H., H. H.) würde mitunter das Spiel seine herausragende Rolle während der ganzen Behandlung behaupten (ebd., S. 17). Inwieweit und wann freie Assoziation überhaupt anwendbar sei, ließ sich ihrer Meinung nach nur von Fall zu Fall entscheiden.
In einer Würdigung ihres Lebens und ihrer Arbeit betonen Geissmann und Geissmann (1994), dass Hug-Hellmuth als erste die dem Traum oder der freien Assoziation gleichgestellte Verwendung des Spiels in die Kinderanalyse eingeführt hat (ebd., S. 50). Stephan (1992) meint allerdings, dass viele Aussagen von Hug-Hellmuth, insbesondere die Analyse ihres Neffen betreffend, aus heutiger Sicht eher als abschreckendes Dokument einer »Schwarzen Pädagogik« zu werten seien. In der Tat hatte Hug-Hellmuth ihren Neffen, nichteheliches Kind ihrer Schwester, als kleines Kind selbst analysiert. Im Alter von 18 Jahren hatte er schließlich seine 53-jährige Tante, welche seit seinem 9. Lebensjahr die gesamte Erziehungsverantwortung für ihn übernommen hatte, überfallen, beraubt und erdrosselt. Dieser tragische Vorfall bedeutete einen erheblichen Rückschlag für die gesamte Psychoanalyse, weil er zunächst alle damaligen Vorurteile bestätigte, welche Schäden es bewirken könnte, die Psychoanalyse in der Kindererziehung anzuwenden.
Unangefochten gelten Anna Freud und Melanie Klein als die eigentlichen Begründerinnen der Kinderanalyse. Anna Freud wurde 1895 als sechstes Kind von Martha und Sigmund Freud geboren. Nach Gay (1989) wurde sie Sekretärin, Vertraute, Kollegin und Krankenschwester Freuds, und vor allem zu einer glühenden Verfechterin und Verteidigerin seiner Theorien. Nach dem Abitur absolvierte Anna eine pädagogische Ausbildung und arbeitete von 1917 bis 1920 als Lehrerin (Stephan 1992, S. 280). Ihre ersten Überlegungen zur Technik der Kinderanalyse trug Anna Freud in vier Vorträgen 1926 vor der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung vor. Zusammen mit einem fünften Vortrag, den sie 1927 hielt, sind diese Vorträge in dem Buch »Einführung in die Technik der Kinderanalyse« (1973) publiziert. Die vier Vorträge erschienen bereits 1929 in Buchform, gleichzeitig wurde ein Seminar für Kinderanalyse in Wien gegründet, dem u. a. Berta und Steff Bornstein, Edith Sterba, Jenny Waelder, Dorothy Burlingham, Edith Buxbaum, Erik H. Erikson, das Ehepaar Hoffer, Anna Katan, Marianne Kris und Margaret Mahler angehörten (Hamann 1993, S. 39), allesamt später bedeutende Vertreterinnen und Vertreter der Kinderanalyse.
Anna Freud entwickelte wesentliche Grundeinsichten der Kinderanalyse und eine spezielle Technik, die sie darauf gründete, dass das Kind im Gegensatz zum Erwachsenen noch ein unreifes und unselbständiges Wesen sei und der Entschluss zur Analyse nicht vom Patienten selbst, sondern von den Eltern oder seiner sonstigen Umgebung kommt: »So fehlt uns in der Situation des Kindes alles, was in der des Erwachsenen unentbehrlich erscheint: die Krankheitseinsicht, der freiwillige Entschluss und der Wille zur Heilung« (1973, S. 16). Ihre Ausführungen zur Einleitung der Analyse und Äußerungen zum Erziehungsverständnis muten heute äußerst befremdend an. Wie bei Hug-Hellmuth können wir ihr Erziehungsverständnis nur historisch betrachten, eine Auffassung, von der sich die Kinderanalyse erst allmählich befreien musste. Wir sehen es mittlerweile auch als Missbrauch der Kinderanalyse, wenn in der Zeit der Anfänge Analytiker ihre eigenen Kinder analysierten, Sigmund Freud seine Tochter Anna, Melanie Klein zwei ihrer Kinder und Hug-Hellmuth ihren Neffen.
Da ist bei Anna Freud die Rede von einem Jungen mit »Wut- und Schlimmheitsausbrüchen«, dessen Symptom Anna Freud mit Hilfe eines »hinterhältigen und nicht sehr ehrlichen Mittel« mit dem Wüten eines Geisteskranken gleichsetzte, um ihn einzuschüchtern. Es wurde versprochen, geworben, gelockt, Angst gemacht, alles, um dem Kind die Analyse schmackhaft zu machen, es wurde Anpassung und Unterwerfung eingefordert. Nach Anna Freud muss das Kind erst »analysierbar« gemacht werden. Die Zeit der Vorbereitung, »die Dressur zur Analyse« (ebd., S. 16), dauert umso länger, je weiter das Kind vom idealen erwachsenen Patienten entfernt ist. Manchmal sei es so schwierig, das Interesse für die Analyse zu gewinnen, dass sie »sich wie ein Kinofilm oder ein Unterhaltungsroman benimmt« (ebd., S. 21), der keine andere Absicht hat, als die Zuschauer anzulocken, als sich dem Kinde interessant zu machen. Interessierte sich das Kind für Knoten, bemühte sie sich noch kunstvollere Knoten zu machen als das Kind selbst. Sie strickte und häkelte für die Puppen ihrer Patientinnen und wurde so »brauchbar« für das Kind. »Ich war ihm neben einer interessanten und brauchbaren Gesellschaft zu einer sehr mächtigen Person geworden, ohne deren Unterstützung er nicht mehr recht auskommen konnte« (ebd., S. 22). Erst jetzt sei das Kind in ein vollständiges Übertragungs- und Abhängigkeitsverhältnis geraten. Die Gegenleistung des Kindes ist dann die Preisgabe seiner bisher gehüteten Geheimnisse, mit der erst die wirkliche Analyse einsetzt. »Es muss dem Analytiker gelingen, sich für die Dauer der Analyse an die Stelle des Ichideals beim Kinde zu setzen« (ebd., S. 75). Die Autorität des Analytikers müsse über der der Eltern stehen, der Analytiker müsse den höchsten Platz im Gefühlsleben des Kindes einnehmen, er müsse es völlig beherrschen, damit das Kind die Eltern nicht durch seinen Widerstand veranlasst, die Analyse abzubrechen. Es bestehe die »Notwendigkeit für den Analytiker, das Kind erzieherisch in der Gewalt zu haben« (ebd., S. 80). Der Analytiker muss bei ihr auch die äußere Situation richtig einschätzen, wofür er pädagogische Kenntnisse benötigt, der Analytiker muss erziehen und analysieren.
Bei den eigentlichen technischen Mitteln wird anstelle der bewussten Erinnerung die Krankengeschichte von den Eltern eingeholt. Einen besonderen Stellenwert nimmt bei Anna Freud die Traumdeutung ein. »Dafür haben wir in der Traumdeutung ein Gebiet, in dem man von der Erwachsenen- zur Kinderanalyse nichts umzulernen hat« (ebd., S. 36). Das Kind stehe dem Traum noch näher als der Erwachsene und so sieht Anna Freud im Traum ein wesentliches Mittel der Kinderanalyse, das selbst »unintelligenten Kindern« (ebd., S. 36) zugänglich sei, da auch sie die Deutungen der Träume verstehen. Neben der Deutung der Träume und Tagträume sah sie die Erzählungen der Fantasien der Kinder oder Kinderzeichnungen als weitere Hilfsmittel. Das große Handicap der Kinderanalyse sei, dass Kinder nur gelegentlich assoziieren. Die Einfallstechnik der Erwachsenen wird bei ihr, hier griff sie auf die Arbeiten von Hug-Hellmuth und Melanie Klein zurück, durch das Spiel ersetzt.
Anna Freud glaubte, eine positive Übertragung herstellen zu müssen, negative Übertragungen gelte es abzubauen, »die eigentlich fruchtbringende Arbeit wird immer in der positiven Bindung vor sich gehen«, so Anna Freud (ebd., S. 54), daher der ganze Aufwand ihrer Einleitung zur Kinderanalyse. Zudem bildet das Kind bei ihr keine Übertragungsneurose, weil es noch den Eltern ausgesetzt und der Kinderanalytiker alles andere als ein Schatten sei.
Weil die klassische Technik der Erwachsenenanalyse nicht zur Anwendung kommen konnte, vor allem durch die Weigerung des Kindes, zu Einfällen zu assoziieren, waren Veränderungen in der Technik erforderlich. Zwar könnten sich auch Kinder verbal ausdrücken, sie bekamen jedoch im Laufe der Zeit zusätzlich Möglichkeiten angeboten, zu spielen, zu malen, zu dramatisieren oder zu agieren. Die Kinder wurden auf diese Weise zum Agieren angeleitet, dennoch musste das Agieren wieder eingegrenzt und beherrscht werden, denn die Interpretationen waren nach Meinung von Anna Freud unsicherer und willkürlicher als in der Analyse von Erwachsenen. Darum sollte das Agieren des Kindes von einem ständigen Deuten und Verbalisieren begleitet werden. Die Verbalisierung verleiht dem Ich des Kindes mit der Zeit die Möglichkeit, zwischen Wünschen und Fantasien einerseits und der Realität andererseits zu unterscheiden (Anna Freud 1965, S. 2153; vgl. Katan 1961). Neben dem Verbalisieren erschien die Durcharbeitung von Ich-, Es- und Über-Ich-Widerständen geboten sowie die Arbeit mit der Übertragung (Anna Freud 1965, S. 2157).
Nach ursprünglicher Meinung von Anna Freud könnten Kinder zwar einzelne Übertragungsreaktionen entwickeln, jedoch keine volle Übertragungsneurose zustande bringen. Diese Tatsache rühre daher, weil das Kind noch in direkten Objektbeziehungen mit seinen Eltern in seinem häuslichen Umfeld lebt und der Analytiker Liebe und Hass mit den Eltern teilen muss. Da sich der Kinderanalytiker zudem viel aktiver in das spielerische Geschehen einlassen müsse, bleibe er natürlich auch nicht – wie der Erwachsenenanalytiker – wirklich abstinent, sondern werde für das Kind eine unverwechselbare Persönlichkeit. Anna Freud gebrauchte in diesem Zusammenhang eine Kinometapher: Ein Bild lasse sich auf eine Leinwand, auf welcher bereits ein Bild sei, nur schlecht projizieren. Diese Überzeugung hat Anna Freud später revidiert (Anna Freud 1965, S. 2157), als die ehemalige einleitende Phase nach Entwicklung der Ich-Psychologie durch eine konsequente Abwehranalyse ersetzt wurde. Hamann (1993) ist der Meinung, dass es im Laufe der Zeit zu vielerlei Veränderungen und zu einer Annäherung im Hinblick auf die Handhabung der Technik an die Vorstellungen von Melanie Klein kam.
Die von Anna Freud und ihrer Schule entwickelte ichpsychologische Behandlungstechnik wurde in Deutschland – neben ihrem Gesamtwerk »Die Schriften der Anna Freud« (1965) – vor allem in dem von Geleerd (1972) herausgegebenen Band »Kinderanalytiker bei der Arbeit« ausführlich anhand Fallmaterial dargestellt, ebenfalls in dem von der Stuttgarter Akademie edierten Almanach »Psychotherapie bei Kindern« (1971) mit Beiträgen von Ruth Cycon, Rosemarie Berna-Glantz und Jacques Berna. In den von Biermann herausgegebenen fünf Bänden »Handbuch der Kinderpsychotherapie« (1973–1981) erschienen Arbeiten aller damaligen Schulrichtungen, zur ichpsychologischen Schule von Anna Freud, insbesondere ein Beitrag von Jacques Berna über die ichpsychologische Behandlungstechnik. Die Anfänge der Kinderanalyse werden bis ins Detail in dem von Bittner und Heller (1983) herausgegebenen Buch »Eine Kinderanalyse bei Anna Freud« mit allen Notizen und Materialien und mit Erinnerungen von Peter Heller nachgezeichnet. Heller, geprägt von seiner eigenen Psychoanalyse bei Anna Freud und liebevoll verbunden mit ihr, war 50 Jahre nach seiner Analyse dennoch der Meinung, dass Anna Freud und ihrem Kreis die Grundstimmung einer »altjüngferlichen Heiligkeit und Puritanismus« anhaftete (ebd., S. 297 f.).
Es war dann Melanie Klein, die der Kinderanalyse ihren klaren analytischen Rahmen gab. Sie deutete und bearbeitete negative Übertragungen beispielsweise als Ausdruck von Ambivalenz der Mutter gegenüber, ging davon aus, dass auch kleinste Kinder bereits eine Übertragungsneurose herstellen, da bei ihr Übertragung auf Projektion und Introjektion früher Teilaspekte beruhte, die es zu deuten gilt. Von Beginn an standen alle theoretischen Überlegungen von Melanie Klein konträr zu denen von Anna Freud. Melanie Klein wurde 1882 geboren, legte mit 17 Jahren die Reifeprüfung ab, entschied sich jedoch gegen ein Studium und heiratete bereits mit 21 Jahren. Nach der Geburt des zweiten Kindes verfiel sie in schwere Depressionen. Wegen ihres Mannes nach Budapest umgezogen, lernte sie dort Ferenczi kennen und machte bei ihm eine Analyse (eine zweite später bei Abraham). Während dieser Zeit wurde ihre große Begabung im Verstehen von Kindern deutlich und Melanie Klein begann mit ihrer ersten Analyse des fünfjährigen Kindes Fritz, der – wie wir inzwischen wissen – eigentlich ihr Sohn Erich war (Hamann 1993, S. 17). Die Behandlung führte sie – logischerweise – im Hause des Kindes mit dessen eigenen Spielsachen durch und Melanie Klein sah rückblickend diese Therapie als die Entstehung ihrer psychoanalytischen Spieltechnik an: »Das Kind drückte von Anfang an seine Fantasien und Ängste hauptsächlich im Spiel aus, während ich beständig deutete, mit dem Erfolg, dass neues Material im Spiele auftauchte« (Klein 1962, S. 153). Von Beginn an ersetzte also Melanie Klein eine Analyse von verbalen Äußerungen durch die Analyse des Spiels und deutete konsequent, denn sie war – in Widerspruch zu Anna Freud – unerschütterlich davon überzeugt, dass bereits Kleinkinder vollständige Übertragungen auf den Kinderanalytiker entwickeln und dass ihr Spiel in allen Einzelheiten als der symbolische Ausdruck unbewusster Konflikte angesehen werden kann (Stork 1976, S. 143). Das Spiel ist nach Melanie Klein eine Symbolisierung des psychischen Geschehens, also der unbewussten Fantasien des Kindes. Die unbewusste Fantasie ist für Klein psychischer Repräsentant oder Korrelat von Triebregungen. Und da Triebe bekanntlich von Geburt an wirksam sind, setzte sie auch ein primitives Fantasieleben von Geburt an voraus. Dies bedeutete gleichzeitig, dass von Anfang an erste Objektbeziehungen bestehen, was ebenfalls zu Meinungsverschiedenheiten führte, da das neugeborene Kind lange Zeit lediglich als »Reflexwesen« angesehen wurde (ebd., S. 144). Damit wird auch verständlich, warum Melanie Klein eine vollständig andere Definition und Vorstellung von Übertragung haben musste als Anna Freud und auch an Übertragungen von Beginn der Analyse an glaubte, zumal sie ödipale Strukturen weitaus früher vermutete als bis dahin angenommen. Die Übertragung ist bei Melanie Klein nicht mehr nur eine Repräsentanz des verdrängten Unbewussten, sondern stammt – wie bereits erwähnt – aus dem steten Wirken der unbewussten Fantasie, welche alle Triebregungen begleitet (Hamann 1993, S. 64). Diese Erkenntnis bestimmte ihr Vorgehen in der Analyse ganz entscheidend. Mit der konsequenten Deutung auch der Aggression und archaischer Fantasien legte sie zudem den Grundstein für die Behandlung psychotischer Kinder und so bedeutender Konzepte wie das des »Containings« von Bion ( Kap. 26).
Von 1923 an stellte Melanie Klein dem Kind in der Analyse ausgewählte Spielsachen zur Verfügung, die speziell für jedes Kind in einer Schachtel aufbewahrt wurden (hölzerne Frauen und Männer, Autos, Tiere, Bäume, Bleistifte, Buntstifte, Leim, Kugeln und Bälle etc.). Ihr Spielzimmer war nur mit dem Nötigsten ausgestattet, u. a. jedoch mit fließendem Wasser. Ob direkt über das Spiel oder indirekt, richtete Melanie Klein ihr Augenmerk primär auf die Ängste des Kindes und versuchte sie durch Deutung zu vermindern (Klein 1962). Alle nicht-analytischen nicht-deutenden Methoden, alle »Erziehungsmaßnahmen« wurden vermieden, es wurde keine Ermutigung, keine Versicherung oder Gratifikation gegeben, um die Übertragungen nicht zu beeinflussen.
Kritisch wird bei Melanie Klein oft angemerkt, ob sie nicht die Rolle der Fantasie zu stark betone und die Realität vernachlässige, ob sie nicht zu aktiv deute. Tatsächlich wirkt manche Deutung sehr intrusiv, was Hamann (1993, S. 84 ff.) aber einer großen Sensibilität im Umgang mit dem Material gegenüberstellt. Jacques Berna spricht sogar von »diktatorisch aufgezwungenen Deutungen« (1967, S. 329).
Während Anna Freud mehr Wert auf die Analyse der Ich-Strukturen und der Abwehr legte und im Bewussten arbeitete, suchte Melanie Klein sofort und schnell Kontakt zu den unbewussten Strukturen ihrer Patienten herzustellen (Hamann 1993, S. 78). Die Unterschiede zwischen den Techniken von Anna Freud und Melanie Klein sind eklatant, vor allem was den Umgang mit der Übertragung und den Stellenwert der kindlichen Sexualität angeht. Stephan hat in diesem Zusammenhang sehr zugespitzt formuliert: »Die Arbeiten von Melanie Klein stellten deshalb eine große Provokation für Anna Freud dar, weil in ihnen all das zur Sprache kam, was sie selbst auf ihrem mühsamen Weg zur väterlichen Psychoanalyse hinter sich gelassen hatte« (1992, S. 298).
Die kleinianischen Annahmen, vor allem die Bedeutung der Projektiven Identifizierung und der Symbolbildung, wurden von ihren Schülerinnen und Schülern fortgeführt und erweitert, insbesondere von Paula Heimann, Wilfred R. Bion und Hanna Segal ( Kap. VI.2). Die Gegenübertragung meinte ursprünglich bekanntlich die neurotische Reaktion des Analytikers auf die Übertragungsneurose seines Patienten, welche unbedingt vermieden werden sollte. Paula Heimann (1950, vgl. Thömä und Kächele 1985, S. 86 und 88) verstand – vor dem Hintergrund von projektiven Identifizierungen – unter der Gegenübertragung jedoch alle Gefühle, die der Analytiker seinem Patienten gegenüber erlebt, die dieser aushalten und nicht abreagieren sollte. Mit dieser Auffassung bekam die Gegenübertragung, auch in der Kinderanalyse, eine völlig neue Definition und Dimension.
Einen originären Beitrag zur Kinderanalyse hat Bick (1968) geliefert. Ihre These war, dass Persönlichkeitsanteile in ihrer primitivsten Form so empfunden werden, als müssten sie zusammengehalten werden, um die Katastrophe des Auseinanderfallens zu verhindern. Im frühkindlichen, unintegrierten Zustand kann ihrer Meinung nach ein bewahrendes Objekt ganz konkretistisch als Haut erfahren werden, als hielte es die Teile der Persönlichkeit zusammen.
Der heutige Stand der Psychoanalyse von Kindern und die technische Anwendung dieser theoretischen Neuerungen, insbesondere die Handhabung der Gegenübertragung, wird ausführlich von Harris, Bick, O’Shaughnessy und Eskalinen de Folch in den von Bott-Spillius (1990) herausgegeben zwei Bänden »Melanie Klein Heute« dargestellt. Wie die projektive Identifizierung und Gegenübertragung zur Psychodiagnostik von Jugendlichen in Erstinterviews genutzt werden kann, hat Salzberger-Wittenberg in einem Vortrag verdeutlicht, der 1994 veröffentlicht wurde. Ebenso erscheinen regelmäßig Arbeiten zur kleinianischen Kinderanalyse in der Zeitschrift »Kinderanalyse« sowie in der Zeitschrift »Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie«.
Donald W. Winnicott wurde 1896 geboren, studierte in Cambridge Medizin und arbeitete als Kinderarzt in einem Londoner Kinderkrankenhaus. 1923 begann er eine Lehranalyse bei James Strachey und arbeitete von da an als Kinderarzt und Analytiker. Winnicott hat viele Gedanken Melanie Kleins aufgenommen, der er dennoch zeitlebens kritisch gegenüberstand; sein Denken zeichnet sich vor allem durch Originalität, Unkonventionalität und Spontaneität aus (vgl. Stork, 1976, S. 152). Abgesehen von der Erfindung des sogenannten Schnörkelspiels, bei dem abwechselnd Kind und Analytiker einen Schnörkel beginnen und ausmalen, was die Fähigkeit zur Assoziation anregen soll, liegt Winnicotts (1973; 1984) Beitrag zur Technik der Kinderanalyse vor allem in seinem Konzept des »Haltens« ( Kap. 21). Das »Halten« erlaubt dem Kind, Schritt für Schritt sein Selbst zu entwickeln und unabhängig zu werden. Winnicott hat damit den Blick auf Störungen des Selbst und deren Behandlung gelenkt. Nicht allein die Deutung, sondern der Heilungsfaktor der Beziehung zum Analytiker, die Verinnerlichung der Objektbeziehungen und die Strukturierung des Selbst stehen bei ihm im Mittelpunkt. Sein Konzept kann vielleicht dahingehend missverstanden werden (und ist oft missverstanden worden), dass der Analytiker nur, so wie die hinreichend gute Mutter, genügend viel »Halten« müsse. Winnicott betont aber auch die Rolle der Versagungen und die Entwicklung von der Fantasie (Omnipotenz) zur Realität, so dass er, auch wenn der Rahmen oder das dritte Objekt in seinen Therapiekonzepten explizit keine Rolle spielen, die Realität und das dritte Objekt nicht verleugnet.
Khan (1977), einer seiner Schüler, meinte, dass Winnicott zu einer wesentlichen Erweiterung und Vertiefung des klassischen Begriffsrahmens der Psychoanalyse beigetragen und so viele neue Begriffe geschaffen habe, dennoch keine Schule begründete, weil vieles, was er über seine spezifische Behandlungstechnik berichtet, auf ihn selbst zugeschnitten und nicht übertragbar war. Die psychotherapeutische Behandlung eines gerade zweijährigen Mädchens, deren 14 Sitzungen sich über drei Jahre erstreckten, beschreibt und kommentiert Winnicott in seiner Falldarstellung »Piggle« (1980), in welcher Ähnlichkeiten mit der Klein‘schen Psychoanalyse, aber auch Unterschiede zu ihr deutlich werden.
Ein bedeutender Vertreter der Kinderanalyse im deutschen Raum war der 1911 in Zürich geborene Jacques Berna. Obwohl er später die ich-psychologische Behandlungstechnik von Anna Freud ausübte und lehrte, konnte er sich den Inhalt ihrer frühen Schriften zur Kinderanalyse nie aneignen (Hermann 1992). Auch Melanie Kleins Position konnte Berna nicht akzeptieren, weil ihm ihre frühe und tiefgehende Deutungsarbeit fremd blieb. Seine therapeutische Arbeit hat er in vielen Aufsätzen in der Psyche dargelegt, insbesondere jedoch in seinem 1973 erschienenen Buch »Kinder beim Analytiker«. Seine wichtigsten Arbeiten wurden noch einmal 1996 mit dem Titel »Liebe zu Kindern – Aus der Praxis eines Analytikers« neu aufgelegt, u. a. »Der Fall eines zwangsneurotischen Jugendlichen«.
Hans Zulliger, 1893 geboren, ehemals Volksschullehrer, wies in seiner Arbeit »Heilende Kräfte im kindlichen Spiel« (1975), die 1951 erschien, auf einen wichtigen Aspekt bei der Frage der Deutung im Kinderspiel hin. Das Spiel ist bei Zulliger die Sprache des Kindes, es ersetzt sie jedoch nicht einfach. Um Kinder verstehen zu können, müsse man sich einfühlen, affektiv mitgehen, sich mit den Kindern identifizieren können. Das Denken des Kindes ist noch magisch, was bedeutet, dass das Spiel kein Spiel, sondern Wirklichkeit sei. Zulliger fiel auf, dass Symptome oft verschwanden, noch ehe er sie gedeutet hatte. Zulliger verstand dies als Zeichen, dass bereits im Spiel dem Kind durch das Reagieren des Therapeuten, der mitspielte, Deutungen gegeben werden, die das Kind verarbeitet. Nicht das Spiel wird gedeutet, sondern im Spiel wird in der magischen Denkweise des Kindes eine Deutung gegeben. Die Kinderanalyse ist nach Zulliger immer in der Gefahr der Intellektualisierung, was nur den Widerstand fördert. Er forderte keine reine Spieltechnik, sondern ein flexibles Umgehen mit der Deutung, die unter Umständen auch eine Deutung im Spiel selbst sein kann, indem zum Beispiel der Kasperl dieses oder jenes sagt.
Zulliger ging davon aus, dass bei Jugendlichen weder die Kinder- noch die Erwachsenenanalyse angewandt werden könnte. So entwickelte er seine »Spaziergang-Behandlung« (1966), die er als »klassische Technik« bei Jugendlichen bezeichnete. Er gestand allerdings auch ein, dass es möglich wäre, dass ihm diese Art, Jugendliche auf Spaziergängen psychoanalytisch zu behandeln, besonders liegen würde, ein anderer jedoch weniger Erfolg bzw. »Glück« damit hätte.
Françoise Dolto, geboren 1908, die in Paris von 1938 bis zu ihrem Tod 1988 mit chronisch kranken, psychotischen und früh gestörten Kindern arbeitete (1989a,b), steht in der Tradition Lacans. Behandlungstechnisch geht es bei ihr um die Verbalisierung des Verworfenen, um die Annahme des Vaters, der als drittes Objekt die Dyade mit der Mutter öffnet, um die Annahme der Gesetze der Realität und der verschiedenen Stufen der Kastration, die Akzeptanz des Mangels und Entwicklung des Begehrens, was wir im Rahmen der Psychosetheorie ( Kap. 26) ausführlicher beschreiben. Die französische Schule, geprägt durch die Arbeit mit psychotischen und behinderten Menschen, betont die Funktion des Rahmens und die Bedeutung des dritten Objektes. Diese Funktion unterstützte Dolto, indem sie eine symbolische Bezahlung als Vertrag einführte. Das Kind bezahlt den Analytiker symbolisch mit kleinen Kieselsteinen, Briefmarken oder ähnlichen Gegenständen. So wird dem Kind verständlich, dass der Analytiker einen Beruf ausübt. Vergleichen wir dieses Konzept mit Anna Freuds Ausführungen zur Einleitung einer Analyse, wird deutlich, welch weiten Weg die Kinderanalyse im letzten Jahrhundert zurückgelegt hat. Die symbolische Bezahlung hat keinen Eingang in die Behandlungstechnik gefunden, sie war zu eng mit der Persönlichkeit Doltos verknüpft. Problematisch ist bei der symbolischen Bezahlung, ob die Kinder dieses Mitbringsel nicht als Geschenk begreifen; der Rahmen sollte bei Kindern stärker über die Haltung des Analytikers vermittelt werden anstelle einer letztendlich fragwürdigen Regelung von Bezahlung mit Kieselsteinen.
Der Buchtitel »Alles ist Sprache« (1989b) war gleichzeitig ein Grundsatz, der sich durch die gesamte psychoanalytische Arbeit mit Kindern zog. Dolto ging davon aus, dass die Psychoanalyse den Beweis erbracht habe, dass das Kind, wie klein es auch sei, das Verständnis des Sinns für Wörter habe, welche sein »Auf der Welt-sein« beträfen. Das Sprechen könne jeden Menschen befreien, wenn es ihm gelänge, dadurch jemanden, der ihm mit Aufmerksamkeit und ohne Werturteil zuhöre, sein Leiden auszudrücken (ebd., S. 168).
Der Einfluss der französischen Schule ist heute vor allem bei der Gruppe um Jochen Stork zu sehen, welche neben Klein und Bion vor allem französische Kinderanalytiker (Dolto, Diatkine, u. a.) mit einbezieht und deren Arbeiten in der von Stork herausgegebenen Zeitschrift »Kinderanalyse«, einem bedeutsamen Forum für die Anwendung der Psychoanalyse des Kindes- und Jugendalters, erscheinen. An dieser Stelle ist auch die Arbeitsgruppe um Hilde Kipp zu erwähnen, die maßgeblich an der Weiterentwicklung der französischen Theorien in der Kinderanalyse in Deutschland arbeitet und dies in der Zeitschrift »Arbeitshefte Kinderpsychoanalyse« dokumentiert.
Neidhardt (1988) hat dargestellt, dass der Wechsel vom Begriff des Psychagogen zu dem des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Mitte der 1970er Jahre nicht lediglich der Austausch eines Etiketts war, sondern dass die veränderte Berufsbezeichnung einem Fortschreiten der psychoanalytischen Technik Rechnung trug. An den von ihm beschriebenen Entwicklungsschritten wurde aber auch deutlich, dass die internationale Psychoanalyse und ihre Weiterentwicklungen erst in den 1960er und 1970er Jahren in Deutschland wieder an Einfluss gewannen. Neidhardt beschrieb in seiner Arbeit drei Meilensteine dieser Entwicklung: Ganz am Anfang, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, stand die Psychagogik, eine Synthese aus Pädagogik und Psychotherapie; die Ich-Psychologie gab den Anstoß zur Entwicklung der analytischen Kinderpsychotherapie, die sich schließlich zur heutigen Kinderanalyse auf der Grundlage von Übertragungsbeziehungen wandelte (Neidhardt 1988, S. 81 f.).
Konsequente – ausschließlich – selbstpsychologische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird eher selten durchgeführt, jedoch haben die Arbeiten von Kohut und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Deutschland die Ausübung der Kinderanalyse generell beeinflusst, insbesondere im Bereich der Diagnostik. Hilke (2000) hat in einem Beitrag die Perspektive der psychoanalytischen Selbstpsychologie für die Kinderpsychotherapie am Beispiel der Behandlung eines achteinhalbjährigen Jungen dargestellt. Die psychoanalytische Selbstpsychologie sieht als das oberste Ziel jeder Behandlung die Stärkung des Selbst und einen Zuwachs an Struktur. Darum stehen auch im Zentrum einer selbstpsychologischen Behandlung immer der Selbstzustand des Patienten und seine Selbstobjektbedürfnisse. Das Selbstobjekt ist der subjektive Aspekt einer Funktion, die durch eine Beziehung erfüllt wird. Jene Funktionen der Beziehung zu den Pflegepersonen, die im Säugling die Erfahrung seines Selbstseins wecken und aufrechterhalten, werden als Selbstobjektfunktionen definiert. Wesentlich in einer selbstpsychologisch orientierten Behandlung sind darum die Selbstobjektübertragungen, bei denen sich Selbstobjektbedürfnisse auf den Analytiker richten bzw. abgewehrt werden (z. B. Bedürfnis nach Spiegelung und Bedürfnis nach Idealisierung). Von großer Bedeutung ist dabei die Empathie, indem sich der Analytiker in den Patienten hineinversetzt und die Welt aus dessen innerer Perspektive wahrnimmt und interpretiert (ebd., S. 28). Weitere Darstellungen von Kinderbehandlungen aus Sicht der Selbstpsychologie finden sich u. a. bei Seiler (1998).
Der Umgang mit der Übertragung hat sich – auch in der Nicht-Kleinianischen Psychoanalyse – sehr verändert. Mit den Arbeiten von Gill (zit. n. Thomä und Kächele 1985) hat die Deutung der Beziehung im Hier und Jetzt (die lange Zeit vernachlässigt worden war) immer mehr an Einfluss gewonnen, auch in der Kinderanalyse. Die aktuelle Handhabung der Übertragung in der psychoanalytischen Arbeit mit Kindern hat Raue (2000) herausgearbeitet und betont, dass vor allem die Arbeit an den negativen Übertragungen und an den Widerständen von größter Bedeutung ist. Raue hebt auch hervor, dass im Aushalten der negativen Übertragung und späteren Verbalisierung ein wichtiger Beitrag zur Heilung geleistet wird, der viel zu wenig diskutiert wird. Den Stand des Übertragungsbegriffes der Anna-Freud-Schule referieren Fonagy und Sandler (1997). Sie betonen, dass es wichtig sei, dass der Analytiker in der Formulierung der Deutung auch zu verstehen gibt, dass das Kind um Impulskontrolle ringt. Solche Deutungen würden den inneren Konflikt des Kindes zwischen einem Wunsch und dem Versuch, ihn zu bändigen, betonen. Die Autoren unterstreichen, dass auch aktuelle Außenbeziehungen kommentiert werden könnten, zumeist sollten die Beziehungsmuster nach Meinung der Autoren jedoch im Rahmen der therapeutischen Beziehung (also im Hier und Jetzt) gedeutet werden.
Schäberle (1995) hat die Funktion der Sprache in der Kinderanalyse in vielfältiger Weise diskutiert und an eigenem Fallmaterial dokumentiert. Seiner Meinung nach bedeutet zur »Sprache-Bringen« immer auch einen Bruch der Illusion, ganz eingefühlt und befriedigt zu werden (siehe Mutismus). Hieraus erwächst, wie bei Dolto, die Möglichkeit, Wünsche im Spannungsverhältnis von Begehren und Leiden auszudrücken. Sprache hebt aber auch Omnipotenzfantasien auf und sie wirkt triangulierend, denn sie unterbricht den Mechanismus der projektiven Identifizierung.
Eine ausführliche Darstellung der unterschiedlichen Konzeptionen von Elternarbeit bei Anna Freud und Melanie Klein findet sich in einem Aufsatz von Windaus (1999). Der Autor erörtert zudem kritisch neuere Ansätze zur Elternarbeit und stellt seine Anwendung von szenischem Verstehen im »Hier und Jetzt« vor. Ahlheim und Eickmann (1999) beschreiben spezielle Wirkfaktoren in der Arbeit mit den Eltern, wobei sie als wesentliche Ziele die Stärkung der elterlichen Position und die Wiederherstellung der elterlichen Allianz sehen. Eine umfassende Arbeit mit den wesentlichen Behandlungszielen und einer Diskussion der aktuellen Literatur zur begleitenden tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie der Bezugspersonen hat Ahlheim verfasst (Hopf und Windaus 2007). Kurz erwähnt werden soll in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der Säuglingsbeobachtung (Lazar 2000) für die Ausbildung wie auch für die analytische Psychotherapie von Müttern mit Säuglingen und kleinen Kindern (Hirschmüller 2000; Eliacheff 1994), zur Neurosenprophylaxe und Bewältigung entstehender psychischer Störungen.