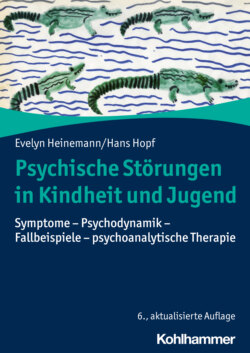Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.3 Der Beginn: Spiel, Rahmen, Abstinenz und Neutralität, Grundregel
ОглавлениеWie in der analytischen Psychotherapie Erwachsener ist die Erkenntnis von einem Unbewussten wichtigstes Essential und die entscheidende Leitlinie für das Verstehen seelischer Prozesse. Somit gibt es zwischen Erwachsenenanalyse und psychoanalytischer Behandlung von Kindern mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes (vgl. Stork 2001, S. 347). Die eingeschränkten Möglichkeiten von Kindern, ihre Träume zu berichten und vor allem zu deren Inhalten zu assoziieren, verlangten die Einführung eines Parameters, des Spiels. Es eröffnet einen intermediären Raum, um unbewusste Konflikte und Beziehungen darzustellen, die der Analytiker mit dem Patienten erleben und verstehen kann. Bereits an der Einrichtung des Praxiszimmers scheiden sich Geister und Theorien. Die psychoanalytischen Konzepte empfehlen hier sorgsame Überlegung und Zurückhaltung. Zum einen bleibt bei wenig Material die Arbeit an der Beziehung, die im Vordergrund steht, deutlich und überschaubar. Zum anderen wird die Kreativität eines Kindes sowie seine Tendenzen zu verbalisieren und zu symbolisieren durch weniger Spielmaterial eher gefördert. Es bleibt zudem wichtig, auch in der Kinderpsychoanalyse mit Träumen zu arbeiten; bei einer entsprechenden Haltung des Analytikers werden Kinder gern Träume erzählen und – in Grenzen – zu ihnen assoziieren (Hopf 2007a).
Damit sind wir bereits bei der Gestaltung eines Settings, was zu den nicht-analytischen Aktivitäten gehört. Es wird auch häufig als der Rahmen einer psychoanalytischen Behandlung bezeichnet. Zu den Bedingungen eines Rahmens gehören die regelmäßigen Sitzungen, die Frequenz, also alle zeitlichen und räumlichen Begrenzungen, die Schweigepflicht, die Finanzierung, die mögliche Einbeziehung von Bezugspersonen, das Ausfallshonorar, etc. Wir können das ganze wie einen Sandkasten betrachten, in dem ein Kind spielt und seine Konflikte agiert. Ohne dessen haltende Begrenzungen würde das Spielen des Kindes unübersichtlich und ungeordnet. Werden die Rahmenbedingungen nicht ausreichend beachtet, werden auch Affekte und Beziehungen undurchschaubar, und der Patient findet keinen ausreichenden Halt. Der Rahmen ist also eine unwandelbare Konstante und kann auch Trennung und Triangulierung repräsentieren. Gemeinsame Regeln und Rahmenbedingungen können auch zu professionellen Kennzeichen werden, so dass ausschließlich eine intensive Stundenfrequenz darüber entscheiden kann, ob eine Behandlung Analyse genannt werden darf (Holder 2002, S. 15; Thomä und Kächele 2006, S. 235). Allerdings kann eine Verabsolutierung von Regeln die Effektivität einer psychoanalytischen Behandlung genauso gefährden wie ein willkürliches Infragestellen von Rahmenbedingungen. Bei der Arbeit an den Rahmenbedingungen kommt es darauf an, diese nicht einfach als Voraussetzung, sondern ihre Etablierung als Gegenstand und Aufgabe von Beziehungsarbeit zu sehen (Berns 2002). Der Kinderanalytiker sollte immer langfristig aushaltbare Rahmenbedingungen aushandeln, damit die Beziehung überleben kann.
Es kann in diesem Abschnitt nicht um eine umfassende Darstellung aller behandlungstechnischen Prinzipien gehen, hierfür gibt es eine Vielzahl von Lehrbüchern (Thomä und Kächele 2006; Hopf und Windaus 2007; Seiffge-Krenke 2007; u. a.). Exemplarisch soll jedoch die Abstinenzregel diskutiert werden. Sie wird von Laplanche und Pontalis (1972/73, S. 22) so definiert, dass der Patient in einer psychoanalytischen Behandlung die geringstmögliche Ersatzbefriedigung für seine Symptome findet. Die Befriedigung seiner Wünsche muss ihm versagt werden, gleichzeitig sollten jedoch die Rollen übernommen werden, die der Patient dem Analytiker aufdrängt; über Abstinenz wird die Etablierung einer Übertragungsbeziehung gefördert. Es sollten also keine irgendwelchen Surrogate beschwichtigend eingesetzt werden. Somit bleibt ein immerwährendes Spannungspotenzial erhalten, welches den psychoanalytischen Prozess aufrecht erhält. Es sollte aber immer reflektiert werden, dass wir unsere Kinderpatienten auf der einen Seite anleiten, ihre Konflikte agierend im Spiel darzustellen. Auf der anderen Seite müssen wir ihr Agierenbegrenzen, damit daraus wieder Fantasien und Erinnerungen werden. Die Gefahr ist darum bei Kindern wesentlich größer als bei Jugendlichen und Erwachsenen, dass sich der Analytiker auf das szenische Geschehen einlässt, es aber zu wenig reflektiert, verbalisiert und deutend mit ihm umgeht.
Winnicott hat dem ersten Gespräch mit einem Kind eine besondere therapeutische Bedeutung beigemessen, weil es eine einmalige Gelegenheit darstellt, mit einem Kind zu kommunizieren, wie es später kaum mehr möglich sei. Gemäß Greenson (1973) bilden den zuverlässigen Kern eines Arbeitsbündnisses die Motivation des Patienten, seine Krankheit zu überwinden, sein Gefühl der Hilflosigkeit, seine bewusste und rationale Bereitwilligkeit mitzuarbeiten und seine Fähigkeit, den Anweisungen und Einsichten des Analytikers zu folgen (ebd., S. 204). Das wirkliche Bündnis bestehe aus dem vernünftigen Ich des Patienten und dem analysierenden Ich des Analytikers, was es so wahrscheinlich nicht gibt, aber immerhin eine Idealvorstellung repräsentiert. Der Therapeut muss die therapeutische Situation so gestalten, dass der Patient Derivate aus dem Unbewussten hervorbringen und ihm mitteilen kann (vgl. Berns 2000, S. 173). Dem erwachsenen Patienten wird gewöhnlich in den ersten Stunden die so genannte Grundregel mitgeteilt, von Thomä und Kächele (2006) wie folgt behutsam formuliert: »Bitte versuchen Sie alles mitzuteilen, was Sie denken und fühlen. Sie werden bemerken, dass dies nicht einfach ist, aber der Versuch lohnt sich« (ebd., S. 238). Älteren Jugendlichen kann das in ähnlicher Weise gesagt werden. Wenn wir einem Kind zum ersten Mal begegnen, sind wir nicht mehr unbefangen, denn in der Regel haben wir bereits mit den Eltern gesprochen, zumeist auch über Absprachen und Rahmenbedingungen. Aber betrachten wir die aktuelle Situation eines Kindes, das zum Erstkontakt kommt: Das Kind steht in der Regel einem wildfremden Menschen gegenüber, weiß nicht, was es tun soll und was von ihm erwartet wird. Das wird zwangsläufig große Ängste hervorrufen, die nur gemildert werden können, indem einem Kind die fremde Situation erklärt wird. Anna Freud hat gemeint, dass kleinere Kinder weniger über die Behandlungsmethode erfahren wollen, sondern darüber, dass sie Hilfe bekommen. So wurde also einem Jungen von viereinhalb Jahren gesagt, er werde hierher gebracht, damit er und seine Mutter nicht mehr so viel Streit miteinander hätten (Sandler, Kennedy und Tyson 1982, S. 188). Dieser antwortete, er streite gern mit seiner Mami! Hier begegnen wir einem Problem. Der Leidensdruck, der in der Regel auf Eltern lastet, muss keineswegs auch bei einem Kind vorhanden sein. Und Behandlungsziele, welche Eltern anstreben, müssen keineswegs die sein, welche ein Kind erreichen will. Eine andere gängige Variante ist es, einem Kind zu sagen: »Wir werden uns jetzt ein- oder zweimal die Woche sehen und du kannst hier spielen und tun, was du willst.« Ich empfehle Ihnen nicht, so etwas beispielsweise einem Kind mit so genannter ADHS und entsprechenden Symbolisierungsstörungen zu sagen. Es wird vielleicht Ihre gut gemeinte Aufforderung unsymbolisiert-konkretistisch umsetzen und Ihr Praxiszimmer in eine Müllhalde verwandeln. Diese Aufforderung missachtet, dass es – wie bereits diskutiert – einen Rahmen, Regeln, Absprachen, eine Realität gibt. Das Kind soll begreifen, wie seine Mitarbeit in dem künftigen analytischen Prozess aussieht, und das können erfahrungsgemäß auch schon kleine Kinder erfassen. Es existiert eine Fülle von Literatur über die erste Stunde, eine Arbeit stammt von Berna-Glantz (1972). Darin sagt sie zu ihrer elfjährigen Patientin folgendes: »Die Eltern möchten, dass ich Euch helfe. Ich tue das gern. Die Hilfe sieht so aus, dass ich Dir – und den Eltern – helfe, das, was schwierig ist, besser zu verstehen. Dazu ist es am besten, wenn Du mir möglichst viel erzählst, was Dir gerade in den Sinn kommt. Für uns ist alles interessant« (ebd., S. 58). Es fällt auf, dass Berna-Glantz sich mit ihrer Formulierung stark an der Grundregel für Erwachsene orientiert, Träume und Spielen bleiben unerwähnt. Wir sind der Überzeugung, dass immer wieder aufs Neue erspürt werden muss, was oder wie etwas einem bestimmten Kind erklärt werden soll. Wir folgen hier Anna Freud, die festgestellt hat, dass es keine Formel dafür gibt, wie man ein Kind in die Behandlung einführen soll: »Tatsächlich könnte ein standardisiertes Schema für die Durchführung von Anfangssitzungen ohne Rücksicht auf die Natur der Störung des Kindes oder den Grad seines Bewusstseins davon nur die optimale Entwicklung der analytischen Arbeit beeinträchtigen« (Sandler, Kennedy und Tyson 1972, S. 188). Indem wir von Anfang an mit dem Kind analytisch arbeiten, die Szenen verstehen und deutend mit ihnen umgehen, können wir auch sukzessive das Arbeitsbündnis vermitteln und herstellen.