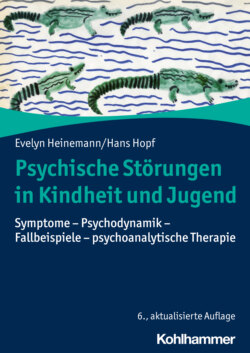Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 Bindungstheorie und Bindungstherapie
ОглавлениеDie Bindungstheorie ist eine auf äußerer Beobachtung beruhende empirisch fundierte entwicklungspsychologische Theorie über die emotionale Entwicklung. Sie wurde vom englischen Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby in den 1950er Jahren begründet. Die Theorie wurde in den drei Büchern Bindung, Trennung und Verlust (Bowlby 1975; 1976; 1983) dargelegt. Die Forschungsgruppe um John Bowlby mit Anna Freud, Mary Ainsworth und James Robertson wurde nach dem Krieg gegründet und konzentrierte sich auf die Bedeutung von Trennungssituationen, speziell auch der Kriegswaisen (Brisch 1999, S. 30; Brisch 2002).
Aus Sicht der Bindungstheorie entwickelt der Säugling auf der Grundlage eines biologisch angelegten Verhaltenssystems im ersten Lebensjahr eine starke emotionale Bindung zu seiner Hauptbezugsperson. Der Säugling wird geschützt und ihm wird Bindungssicherheit vermittelt. Bindung ist Teil eines komplexen Systems der Beziehung. Das Bindungssystem ist ein primär genetisch verankertes motivationales System, das nach der Geburt aktiviert wird und überlebenssichernde Funktion hat. Der Säugling sucht die Nähe zur Mutter, wenn er Angst erlebt. Er sucht Sicherheit, Schutz und Geborgenheit durch Blickkontakt oder physischen Kontakt (Brisch 1999, S. 35). Eine sichere Bindung stellt die emotionale Basis während des gesamten Lebens bis ins Alter hinein dar. Es bilden sich innere Arbeitsmodelle und die mit ihnen verbundenen Affekte, was als Bindungsrepräsentanz bezeichnet wird. Die Bindungsrepräsentanz kann im Laufe des Lebens durch einschneidende Erlebnisse verändert werden, und zwar in beide Richtungen. Dem Bindungsbedürfnis steht das Explorationsbedürfnis gegenüber. Die Mutter dient dabei als sicherer Hafen, von dem aus das Kind die Umwelt exploriert. Bindungssicherheit ermöglicht Neugierverhalten. Wenn die Mutter oder eine primäre Bezugsperson das Kind zu sehr bindet, wird das Explorationsbedürfnis nicht gewährt und frustriert (ebd., S. 38).
Die Wahrnehmung der Bedürfnisse des Säuglings und die richtige Interpretation seiner Wünsche und Bedürfnisse gewährleistet nach Mary Ainsworth die Feinfühligkeit der Mutter. Feinfühliges Verhalten der Bezugspersonen besteht darin, dass diese die Signale des Kindes wahrnehmen und richtig interpretieren und sie angemessen und prompt befriedigen. Der Säugling entwickelt eine sichere Bindung, wenn seine Bedürfnisse feinfühlig befriedigt werden, eine unsichere Bindung, wenn die Bedürfnisse nicht, unzureichend oder inkonsistent beantwortet werden (ebd., S. 36). Empathische Verbalisation der Bezugspersonen unterstützt die sichere Bindung (Brisch 2002, S. 50).
Das Pflegeverhalten der Bindungsperson wird über die eigenen Bindungserfahrungen wachgerufen. Über die Bindungserfahrung erlangt der Säugling ein beobachtbares Bindungsverhalten, das in der Bindungstheorie in verschiedene Bindungsqualitäten unterteilt wird. Im sogenannten Ainsworth-Fremde-Situations-Test aus dem Jahr 1969 (Brisch 1999, S. 33) wird eine Trennungssituation von der Bezugsperson und das Verhalten nach der Rückkehr in standardisierten Situationen beobachtet. Eine sichere Bindung wird diagnostiziert, wenn die Bezugsperson als sichere Basis erlebt wird, die Schutz, Geborgenheit und Trost bietet. Bei der unsicher-vermeidenden Bindungsqualität reagiert die Bezugsperson eher mit Zurückweisung auf die Bedürfnisse des Kindes. Der Säugling reagiert auf die Zurückweisung scheinbar emotionslos, nicht mit Trennungsprotest. Die Kinder begrüßen die Mutter nicht bei Rückkehr, ignorieren sie eher oder laufen weg. Reagiert die Bezugsperson manchmal zuverlässig und feinfühlig, dann wieder mit Zurückweisung und Ablehnung, entsteht die unsicher-ambivalente Bindungsqualität. Die Reaktionen des Säuglings sind lautstarkes Weinen und intensives Anklammern an die Bindungsperson. Diese Säuglinge zeigen die deutlichsten Trennungsproteste. Sie sind nach der Rückkehr kaum zu beruhigen. Beim desorganisierten/desorientierten Bindungsverhalten zeigen die Kinder widersprüchliches Verhalten (Brisch 2002).
Die Klassifikation der kindlichen Bindungsqualität in sicher gebundene Kinder, unsicher-vermeidend gebundene Kinder, unsicher-ambivalent gebundene Kinder und Kinder mit desorganisiertem Verhaltensmuster beruht auf standardisierten Beobachtungen und macht die Theorie auch außerhalb der psychoanalytisch orientierten Entwicklungstheorie akzeptabel (vgl. Fonagy 2009).
Das Konzept der Feinfühligkeit der Mutter ist aus psychoanalytischer Sicht problematisch, da die Gefahr der »Schuldzuweisung« an die Mütter besteht. Eine Kritik am Konzept der Feinfühligkeit wird durch die Studie von de Wolff und Ijzendoorn (1997, zit. nach Brisch 1999, S. 49) auch aus bindungstheoretischer Sicht reflektiert. Die Studie führt nur 12 % der Varianz der kindlichen Bindungsmuster auf mütterliche Feinfühligkeit zurück. So wird aus Sicht der Bindungstheorie die Suche nach äußeren Traumatisierungen bedeutsam, da eine Konzentration auf eine, wenn auch erworbene, defizitäre Haltung der Mütter, bzw. Bezugspersonen zu problematischen pädagogischen und therapeutischen Haltungen führen kann.
Die Bindungstheorie spricht heute von sogenannten Schutz- und Risikofaktoren, die zu Bindungsstörungen führen können: Das Risiko einer Frühgeburt kann unsicher gebundene Kinder hervorrufen, besonders bei extrem kleinen Frühgeborenen (Brisch 1999, S. 75). Desorganisierte Bindung wird häufiger bei misshandelten Kindern beobachtet. Wenn Eltern unter Depressionen oder Schizophrenie leiden, besteht ein Trend für unsicher gebundene Kinder. Unsichere Bindung wird häufiger bei Borderline-Persönlichkeitsstörung, Agoraphobie, sexuellem Missbrauch, suizidalem Agieren in der Adoleszenz, Depression, psychiatrischen Erkrankungen und verschiedenen psychosomatischen Erkrankungen diagnostiziert (ebd., S. 76). Im Säuglingsalter werden Ess-, Schrei- und Schlafstörungen sowie Wachstumsretardierungen mit der mütterlichen Ambivalenz in Verbindung gebracht (ebd., S. 90).
Desorganisiertes Bindungsverhalten wird bei Kindern mit ADHS (Brisch 2002, S. 48) diskutiert, aber auch bei Autismus (Bergmann 2009). Kinder mit Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch zeigen zu 80 % desorganisierte Verhaltensweisen, bei psychosozial unbelasteten Eltern zeigen dagegen nur 15 % desorganisiertes Bindungsmuster. Mütter, die selbst schwerwiegende Traumata wie Missbrauch und Misshandlung erlitten haben, zeigen häufiger desorganisiertes Bindungsverhalten.
Armut und Gewalt als Belastungen können feindseliges und hilfloses elterliches Verhalten bewirken und damit ein unsicher-desorganisiertes Bindungsmuster bei Kindern (Brisch 2002, S. 51). Klinische Erfahrungen zeigen, dass Kinder mit Bindungsstörungen gehäuft traumatische Erfahrungen gemacht haben und desorganisierte Verhaltensweisen zeigen. Desorganisiertes Bindungsverhalten führt oft zu sozialen Interaktionsstörungen und emotionalen Ablehnungsreaktionen. Längsschnittstudien in Deutschland, in den USA und in England zeigen, dass sicher gebundene Mütter mit etwa 70 % Übereinstimmung auch sicher gebundene Kinder haben. Zwischen der Bindungshaltung der Väter und den Kindern besteht nur 65 % Übereinstimmung (ebd., S. 55). Eine sichere Bindung erhöht die psychische Vulnerabilitätsschwelle (Brisch 1999, S. 77). Eine ausführliche Diskussion über Bindungsverhalten in den verschiedenen psychischen Störungen findet sich bei Strauß (2008).