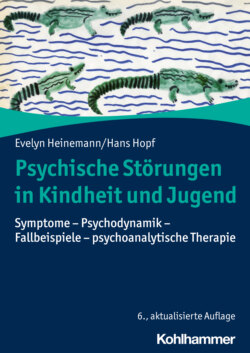Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Regressionsecke:
ОглавлениеPsychoanalytische Pädagogik arbeitet im Widerspruch von Regression und Progression. Die Regression im Dienste des Ich ist eine vorübergehend nötige Wiederbelebung früherer Erlebnisweisen, die in der Übertragung und aufgrund der größeren Reife des Ich durchgearbeitet werden können. Pädagogik dagegen ist an Progression, an Lernen und Ichreifung orientiert. Dieser Widerspruch ist aber nur scheinbar ein Widerspruch. Regression ist gerade dann heilsam, wenn sie im Rahmen von Progression stattfindet, der Patient immer wieder auch zur Progression angeregt wird, was im analytischen Setting in der Regel das pünktliche Stundenende leistet. Einer meiner Patienten mit psychosenahen Ängsten meinte lange Zeit, dass das Schönste an der Analyse der pünktliche Stundenbeginn und das pünktliche Stundenende sei. Auch das analytische Setting hat einen Rahmen, der an Progression, Realität und Sekundärprozess orientiert ist. Dies erklärt vielleicht meine Erfahrung, dass ich gerade im Unterricht der Sonderschule, in der ich als Klassenlehrerin Klassen von 7–15 Schülern über einige Jahre hinweg unterrichtete, besonders gute Rahmenbedingungen für eine psychoanalytische Pädagogik vorfand. Als Supervisorin in außerschulischen sozial- oder sonderpädagogischen Einrichtungen erlebe ich immer wieder, dass sich Pädagogen schwer tun, einen klaren Rahmen einzuhalten. Es wird oft den Wünschen der Heimbewohner nach einem familiären Rahmen nachgegeben, Pädagogen und Heimbewohner duzen sich und die Grenzen sind oft unklar. In meinem Unterricht erlebte ich, symbolisiert im Klingelzeichen, dagegen klare Grenzen, fast so wie im analytischen Setting, wenn ich das Stundenende pünktlich auf die Minute ankündige. Die Abstinenzregel ist in der Schule leichter einzuhalten. Ich habe allerdings auch an anderer Stelle (1992) auf die institutionalisierten Abwehrprozesse in der Schule als Institution hingewiesen, die wie die direkten Interaktionen mit den Schülern reflektiert werden müssen. Die Institution kann ansonsten genau die Schwierigkeiten der Schüler verstärken, die sie zu beheben angetreten ist.
Eine Möglichkeit, die Spannung zwischen Regression und Progression zu handhaben, ist die Regressionsecke im Klassenraum. Eigentlich hatte mich der Schüler Florian auf diese Idee gebracht. Nach den Pfingstferien weigerte sich Florian zum Lesekurs zu gehen. Er schrie: »Ich gehe nicht zu der Hexe, ich will hier bleiben.« Bellend rannte er wieder durchs Klassenzimmer. Er war nicht zum Gehen zu bewegen, so dass wir beschlossen, ihn in der Klasse zu belassen. Die Trennungsängste waren durch die Ferien erneut zu stark. Die beiden nächsten Male benahm er sich im Lesekurs derart undiszipliniert, dass er dort nicht mehr hingehen durfte. Als die Lehrerin ihm dies sagte, nahm er seinen Tisch, wir hatten im Unterricht Einzeltische, die nach Belieben zusammengestellt werden konnten, und setzte sich mit dem Tisch in die äußerste Ecke des Klassenzimmers. Völlig aufgelöst nahm er einen Katalog und blätterte darin herum. Ich sprach seine Trennungsängste an, unterrichtete dann aber weiter. Er war so verstört, dass er am Unterricht nicht teilnehmen konnte. Er regredierte in seiner Ecke und fühlte sich gleichzeitig durch die Anwesenheit der Gruppe geborgen. Nach einiger Zeit meldete er sich und ich ging zu ihm. Er gab mir die Hand mit den Worten: »Entschuldigung, Frau Heinemann, ich bin jetzt wieder brav.« Erleichtert nahm er seinen Tisch, rückte ihn an die alte Stelle und arbeitete wieder mit.
Diese Erfahrung beeindruckte mich so, dass ich die Schüler fragte, was sie davon halten, in die Ecke des Klassenzimmers einen Tisch mit einigen Spielen zu stellen. Wenn sich jemand nicht wohl fühle, so wie eben Florian, und auch nicht darüber reden möchte, könne er sich dorthin setzen und spielen, bis es ihm besser gehe. Wir könnten dann im Unterricht fortschreiten. Ich zweifelte zwar an der Durchführbarkeit, in der Fantasie sah ich die ganze Klasse nur noch in der Spielecke sitzen, wollte es aber wagen. Die Schüler waren natürlich sofort begeistert. Ich sagte mir, dass ich es ja jederzeit rückgängig machen könnte, wenn es nicht klappt. In all den Jahren meiner Arbeit wurde die Regressionsecke nie ausgenutzt. Am Anfang gab es zwar hin und wieder Missfallensäußerungen, wenn ein Schüler – meist war es Florian – spielte und die anderen arbeiteten, sie konnten aber damit umgehen. Ab und zu spielte ich auch im regulären Unterricht mit den Schülern.
Ein Beispiel zur Regressionsecke: Robin war ein 10-jähriger Schüler, der sich völlig weigerte, etwas im Unterricht zu schreiben. Er begann, zwei oder drei Worte zu schreiben, warf dann sofort unter heftigen Protesten wie: er könne das nicht, er mache das nicht oder ein Scheiß-Arbeitsblatt sei das, das Blatt von sich. Er trotzte bei der kleinsten Kleinigkeit und tat immer das Gegenteil von dem, was man von ihm verlangte. Er entwertete mich ständig: »Sie taugen nichts, Frau Heinemann!« oder ähnliches bekam ich zu hören. Ich versuchte, seine Problematik zu deuten, dass er wütend auf mich sei, weil er das Gefühl habe, ich gebe ihm nichts Gutes, nicht das, was er sich wünsche. Ich verstand die extreme narzisstische Abwertung meiner Person als Versuch, ein solches Trauma in der Wendung von der Passivität in die Aktivität zu bewältigen. Nach etwa vier Monaten Unterricht in der Klasse wollte ich ein Diktat schreiben und Robin weigerte sich, wie immer, mitzuschreiben. Er äußerte diesmal den Wunsch, sich in die Spielecke setzen zu dürfen, was ich ihm gestattete. Er nahm sich das Memory. Ich legte bei der Heftausgabe sein Heft neben ihn. Er warf es das erste Mal nicht weg. Als ich anfing zu diktieren, schrieb ich ihm Datum und Überschrift ins Heft und sagte: »Jetzt ist es nicht mehr viel.« Er schrieb das erste Mal mit. Seine Schwierigkeiten besserten sich in der nächsten Zeit erheblich. Robin arbeitete nun einigermaßen gut im Unterricht mit, er wirkte recht gefestigt, aber jetzt saß er an manchen Vormittagen mit einem aufgespannten, schwarzen Regenschirm in der Klasse. Den Schirm verwahrte er immer unter seinem Tisch. An einem Morgen bemerkte ich, dass er seinen Schirm genau in dem Moment aufspannte, als ich mit ihm schimpfen wollte. Ich sagte wohlwollend: »Du willst Dich wohl mit dem Schirm vor dem Donnerwetter schützen, das Du aus meinem Mund erwartest!« Robin lachte und spannte tatsächlich seinen Regenschirm im Unterricht nicht mehr auf. Es verblüffte mich im Unterricht immer wieder, wie solche kleine Deutungen Symptome zum Verschwinden bringen können. Robin hatte mit den Entwertungstendenzen einen Schutzmechanismus verloren, den er mit seinem Schirm ersetzte. Indem er nicht mehr mit dem kränkenden Aggressor identifiziert war, konnte er in der Interaktion mit mir neue Erfahrungen machen und seine Selbst- und Objektrepräsentanzen änderten sich. Die Regressionsecke gab ihm die Autonomie, die er sonst im analen Kampf nur in der Verweigerung und Abwertung fand.
Wenn Humor wie bei Kohut (1973, S. 364 ff.) die Bewältigung narzisstischer Erlebensweisen darstellt, so kann dieser auch im Klassenzimmer ein wichtiger Bestandteil des Umgangs mit den Kindern werden. Robin lief eines morgens im Klassenzimmer herum, warf mit Papierfliegern und wollte nicht mitarbeiten. Ich fragte ihn, was denn heute Morgen los sei. Er lachte spitzbübig und sagte: »Ach, Frau Heinemann, ich hab die Tollwut!« Ernst antwortete ich: »Das ist ja furchtbar. Da muss ich Dich gleich ins Arztzimmer bringen. Am besten nimmst Du Dein Lesebuch gleich mit.« Er lachte, setzte sich auf seinen Platz und sagte: »Ich glaub, der Anfall ist vorbei.« Er arbeitete wieder mit.