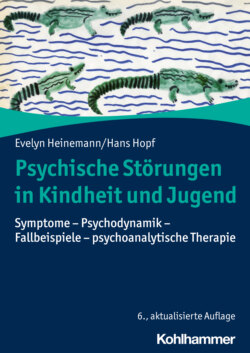Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.5 Übertragung – Gegenübertragung – Deutung – Arbeit mit den Eltern – Beendigung
ОглавлениеBekanntlich haben Anna Freud und Melanie Klein hinsichtlich der Übertragung von Kindern unterschiedliche Haltungen eingenommen. Beide gingen davon aus, dass bei Kindern eine spontane Übertragungsbereitschaft besteht und positive und negative Übertragungen möglich sind. Nach Melanie Kleins Beobachtungen bildet sich allerdings beim Kind eine Übertragungsneurose, die der des Erwachsenen völlig analog ist. Anna Freud ging dagegen davon aus, dass Kinder eine ständige, durch Abhängigkeit gekennzeichnete Beziehung zu ihren Eltern in der Gegenwart haben, was die Ausbildung einer Übertragungsneurose wie beim Erwachsenen erschwert (Sandler, Kennedy und Tyson 1982, S. 103). Dadurch erfährt der Analytiker eine geringere Bedeutung als die Eltern. Sie unterscheidet darum zwischen einer Übertragung von üblichen Beziehungsweisen, Übertragung gegenwärtiger Beziehungen und schließlich einer Übertragung früherer Erlebnisse, was der eigentlichen Definition von Übertragung entspricht. Damit bestätigt Anna Freud, dass es während einer Kinderpsychoanalyse durchaus auch Phasen gibt, in welcher sich wiedererweckte Wünsche, Erinnerungen, Fantasien auf den Behandler richten können (Sandler, Kennedy und Tyson 1982, S. 112).
Die Gegenübertragung war einst stringent als eine unbewusste Reaktion auf unbewusste Übertragungen des Patienten gesehen worden und war darum eine lästige Störquelle im psychoanalytischen Prozess (siehe auch Abschnitt vorher). Die pathologischen Anteile des künftigen Analytikers, seine blinden Flecken, mussten also in einer Lehranalyse behoben werden. Heimann hat die Gegenübertragung in das wichtigste Arbeitsmittel des Psychoanalytikers verwandelt, indem sie unter ihr alle Gefühle verstand, die der Analytiker seinem Patienten gegenüber erlebt. Die Annahme, dass die Gegenübertragung das A und O einer analytischen Beziehung und die Schöpfung des Patienten ist, brachte entscheidende Veränderung auch in der analytischen Kinderpsychotherapie mit sich. Eine ausführliche kritische Würdigung und Wege, aber auch ihrer »Entmystifizierung« finden sich bei Thomä und Kächele (2006). Auf unbewusst bleibende spezifische Gegenübertragungsreaktionen bei Kindern, die den analytischen Prozess stören können, weist Windaus hin (2007a, S. 236), wie etwa Rivalität um das Kind mit den Eltern, einseitige Loyalitätsverteilungen zwischen Kind und Eltern, therapeutische Größenfantasien etc. Es muss also auch weiterhin sorgfältig differenziert werden, ob es sich bei der Gegenübertragung um neurotische Anteile des Analytikers handelt oder um nicht neurotische Anteile als Resonanz auf die Übertragungen des Patienten. An dieser Stelle wird die große Bedeutung von Supervision erkennbar.
Ich gehe mit Stork (2001) davon aus, dass Deutung und Deutungsarbeit das wesentliche Spezifikum und Charakteristikum der Psychoanalyse darstellen. Laplanche und Pontalis (1972/73, S. 117) definieren Deutung als eine »Aufdeckung der latenten Bedeutung der Worte und Verhaltensweisen eines Subjekts durch die analytische Untersuchung«. Deutung ist also eine Bewusstmachung von unbewussten psychischen Inhalten mittels Verbalisierung und in der Fortführung das Bestreben, einem unbewussten Geschehen, das bewusst geworden ist, »Bedeutung, Verständnis und Sinn zu geben« (Stork 2001, S. 352). Hinsichtlich der Deutungsziele gibt es geringe Unterschiede zwischen Erwachsenen- und Kinderanalyse, es ist allerdings darauf zu achten, dass die Formulierung einer Deutung kognitiv und emotional auf den Entwicklungsstand eines Kindes Rücksicht nimmt (Windaus 2007a, S. 241). Deutung dient bei Kindern nicht nur der Bewusstmachung von Unbewusstem, sondern auch der Entwicklungsförderung.
Die Deutungsarbeit ist entscheidend von der schulischen Zugehörigkeit geprägt. Gemeinsam ist allen Psychoanalytikern, dass Deutungen in das Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehen im Hier und Jetzt eingebettet sein sollten. Berns (2000) unterscheidet die psychoanalytischen Schulen »deutungstechnisch« an Hand zweier Merkmale: Das eine Merkmal ist die jeweilige Konzeption des Primärprozesses als Bildner der Derivate des Unbewussten, so wie es heutige freudianische Psychoanalytiker verstehen. Anhänger der kleinianischen Schule begreifen unbewusste Fantasien als primäre Triebabkömmlinge und nutzen deutungstechnisch sämtliche Mitteilungen des Patienten konsequent als Derivate des Unbewussten, aus einer innerseelischen Objektbeziehungsperspektive heraus, die genetisch konzipiert ist (ebd., S. 133 f.). Darauf werde ich kurz im Zusammenhang mit der Diskussion des Containments zurückkehren.
Jede Deutung kann auch eine narzisstische Kränkung sein, selbst wenn sie dem Patienten langfristig psychische Erleichterung verschafft. Die Bewusstmachung unbewusster Inhalte ist immer ein schmerzhaftes Ereignis. Kinder machen das oft sehr deutlich, wenn sie sich die Ohren zu halten oder den Analytiker zum Schweigen bringen wollen, weil ihnen seine Worte weh tun. Darum sollten Deutungen immer in »nicht-deutende« Aktivitäten eingebettet sein; dies sind gemäß Stork »Ermutigungen, Beruhigungen, Rückversicherungen, allgemeine Erklärungen, Aufforderungen, Konfrontationen, Suggestionen, Ratschläge, die Vermittlung von Sicherheit, das Setzen von Grenzen und vieles mehr« (2001, S. 354), was natürlich andererseits eine konsequente aufdeckende Arbeit nicht verhindern darf. Der deutenden Funktion steht somit eine haltende (holding function) gegenüber. Winnicott (1984, S. 317) versteht unter dem Halten eines Patienten, dass der Analytiker dem Patienten im richtigen Moment etwas mitteilt, das zeigt, dass der Analytiker die tiefe Angst, die erlebt wird oder deren Erleben erwartet wird, kennt und erlebt. Will (2006) formulierte dies so, dass eine abstinente Zurückhaltung gleichzeitig eine »warmherzige, offene und entwicklungsfördernde Atmosphäre« braucht (ebd., S. 37). Dolto hat zudem gemeint, dass Deutungen am besten als Frage formuliert werden sollten, dann bleibt die Deutungskompetenz beim Patienten (Dolto 1989a, S. 74).
Es ist hier nicht der Raum auf die Problematik von Deutungen einzugehen, ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Arbeiten von Berns, Stork, Windaus und andere. Deutungsversuche sind immer von vielerlei Gefahren begleitet. Kurts (2001) hat in einer Arbeit auf eine zentrale Gefährdung hingewiesen: Die unbewussten Repräsentanzen und Wünsche, die in den Spielen und Zeichnungen von Kindern erkannt werden, können sehr faszinieren. Dies kann leicht dazu verleiten, Deutungen über unbewusste Fantasien zu geben, als ob es sich bei ihnen um denkfähige Fantasien handelte. Dabei werden die Abwehrbedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt – in einer solchen Situation kann der Analytiker für das Kind invasiv und verfolgend werden.
Kinder sind von ihren Eltern noch in vielen Bereichen – auch – real abhängig. Wird eine Kinderpsychotherapie geplant, so ist die künftige Zusammenarbeit mit den Eltern ausschlaggebend. Ein Kind kann weder die Notwendigkeit einer Behandlung erkennen, noch kann es die erforderlichen äußeren Bedingungen erfüllen. Das Behandlungsbündnis mit den Eltern entscheidet maßgeblich über einen ungestörten und prognostisch günstigen Verlauf einer Therapie. Darum ist die Mitarbeit der Eltern eine wesentliche Rahmenbedingung, deren Klärung von Beginn an von zentraler Wichtigkeit ist, beispielsweise, wie beide Eltern zur künftigen Therapie stehen und mitarbeiten wollen. Alle erforderlichen Rahmenbedingungen werden mit Eltern und Patienten erarbeitet, der Therapeut darf sie sich jedoch nicht aus den Händen nehmen lassen, denn sie sind sein Werkzeug, und er allein trägt die Verantwortung für den Verlauf und Erfolg einer Therapie. Details wie Frequenz, Dauer, Ferienplanung, Stundenausfall etc. müssen immer vorrangig von psychodynamischen Notwendigkeiten geleitet werden, nicht von realen Wünschen oder Rationalisierungen der Eltern oder des Patienten. Gelegentlich kann eine sorgfältige Klärung sogar dazu führen, dass eine Therapie nicht zustande kommt; diese würde jedoch auch bald scheitern, würden die Eltern die Bedingungen vorgeben. Stehen keine Eltern zur Verfügung, so müssen professionelle Helfer die Einhaltung des Settings gewährleisten.
Die elterliche Konfliktdynamik ist immer maßgeblich mit den neurotischen Konflikten eines Kindes verknüpft. Bereits in den ersten Lebensmonaten kann es zu Entgleisungen des präverbalen Affektaustausches kommen, zum Versagen des Containments. In jeder Entwicklungsphase können nicht bewältigte Konflikte bei den Eltern wiederbelebt werden und ihre eigenen Neurosen wirksam werden lassen. Die Umstellungsfähigkeit und Bereitschaft der Eltern, sich in psychodynamische Prozesse zu begeben und diese zu verstehen, ist ein wesentlicher Aspekt für die Prognose einer geplanten Behandlung. Sie wird auch davon abhängig sein, wie chronifiziert eine pathogene Familiendynamik bereits ist und ob Veränderungen möglich sind. Zentrale Behandlungsziele sind die Auflösung von Projektionen oder Delegationen und damit jener pathologischen intrapsychischen Bereiche der Eltern, die eine gesunde Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hemmen oder verhindern. Dabei soll der Vater immer als Dritter einbezogen werden, damit ein Kind unerlässliche Dreieckssituationen internalisieren kann. Dem ist bereits innerhalb der Psychotherapie-Richtlinien Rechnung getragen, dass immer beide Eltern eine Therapie beantragen müssen und dies durch ihre Unterschriften dokumentieren.
Es ist immer im Auge zu behalten, dass es nicht um eine grundlegende Aufarbeitung der elterlichen intrapsychischen Konflikte, auch nicht der Paarkonflikte gehen kann, so verführerisch sich das gelegentlich anbieten mag. Ein bedeutsames Teilziel kann es aber sein, Eltern für eine eigene Therapie oder Paartherapie zu motivieren und vorzubereiten. Im Fokus der Gespräche mit den Eltern steht immer ihre Beziehung zum Kind: »Wie fühlt sich ein Kind bei den Beziehungserwartungen dieser Eltern!« Bereits in einem ersten Elterngespräch wird jeder Teilnehmer versuchen, die Szene unbewusst so zu gestalten, wie es seinen inneren Objektfantasien und Beziehungsentwürfen entspricht. Aufmerksames Beobachten der Gegenübertragung bewahrt den Therapeuten davor, unbemerkt eine Rolle in der Inszenierung der Familie zu übernehmen. Wichtige Ziele sind es, elterliche Position und Allianz anzustreben. Ersteres meint die Fähigkeit und Bereitschaft von Erwachsenen, ihren Kindern einigermaßen unbelastet durch eigene infantile Konflikte sicher und liebevoll zur Verfügung zu stehen und die Frustrationen, die die Auseinandersetzung mit der Realität unvermeidlich mit sich bringt, altersangemessen, einfühlend und relativ frei von Angst zu vertreten; elterliche Allianz wiederum ist nach Ahlheim getragen von gemeinsam entwickelten Fantasien über das Kind, wie es ist und wie es werden kann, und von dem Entschluss, miteinander die Verantwortung für das Gelingen gemeinsam zu tragen (2007, S. 257). Beide Ziele sollten auch mit getrennt lebenden Eltern zumindest angestrebt werden.
Bei Jugendlichen, vor allem solchen mit sehr belastender Familiendynamik, ist oft ein getrenntes Setting zu empfehlen, Eltern und Patient haben verschiedene Therapeuten. Wolff (1999) beschreibt am Beispiel eines solchen Falles dessen Vor- und Nachteile. Sie sieht vor allem eine Erleichterung der psychoanalytischen Haltung und dass Eltern in ihrer Not und mit ihren Problemen oft besser verstanden werden können. Die größere Möglichkeit, sich auf die Welt der inneren Objekte und Beziehungen der Eltern konzentrieren zu können, zieht nach Wolff auch die Gefahr nach sich, die Grenze der begleitenden Elternarbeit zu verlieren und regressive Prozesse zu fördern, eine Gefahr, die immer besteht. Überhaupt wird Elternarbeit bei Jugendlichen zu lange durchgeführt, oft bis in das Erwachsenenalter. Dies kann durchaus eine autonome Entwicklung erschweren, so dass es besser ist, älteren Jugendlichen ein abgegrenztes Therapieerleben zu ermöglichen.
Die Beendigung einer psychoanalytischen Therapie muss mit dem Patienten und seinen Eltern langfristig vorbereitet werden, denn es besteht – wie zuvor verdeutlicht – immer ein doppeltes Behandlungsbündnis. Freud hat bekanntlich gemeint, dass eine Psychoanalyse erst dann beendet werden kann, wenn sie vom Patienten als endlich erlebt wird. Die Beendigung ist allerdings nicht nur eine Abmachung zwischen Analytiker, Patient und Eltern, die Endlichkeit einer Behandlung wird auch durch die Höchstgrenzen der Psychotherapie-Richtlinien mit bestimmt. Somit müssen zum einen Abschlusstermine festgelegt werden, zum anderen müssen sich die Parteien darüber verständigen, was noch durchgearbeitet werden muss und kann. Endlichkeit ist immer auch eine Auseinandersetzung mit Trennung und Tod. Dies kann sowohl beim Patienten, als auch bei den Eltern und beim Analytiker alte Ängste mobilisieren, verlassen und von der Mutter getrennt zu sein (Sandler, Kennedy und Tyson 1982, S. 304). Also müssen verstärkt Objektverlustängste durchgearbeitet und Übertragungen langfristig aufgelöst werden. Solche Ängste können auch in unterschiedlicher Weise verleugnet werden: Vorzeitiger Abbruch kann gewünscht werden, die häufig wieder aufflammenden Symptome können auch bedeuten, dass der Patient der gleiche wie am Anfang wäre und eine Behandlung nie stattgefunden hätte (ebd., S. 303 f.). Aber auch der Therapeut kann versuchen, Endlichkeit zu verleugnen. Er kann immer neue Verlängerungen einer Therapie beantragen. Er kann, wie das oft geschieht, Beendigungen vor Ferien legen, um Trennung nicht wahrzuhaben und er kann die Frequenz immer mehr verdünnen, um einen klaren Schnitt zu vermeiden und die Trennung hinaus zu zögern. Die rezidivierenden Symptome sind natürlich nicht nur ein Versuch, die Behandlung zu verleugnen, sie sind nicht selten ein Ergebnis von Erschütterungen der Symbolisierungsfähigkeit unter dem Einfluss der anstehenden Trennung, so dass die Fähigkeit, Getrenntheit auszuhalten, wieder geringer wird.
In diesen Tagen hat mir ein 12-jähriger Junge zum Abschluss seiner Behandlung einen Brief geschrieben. Über bewegende, gefühlhafte Dinge wollte er nie gerne sprechen, aber er konnte sie immer auf seine Art vermitteln, und er schrieb: »Es war eine tolle Zeit, aber irgendwann endet immer etwas. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und noch mehr Spaß am Leben haben.« Ich habe den Eindruck, dass er über Vergangenes trauern kann, dass er Trennung aushält und dass er sicher ist, dass wir beide die Trennung überleben werden. Fast hätte ich glauben mögen, er hätte Winnicott gelesen, der einst geschrieben hat: »Ich habe meine Freude daran, Analyse zu betreiben, und ich freue mich immer auf das Ende jeder Analyse. Analyse um der Analyse willen hat für mich keinen Sinn. Ich betreibe Analyse, weil es das ist, was mit dem Patienten gemacht werden muss, und weil es das ist, was der Patient hinter sich bringen muss. Wenn der Patient keine Analyse braucht, dann mache ich etwas anderes« (Winnicott 1984, S. 217).