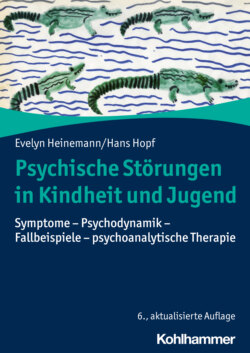Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.1 Behandlungsansätze
ОглавлениеIm Rahmen der psychoanalytischen Theorie möchten wir folgende Punkte kritisch hervorheben:
• Die Problematik des Konzepts der Feinfühligkeit der Mutter, wie bereits oben von Brisch selbst einschränkend vermerkt.
• Die Kategorisierung der Bindungsstörungen beruht auf äußeren Beobachtungen und sagt nur begrenzt etwas über das innere Erleben der Kinder aus.
• Dass bei allen psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten auch Bindungsstörungen zu finden sind, ist unumstritten und auch in der klassischen Psychoanalyse in allen Theorien enthalten (Narzissmustheorie, Objektbeziehungstheorie etc.).
• Die Bindungstheorie war lange einseitig auf die Mutter-Kind-Beziehung reduziert, wird heute aber kritisch erweitert durch das Konzept der komplexen triadischen Beziehungen vom Anfang des Lebens an. Hier erhält auch die Vater-Kind-Beziehung einen bedeutenden Stellenwert in Bezug auf Bindungssicherheit und Exploration (von Klitzing 2002b; 2002a).
Brisch betont: Bei jeder Symptomatik und bei jedem Störungsbild können bindungstheoretische Überlegungen angestellt werden (1999, S. 276).
Die Konsequenzen der Bindungstheorie für die Behandlung enthalten ebenfalls nicht wirklich neue Aspekte. Bei der Therapie liegt der Fokus auf der Bindungsqualität der Therapeut-Patient-Beziehung (ebd., S. 97). Feinfühligkeit und Empathie sollen erfahren und in der Übertragungsbeziehung reaktiviert werden (ebd., S. 98). Im Übertragungskonzept der klassischen Psychoanalyse (z. B. Containing nach Winnicott) ist der Aspekt der Verinnerlichung der mit dem Therapeuten reinszenierten und durch seine Reaktionen und Deutungen veränderten Repräsentanzen gleichermaßen enthalten.
Die Konsequenzen für die Kindertherapie (Brisch 1999, S. 100) werden aufgeführt:
• Sichere Bindungsbeziehung,
• Symbolspiel,
• Bindungsrelevante Interaktionen werden gedeutet,
• Ermöglicht neue sichere Bindung,
• Behutsames Lösen des therapeutischen Bündnisses.
Die therapeutische, sichere Bindungsbasis ermöglicht einen affektiven Neubeginn im Sinne einer korrigierenden Erfahrung (ebd., S. 106).
Unsere kritische Einschätzung der Bindungstheorie ist, dass sie einen fundamentalen und wichtigen Aspekt der Entwicklung betont, der nicht oft und intensiv genug betont werden kann. Sie ist eine Brücke der Psychoanalyse zu psychologisch (qua empirischer Methodik) und physiologisch (qua genetische Verhaltenssysteme) orientierten Ansätzen (vgl. Fonagy 2009). Mit der Betonung der Eltern-Kind-Beziehung und des Bindungsaspektes wird jedoch für die Theorie und Behandlung im Sinne der klassischen Psychoanalyse kein wesentlich neuer Aspekt hinzugefügt. Insofern werden wir auch bei den verschiedenen Störungsbildern nicht explizit hinzufügen – soweit überhaupt vorhanden – welche Bindungsmuster hier gehäuft zu finden sind. Uns geht es bei der Darstellung der verschiedenen Störungen um die Qualität der inneren Bilder und Erfahrungen, die sich äußerlich nur reduziert in den Klassifikationssystemen der Bindungstheorie wiederfinden.
Eine besonders wertvolle Konsequenz der Bindungstheorie ist unserer Einschätzung nach vor allem ihr vielfältiges Anwendungsgebiet im therapeutischen und pädagogischen Feld. Sie regt an zu Informations- und Aufklärungsarbeit über die Konzepte der Bindung beim Eintritt in den Kindergarten und in die Schule. Sie stellt Zusammenhänge zwischen Schul- und Lernprozessen her. Sie richtet im Sinne der Prävention ihr Augenmerk auf Problemsituationen wie die Eingewöhnung in eine neue Umgebung: Tagesmutter, Krippe, Wechsel von Schulen, Umzug (Brisch 1999, S. 268). Schwellensituationen wie Abschied und Trennungsprozesse sollten begleitet werden (ebd., S. 269). Dabei wertschätzt die Bindungstheorie die Pädagogik und Therapie gleichermaßen. Bei der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelten die gleichen Grundsätze wie sie für bindungsorientierte Psychotherapie formuliert werden. Sie müssen den jeweiligen Gegebenheiten des pädagogischen Settings angepasst und bei Bedarf modifiziert werden. Lehrer gelten auch als wichtige sekundäre Bindungspersonen (ebd., S. 276). Es gibt ein Feinfühligkeitstraining für werdende Eltern und videounterstütztes Wahrnehmungstraining (1999, S. 44) sowie die Elterntrainingsprogramme »SAFE« (Brisch 2010).
Inspiriert vom Gedanken der Prävention von Bindungsstörungen führten wir ein Forschungsprojekt durch, in dem die Notwendigkeit von Hausfrühförderung, wie sie in der Sonderpädagogik angeboten wird, gezeigt werden sollte. Eltern frühgeborener Kinder wurden in regelmäßigen Abständen zu Hause besucht und über szenisches Verstehen und analytische Gespräche zur Verbalisierung und Mentalisierung der Affekte angeregt. Bindungsstörungen sollten präventiv durch psychoanalytisch-pädagogische Hausfrühförderung verhindert werden. Ähnliche Konzepte gibt es bereits in den NIDCAP-Modellen (Als und Butler 2008).
Ich (E.H.) möchte eine kurze Vignette aus einem Besuch bei einem Elternpaar beschreiben. Die Mutter ist erst eine Woche vor meinem Besuch zusammen mit ihrem frühgeborenen Säugling – nennen wir ihn Tim – nach Hause entlassen worden. Wir sitzen gemeinsam auf der Couch-Landschaft in einem gepflegten, gemütlichen Reihenhaus. Liebevoll steht das Kinderbett mit Tim am Fenster. Die Mutter erzählt von ihren traumatischen Erlebnissen während der Schwangerschaft und in der Klinik. Auch der Vater, der sich in der Klinik am Känguruhen beteiligt hatte, wirft hin und wieder ein, wie hilflos sie sich gefühlt haben, und auch jetzt sei ihre einzige Stütze die Hebamme, die regelmäßig zu ihnen nach Hause kommt. Angstvoll würden sie beobachten, wie die Hebamme mit dem Kind umgeht. Nach einem langen intensiven Gespräch über ihre Erfahrungen beginnt sich die Mutter zu entspannen und holt das Bett von Tim in unsere Mitte. Die Mutter packt behutsam die Decke zur Seite und ich kann Tim im Bett liegen sehen. Ich bin wie gelähmt und entsetzt. Vor mir liegt ein Säugling, der bis zum Kopf in Bänder gewickelt ist. Zufällig hatte ich eine Woche zuvor ein Buch über Wickelkinder (Frenken 2011) gelesen. Ich denke an die Bilder und kann nicht sprechen. Die Eltern nahmen wohl meinen entsetzten Blick wahr und erklärten mir, dass die Hebamme das »pucken« empfohlen habe. So würde das frühgeborene Kind Begrenzung wie im Mutterleib erfahren und sich beruhigen. Allmählich beginne ich wieder denken und sprechen zu können. Ich gebe zu bedenken, dass das Ungeborene sich im Mutterleib bewegen kann, mit den Beinen und Armen gegen den Bauch der Mutter boxen oder sich bemerkbar machen kann. In diesem Moment ist der Vater sichtbar erleichtert. Er habe sich schon die ganze Zeit gefragt, ob durch das Wickeln der Wille des Kindes gebrochen werde. Während die Mutter anfangs die Idee der Hebamme »super« fand, kam durch die Bemerkung des Vaters, der sich jetzt erstmals dazu äußerte, Bewegung in die Situation. Die Mutter begann das Kind zu »entwickeln« und mit den Füßchen und Ärmchen zu spielen. In den nachfolgenden Besuchen zeigte sich, dass die Familie das Kind nicht mehr »einpuckte« und ein Stück elterliche Kompetenz zurückgewonnen hatten.
Zum Schluss möchten wir noch ein Beispiel aus einer Kurzzeittherapie mit dem Schwerpunkt einer Bindungsstörung aufzeigen.