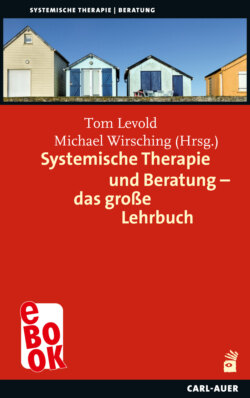Читать книгу Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch - Группа авторов - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.6Theologie/Seelsorge
ОглавлениеGünther Emlein
Obwohl Seelsorge ein Teilgebiet der Theologie ist, haben Seelsorge und Theologie unterschiedliche Zugänge zum systemischen Denken gesucht. Die philosophischsystematische Theologie hat sich von den ersten Publikationen Luhmanns an mit dessen Theorie sozialer Systeme befasst und sich systemtheoretische Beobachtungen zunutze gemacht (jüngst: Thomas u. Schüle 2006). Systemtheorie ist fruchtbar geworden bei der Beobachtung, dass Glaubensgemeinschaften (in Europa) im Regelfall Organisationen sind (Hermelink u. Wegner 2008). Kritisch betrachtet wurde in der Theologie besonders der Konstruktivismus der Systemtheorie, denn er empfiehlt den Abschied von ontologischen Formulierungen in der Theologie. Eine Klippe scheint auch der Funktionalismus Luhmanns zu sein, der Religion nicht als unabhängig von der Welt interpretiert (als geoffenbart), sondern als Antwort auf ein gesellschaftliches Bezugsproblem behandelt (s. u.)! Nutzt man die Inkongruenz der Perspektiven, wie Luhmann es selbst getan hat, könnten Systemtheorie und Theologie sich gut vertragen, denn beide stellen sie Fragen zu den Grundlagen von Kommunikation, Bewusstsein, Sinn, Erkenntnis, Realität, Welt, Kontingenz usw.
Die Seelsorgelehre wiederum hat inzwischen schon seit etwa Ende der 1980er-Jahre Ideen der Familientherapie und später der systemischen Praxis aufgenommen und für Gesprächsführung eingesetzt. Seelsorge gehört zu den Leistungen des Systems Religion für andere Systeme, sie ist eine Leistung für personale Systeme (Luhmann 2004, S. 57 f.): Seelsorge als Dienst, der Einzelne (Personen, Paare, Familien) in den Blick nimmt und sich an den individuellen Sinnkonfigurationen orientiert. Sie wendet sich den personalen Themen des Individuums zu: Lebensfragen (Irritationen des Bewusstseins durch die Moderne), Paarproblemen und Familiengeschichten, religiösen Fragen. Der Anlass kann eine Sorge sein, aber es gibt ebenso aufsuchende Seelsorge, die Interesse der Religion an und Wertschätzung gegenüber Menschen vermittelt: Konfirmandenelternbesuche, Jubiläen oder der Besuch von Neuzugezogenen usw. Darüber hinaus findet man seelsorgliche Kurzkontakte über die Straße, im Lebensmittelgeschäft und bei Dorffesten. An Individualität orientiert, lebt Seelsorge vom freien Spiel der Interaktion und kann letzten Endes nicht durch organisatorische Durchgriffe geregelt werden. (Mit dem Blick auf Religion hat Luhmann Interaktion, Organisation und Gesellschaft zum ersten Mal unterschieden.)
Seelsorge hat entsprechend eine besondere Kommunikationsstruktur: Es muss in jeder Begegnung gemeinsam festgelegt werden, um welche Art von Kommunikation es sich handelt. Ob sie veränderungsorientiert (»therapeutisch«) oder aufklärend, beratend oder begleitend, theologisch, erkundigend und wertschätzend auftritt, ist eine Frage der Vereinbarung und des Kontextes. Die Nähe zu Psychotherapie ist evident, wenn Seelsorge auch vertraglich offener ist. Auch die Begleitung beim Umgang mit dem Unveränderlichen wie Tod, unheilbaren Krankheiten und Behinderungen gehört dazu. Diese ausgesprochen offene Situation zu Beginn gibt der Seelsorge zahlreiche Möglichkeiten der Begegnung und der gemeinsamen Verabredung; notwendig ist allerdings, genau Buch zu führen über das, was möglich, und das, was ausgeschlossen worden ist. Suchen Individuen die Seelsorge auf, ist es oft ein guter Beginn, zu fragen, warum jemand für seine Probleme die Seelsorge und nicht den Psychologen, die Psychotherapeutin usw. in Anspruch nimmt.
Dem funktionalen System der Religion (und nicht dem der Medizin) zugehörig und Methoden von Therapie und Beratung übernehmend, ist Seelsorge ein Hybrid: Sie ist bestimmt von zwei Logiken, der Operationsweise der Gesprächsführung und der Operationsweise der Religion. Als Gesprächsführung setzt Seelsorge den Code der Psychotherapie, »manifest/latent« (Fuchs 2011), ein; als Religion verwendet sie deren Code, »transzendent/immanent« (Luhmann 2004, 2011). Sie beobachtet einerseits personale Systeme auf Lücken (systemisch: unentdeckte Optionen) und auf Betroffenheiten/Befindlichkeiten, sie bewegt sich andererseits wie Theologie generell am Rand von Sinn, sucht nach dem Jenseits von Sinn, nach dem Woher und dem Sinn allen Sinns. Dies ist das gesellschaftliche Bezugsproblem, mit dem Religion sich befasst. Religion gibt zu diesen Fragen »nichtantwortende Antworten«, die Gewissheit andeuten, aber nicht mehr glaubhaft herstellen können. Eine Antwort wie »Sinn kommt von Gott« versucht, immanenten Sinn auf Transzendenz anzuwenden, ein performativer Selbstwiderspruch. Seelsorge hält solche nicht stillzustellenden Fragen (z. B.: »Wird es gut ausgehen? Wie kann Gott das zulassen?«) durch nichtantwortende Antworten und durch Rituale an und entlastet damit Kommunikation und Bewusstsein. Im Gebet, in dem Zitieren religiöser Texte und der andächtigen Meditation wird eine unlösbare Frage symbolisch in andere Hände übergeben – und das Bewusstsein davon befreit. Die Frage wird also weltlichen Möglichkeiten entzogen. Seelsorge bezieht die existenziellen Aspekte mit ein, die mit der Kontingenz von Sinn zusammenhängen: Sinnkatastrophen, Irritationen über das Selbst, »Wer-bin-ich?«-Fragen (die gerade in der Moderne zugleich hoch bedeutsam und unbeantwortbar geworden sind).
Dieser Aspekt der Unverfügbarkeit zeigt sich auch in dem Begriff der Seele. Schon bei Platon ist die Seele unauslotbar und nicht durch Begriff verfügbar. Anders als systemische Praxis, die die Kontingenz von Sinn impliziert, indem sie Sichtweisen verändert, befassen Theologie und Seelsorge sich dezidiert mit der Kontingenz von Sinn. Die »Welt jenseits der Welt« setzt die irdische Welt kontingent (Funktion im Sinne von Luhmann); es geht also nicht darum, ob es ein solches Jenseits »gibt«, sondern welche Funktion das Jenseits für das Diesseits hat: Kontingentstellung, Relativierung, die Unerreichbarkeit der Welt selbst. Jenseits des Sinns gibt es nur noch das Schweigen der Mystik und der Meditation.
Ihr Charakter als Hybrid ermöglicht es der Seelsorge, systemischer Praxis einen spezifischen Umgang mit Kommunikation hinzuzufügen. Wenn der weitere Diskurs nicht zur gewünschten Verbesserung führt oder Fragen unlösbar oder unbeantwortbar erscheinen, bietet Seelsorge die Operation des Transzendierens (und damit des Verlassens) der nicht lösbaren Situation an. Rituale dienen als »Negationsblockaden« (Emlein 2010), sie verhindern, dass mit einem »Ich sehe es anders« Kommunikation weitergeht, wenn sie nur noch »mehr desselben« bedeutet. Unlösbar erscheinende Fragen zu ritualisieren ist inzwischen gängige systemische Praxis.
Eine spezifisch systemisch orientierte Seelsorge hat weitere Gemeinsamkeiten mit systemischer Praxis. Sie kommt ohne Diagnosen aus (setzt sie als immanente mit ihrem eigenen Code kontingent), sucht nach Lebensförderlichem und nach neuen Optionen. Ein wesentlicher Unterschied ist allerdings der Erwartungshorizont, den Klienten bezüglich des Religiösen mitbringen. Hier erwartet man Einfühlsamkeit und die Erfahrung, getragen zu werden. Manchmal ist das Gespräch kurz, dafür ist ein Segen wichtig. Es ist also möglich, dass dieser Horizont manches weniger zulässt (z. B. Symptomverschreibungen), dafür anderes nahelegt (z. B. Rituale, Empathie, Vermeiden von Konfrontation). Hier ist der Takt der geselligen Interaktion (im Sinne von Schleiermacher) vielleicht eine gute Leitlinie (Emlein 2006).
Historisch betrachtet, ist Psychotherapie die säkulare jüngere Halbschwester der Seelsorge; Halbschwester, denn jene hat einen säkularen, nämlich medizinischpsychologischen Vater, der ihr gut bekommen ist, während die Mutter, das helfende Gespräch, dieselbe geblieben ist. Beide sind Kinder der Moderne, insofern sie die Möglichkeit der Beobachtung 2. Ordnung voraussetzen. Beide haben sich in der heutigen Form entwickelt als Antwort auf die Irritation des Individuums darüber, wer es sei, die in der auseinanderstrebenden funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr mit Einheitsfantasien (mit »der« Persönlichkeit) beantwortet werden kann. Seelsorge hat dazu noch Optionen bei Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – niemals Psychotherapie oder Psychiatrie aufsuchen würden.