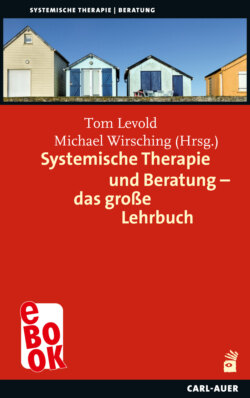Читать книгу Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch - Группа авторов - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.5Theorie autopoietischer Systeme – Humberto Maturana
ОглавлениеKurt Ludewig
Humberto Maturana wurde am 14.9.1928 in Santiago de Chile geboren. Nach einigen Jahren des Medizinstudiums in Chile studierte er in London Anatomie bei dem Zoologen J. Z. Young. Darauf folgte ein Aufenthalt an der Harvard University, wo er 1958 seine Promotion zum Ph. D. in Biologie abschloss. Auf Einladung des Physiologen J. Lettvin widmete er sich dann zwei Jahre lang dem Studium der Physiologie des Froschauges am MIT (Massachusetts Institute of Technology). Die bei dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sollten eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung seiner Theorie der Kognition bekommen. 1960 kehrte er nach Chile zurück, wo er sich der theoretischen Biologie zuwandte. Sein Interesse galt von da an der Frage nach dem Leben und der menschlichen Kognition, kurz: der Neurophilosophie.
In den 1960er-Jahren legte er die Grundsteine für sein biologisches Theoriegebäude. 1969 ging er auf Einladung von Heinz von Foerster als Gastprofessor an das Biological Computer Laboratory der University of Illinois, wo er den für sein Werk zentralen Aufsatz Biology of cognition (1970) verfasste. In den 1970er-Jahren widmete er sich der Ausarbeitung seiner Theorie der Autopoiese lebender Systeme. Eine erste vollständige Darstellung dieser Theorie fand 1972 zusammen mit seinem Schüler Francisco Varela statt (Maturana u. Varela 2008). Das Werk Maturanas bezieht sich seitdem auf fast alle relevanten Fragen seiner Zeit. Auf der Autopoiese-Theorie baut ein Großteil seiner Gedanken zur menschlichen Kognition und Sozialität auf.
Autopoiese (Selbsterzeugung) bezeichnet einen generativen, für Lebewesen konstitutiven Prozess. Autopoietische Systeme – Lebewesen – unterscheiden sich von Nichtlebendigem dadurch, dass sie die Bestandteile, aus denen sie bestehen, selbst erzeugen und gegen die Umwelt abgrenzen. Dies lässt sich am deutlichsten an der Zelle zeigen. Die Zelle verhält sich – metaphorisch gesprochen – wie eine »Molekülfabrik«, deren wesentliche Aktivität darin besteht, die eigenen Bestandteile sowie die sie umgrenzenden Membranen zu erzeugen. Diese Definition des Lebendigen ist weitaus umfassender als frühere Bestimmungen der empirischen Biologie, die sich auf die Kennzeichnung von Leben durch die Aufzählung von Eigenschaften wie Wachstum, Fortpflanzung, Beweglichkeit und Stoffwechsel beschränkten. Demgegenüber war Maturana daran interessiert, Leben als einen Prozess zu identifizieren, der aus der eigenen Autopoiese resultiert. Lebendiges ergibt sich hiernach aus Prozessen, die von den Operationen der Lebewesen selbst herrühren und sich auch darin erschöpfen. Der Nachweis solcher Prozesse reicht dafür aus, Leben von Nichtleben zu unterscheiden. Aus dieser Eigenart »lebender Systeme« folgt, dass sie strukturdeterminiert, selbstreferenziell, zirkulär abgeschlossen und autonom operieren. Diese im wesentlichen die Zelle betreffende Definition lässt sich auch auf multizelluläre Lebewesen – Autopoiese 2. Ordnung – anwenden.
Die Ableitungen, die sich hieraus für das Verständnis der Lebewesen im Allgemeinen und des Menschen im Besonderen ergeben, sind vielfältig. Der Mensch ist nicht nur als Lebewesen sui generis zu verstehen, sondern hat zudem im Verlauf seiner Phylogenese eine Lebensweise entwickelt, die ihn von anderen biologischen Spezies unterscheidet, nämlich das In-Sprache-Sein (span. lenguajear, engl. languaging, deutsch linguieren). Während alle Lebewesen in irgendeinem Ausmaß ihr Verhalten koordinieren, können Menschen mithilfe von Lauten und Gesten diese einfachen Verhaltenskoordinationen übergeordnet koordinieren oder sogar ersetzen. Die dabei erzeugten Verhaltenskoordinationen höherer Ordnung stellen die Grundlage für das Entstehen der menschlichen Sprache dar. Die Sprache mit allen damit einhergehenden Möglichkeiten der Abstraktion und Normierung bildet die spezifische Lebensweise des Menschen und hat ihn in die Lage versetzt, Welten zu generieren, die auf Beschreibungen aufbauen und dadurch prinzipiell unbegrenzt sind – sie sind umfassender, als jede physikalische Welt es sein kann. Das In-Sprache-Sein entwickelt eine eigene Dynamik, der der Mensch nicht mehr entrinnen kann. Dies fasst Maturana folgendermaßen zusammen: »Alles Gesagte wird von einem Beobachter zu einem anderen Beobachter gesagt, der er selbst sein kann.« Kraft seiner konstitutiven Fähigkeit, Unterscheidungen in Sprache zu treffen, sprich: Beobachtungen vorzunehmen und Beschreibungen anzufertigen, lebt der Mensch jeweils die Welten, die er durch entsprechende Unterscheidungen erzeugt. Aus dieser Perspektive sind Denkkategorien wie Input/Output, Zweck, Entwicklung und Zeit keine Merkmale autopoietischer Systeme, sondern Zuschreibungen von Beobachtern.
Autopoietische Systeme sind operational geschlossen, d. h., die eigenen Operationen können nur an andere Operationen des eigenen Systems anschließen. Ihre Systemzustände können von ihrer Umwelt allenfalls »perturbiert« (verstört, irritiert), jedoch nicht determiniert werden. Gleiches gilt für die Kognition. Der Mensch bildet kognitiv keine Merkmale der Außenwelt ab, sondern generiert intern eigene Systemzustände, die als Erfahrung erlebt und entweder der Innen- oder der Außenwelt zugeordnet werden. Deshalb erweist sich das Kriterium der Objektivität, das eine Äquivalenz von inneren Zuständen (Erkenntnis) und äußeren Umständen (Objekt) verlangt, als nicht erfüllbar.
Ohne einen Mechanismus, der Illusion und Perzeption eindeutig zu unterscheiden vermag, geht jede Weltbeschreibung auf einen »Beobachter« zurück. Dieser ontologische Grundsatz bildet das Fundament der Kognitionstheorien Maturanas. Die Bezeichnung »Beobachter« ist selbst eine in Kommunikation erbrachte Beschreibung. Beobachter müssen daher mindestens zu zweit vorkommen. Erst eine kognitive Ich-Du-Unterscheidung ermöglicht Selbstwahrnehmung. Die in der Kommunikation erarbeitete Antwort auf die Frage »Wer unterscheidet?« resultiert in der Beschreibung eines Beobachters. Der Beobachter bringt im Verlauf seiner spezifisch menschlichen Lebensweise-in-Sprache die Welt, die er lebt, und sich selbst hervor. Insofern ist der Beobachter keine präexistierende Figur, sondern vielmehr das Ergebnis einer Reflexion-in-Sprache. Im so verstandenen Prozess der Kognition gehen Beobachter und Beobachtetes ineinander über, die Unterscheidung von Subjekt und Objekt verliert ihren Sinn.
Diese kognitionstheoretische Perspektive lässt sich wie folgt zusammenfassen:
•Das operational und funktional geschlossene Nervensystem des Menschen unterscheidet nicht zwischen internen und externen Auslösern. Wahrnehmung und Illusion, innerer und äußerer Reiz sind für das Nervensystem im Prinzip nicht unterscheidbar.
•Menschliches Erkennen ist als biologisches Phänomen nicht durch die Objekte der Außenwelt, sondern durch die Struktur des Organismus determiniert: Man sieht, was man sieht.
•Menschliche Erkenntnis ist als Leistung des Organismus grundsätzlich subjektgebunden und damit unübertragbar.
Mit Blick auf kommunikationstheoretische Belange lässt sich ergänzen:
•Die biologische Struktur des Adressaten und nicht der kommunizierte Inhalt ist ausschlaggebend: Man hört und versteht, was man hört und versteht.
In späteren Überlegungen ab den 1980er-Jahren ergänzte Maturana seine Autopoiese-Theorie mit sozialtheoretischen Überlegungen. Aus seiner biologischen Perspektive stellt die menschliche Sozialität eine spezielle Manifestation des Biologischen dar. Jede menschliche Interaktion vollzieht sich als »Konversieren« zwischen Beteiligten, bei denen jene Verflechtung von »Linguieren« und »Emotionieren« stattfindet, die kooperatives Handeln ermöglicht. Emotionieren stellt eine körperlich bedingte Handlungsdisposition in bestimmten Handlungsbereichen dar. In der Emotion der Zuneigung ist man z. B. zu anderen Handlungen disponiert als in jener der Wut. Sozialen Phänomenen und der Sozialisation schlechthin liegt ein Prozess zugrunde, den Maturana mit »Liebe« bezeichnet. Damit ist die Bereitschaft gemeint, den anderen als Gleichen neben sich zu akzeptieren. Aus der Liebe als primärer Emotion und Basis menschlicher Sozialisation wird eine ethische Haltung abgeleitet, die auf Akzeptanz und Respekt aufbaut. Diese Haltung ist für die systemische Therapie zentral und fester Bestandteil ihrer Lehre. Sie mahnt vor allem im Hinblick auf Kausalitätsannahmen zur Bescheidenheit im Denken und Handeln und hilft, jene häufige Verirrung zu vermeiden, die Maturana (in Maturana u. Varela 1987) die »Versuchung der Gewissheit« genannt hat. Zum einen bietet systemisches Denken keine Gewissheiten, auf die man sich beziehen könnte, um den Wahrheitsgehalt der eigenen Aussagen endgültig zu belegen, zum anderen beschränkt sich dieses Denken bewusst auf die Ergebnisse menschlichen Beobachtens, ohne auf darüber hinausgehende metaphysische Letztbegründungen zurückzugreifen. Diese Mahnung gilt im besonderen Maße für Angehörige helfender Berufe. Als Psychologen, Ärztinnen oder Sozialarbeiter neigen wir angesichts schwieriger oder gar bedrohlicher professioneller Situationen und Handlungsanforderungen dazu, unsere Entscheidungen normativ zu begründen und als alternativlos darzustellen.
Die Autopoiese-Theorie und die daraus abgeleitete Kognitionstheorie übten in den 1980er-Jahren einen starken Einfluss insbesondere auf die Geistes- und Sozialwissenschaften aus, vor allem auf die Kybernetik, die Selbstorganisationstheorie und die Systemtheorie. Der Soziologe Niklas Luhmann berichtete, dass er sein Opus magnum, Soziale Systeme (1984), umschreiben musste, nachdem er die Ansätze Maturanas rezipiert hatte. Im Bereich der Psychotherapie wirkten sich Maturanas Gedanken enorm befreiend aus. Man konnte – nicht zuletzt durch eine naturwissenschaftlich begründete Theorie unterstützt – von bis dahin geltenden Kausalitäts- und Objektivitätsmodellen, die einen wenig überzeugenden, gezielten Interventionismus nahelegten, abrücken und alternative Modelle für eine wirksame Psychotherapie entwickeln. Das war die Geburtsstunde der eigentlichen systemischen Therapie. Seitdem hat sich der systemtherapeutische Diskurs in vielerlei Hinsicht erweitert. Dennoch ist die historische Bedeutung der Theorie Maturanas auch heute noch spürbar. Mit ihrer Hilfe war es möglich, menschliche Kognition und menschliche Interaktion auf völlig neue Weise zu erfassen und so eine neuartige Psychotherapie zu begründen.