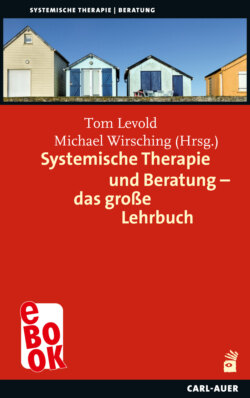Читать книгу Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch - Группа авторов - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.3Kommunikation und Beobachtung: Die Kybernetik 2. Ordnung
ОглавлениеTom Levold
1952 erschien ein richtungweisendes Buch, das Gregory Bateson gemeinsam mit dem Schweizer Psychiater Jürgen Ruesch (1910–1995) unter dem programmatischen Titel Kommunikation. Die soziale Matrix der Psychiatrie veröffentlichte (1995). In diesem Band legte Bateson den Grundstein für eine neue soziale Epistemologie, die den Fokus nicht mehr auf das Individuum, sondern auf die zwischenmenschliche Kommunikation richtete. Die darin enthaltenen Konzepte umfassen bereits vieles, was das heutige systemische Denken ausmacht. Die »Matrix der Kommunikation« beinhaltet die Fokussierung auf umfassendere Gestalten (Kontext) statt auf isolierte Gegenstände, auf Prozesse statt auf Strukturen, auf Ganzheiten statt auf Teile, auf Organismen statt auf Organsysteme, auf Systeme, »in die der Beobachter eingeschlossen ist«, statt auf Systeme »außerhalb des Beobachters« (ebd., S. 285). Diese reflexive Epistemologie verwirft alle Möglichkeiten objektiver oder absoluter Theoriebildung und fordert stattdessen eine relativistische Position: »Die Gestalt wird durch Einschluss nicht nur des Beobachters, sondern auch des Theoretikers unserer psychologischen Befangenheit erweitert« (ebd.).10
Wesentlich für das Studium von Kommunikation aller Art ist die Erkenntnis, dass alles Verhalten in Beziehungen als Kommunikation gedeutet werden kann. Aus dieser Perspektive kann man daher nicht nicht kommunizieren. Was wem als Kommunikation zugeschrieben und wie es bewertet wird, ist aber kein Aspekt der Kommunikationshandlung selbst, sondern eine Entscheidung der Kommunikationsteilnehmer bzw. eines Beobachters. Er nimmt kontinuierlich »Interpunktionen des Flusses ausgesandter Signale« vor (ebd., S. 36) und weist einer Handlung damit Bedeutung zu. Diese Bedeutungsgebung ist immer kontextrelativ, d. h. bezogen auf unterschiedliche soziale, historische, politische oder beziehungsmäßige (Bezugs-) Rahmen (Frames).
Darüber hinaus erschöpft sich Kommunikation nicht in der Mitteilung inhaltlicher (digitaler) Botschaften, sondern geht mit (analogen, d. h. nonverbalen) Beziehungs- bzw. Kontextbotschaften einher, die mit den jeweiligen Inhalten übereinstimmen, aber auch von ihnen abweichen können (etwa die Aussage »Ich liebe dich«, verbunden mit einer körperlichen Abwendung). Widersprüchliche Botschaften auf unterschiedlichen Ebenen wurden von Bateson und seiner Gruppe als Beziehungsfalle (Doublebind) angesehen, die zunächst als verantwortlich für die Entwicklung einer Schizophrenie gewertet wurde (Bateson et al. 1969). Dieses Konzept wurde vor allem durch die bis heute populäre Aufbereitung der Axiome der Kommunikationstheorie durch Paul Watzlawick, Janet Beavin und Don D. Jackson (2011) weit verbreitet. Die Doublebind-Hypothese und die damit verbundene Pathologisierung paradoxer Kommunikationsmuster erwies sich jedoch nicht als haltbar, da sich zeigte, dass ein Großteil der alltäglichen Kommunikation von solchen Paradoxien durchdrungen ist, darunter der Humor und ein großer Teil kreativen Handelns. Zudem führte die unreflektierte Übernahme dieser Theorie zu einer Stigmatisierung der Eltern psychotischer Patienten, die diese mit ihrer Kommunikation »verrückt machten«.
Zwar stützte sich die familientherapeutische Arbeit am MRI auf die Arbeiten ihres Mentors Bateson, dennoch wurde die Familie zusehends im Sinne einer kybernetischen Maschine als Regelkreis verstanden, in dem fortlaufend Ist-Werte aus dem System mit einem jeweiligen Soll-Wert abgeglichen werden und interne Zustandsregulierungen für die Wiederherstellung des benötigten oder gewünschten Gleichgewichtszustandes (Homöostase) sorgen. Die Leitmetapher dieses Modells der Minimierung von Abweichungen durch negative Rückkoppelungen (Feedbackschleifen) ist der viel zitierte thermostatgesteuerte Heizungskreislauf (ebd., S. 135). Aus dieser Perspektive sind auch komplexe Systeme grundsätzlich als triviale Maschinen verstehbar und daher instruierbar, das heißt durch äußere Eingriffe und Interventionen, besonders durch Verstellen des Reglers in ihrem Zustand determinierbar, vorausgesetzt, man kennt die Regeln der Familie.
In Europa wurden die Arbeiten Batesons und der Palo-Alto-Gruppe vor allem von der Arbeitsgruppe um Mara Selvini Palazzoli aufgegriffen und im sogenannten Mailänder Ansatz weiterentwickelt.11 Die Schwachpunkte dieser Betrachtungsweise liegen vor allem in ihrem Strukturkonservativismus, der die Erhaltung und Stabilität sozialer Systeme durch Feedbackprozesse zuungunsten der Dynamik von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen betont, sowie in ihrer normativen Ausrichtung, die eine Festlegung bestimmter Regelgrößen als »gesunde« Soll-Werte (von Nähe und Distanz, Grenzsetzung, Hierarchie etc.) nahelegt und dazu neigt, Abweichungen zu pathologisieren. Theoretisch unbeantwortet bleibt nämlich die Frage nach der Regelung des Reglers, die ja selbst eines äußeren Organisators bedarf (zur Kritik am Homöostasekonzept vgl. u. a. Ray, Stivers u. Brasher 2011, S. 51 f.; Dell 1982). Auch wenn die Gefahr einer interventionistischen »Trivialisierung« komplexer Systeme nicht von der Hand zu weisen ist, sind auch heute noch Konzepte der Kybernetik 1. Ordnung (oft eher implizit) im praxeologischen Inventar systemischer Therapie zu finden und klinisch durchaus nutzbringend anzuwenden, wenn man ihre Konstrukthaftigkeit in hinreichendem Maße mitreflektiert.
Mit dem Schritt von der Familientherapie zur systemischen Therapie Anfang der 1980er-Jahre wurde die epistemologische Orientierung an der Kybernetik 1. Ordnung zunehmend von Bezugnahmen auf die Kybernetik 2. Ordnung abgelöst. Dieser Terminus geht auf den 1949 in die USA ausgewanderten österreichischen Physiker, Techniker und Erfinder Heinz von Foerster zurück, der neben Gregory Bateson, Humberto Maturana (vgl. Abschn. 1.3.5) und Niklas Luhmann (Abschn. 1.3.6) zu den zentralen Ideengebern des systemischen Ansatzes zählt. Zunächst fungierte er als Sekretär der Macy-Konferenzen, deren Protokolle er edierte und herausgab. 1958 gründete er das Biological Computer Laboratory an der Urbana University of Illinois, eine zentrale, wenngleich oft zu wenig beachtete Institution der kybernetischen Bewegung, an der von Foerster vielen Wissenschaftlern, darunter Humberto Maturana, Ross Ashby, Gotthard Günther und Gordon Pask, Forschungs- und Publikationsmöglichkeiten verschaffte (vgl. ausführlich A. Müller 2000).
Neben seinen philosophischen und kybernetischen Arbeiten, denen er im Feld der systemischen Therapie am stärksten seine Bekanntheit und Beliebtheit verdankt, hat er sich während seiner wissenschaftlichen Laufbahn mit den unterschiedlichsten Themen, Fragestellungen und Disziplinen beschäftigt, mit Physik und Mathematik, Gedächtnisforschung, Biologie, Neurologie, Hämatologie, Computerforschung, künstlicher Intelligenz, Kommunikationstheorie und anderem. Dabei war seine Position immer transdisziplinär: Die Auflösung der Disziplingrenzen und die Suche nach den verbindenden Kontexten interessierten ihn mehr als die jeweiligen disziplinären Lehrgebäude mit ihren Macht- und Statusambitionen. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass er in der akademischen Welt niemals eine besonders starke Position innehatte – ein Schicksal, das er mit den meisten Pionieren der Kybernetik teilte: Das BCL wurde schon kurz nach seiner Emeritierung 1976 aufgelöst, das Institutsgebäude abgerissen (ebd., S. 27). Sein Werk liegt überwiegend in der Form von eher kurzen Aufsätzen, Niederschriften von Vorträgen und Interviewbänden vor, die sein enormes Charisma auf besondere Weise zur Geltung bringen.12
Das BCL kann als Fortführung von McCullochs Programm einer »experimentellen Epistemologie« betrachtet werden, bei der die Beschäftigung mit Logik, der Möglichkeit von Erkenntnis und der Bedeutung von Sprache und Kommunikation im Zentrum stand (Ramage u. Shipp 2009, S. 180). Diese Beschäftigung stellt mit ihrem vorrangigen Interesse an den biologischen und epistemologischen Voraussetzungen von Erkenntnis die soft side der Kybernetik dar, in Abgrenzung zu der an Computern und Artificial Intelligence orientierten hard side der Kybernetik, die sich am Massachusetts Institute for Technology (MIT) abspielte (ebd.).
Im Zentrum der Bemühungen stand und steht dabei die Radikalisierung des Beobachterkonzeptes. Im Unterschied zu trivialen Maschinen, die – solange sie nicht defekt sind – aufgrund ihrer Konstruktionsweise auf spezifische Inputs immer mit dem gleichen Output reagieren (etwa ein Motor oder ein Lichtschalter), beschreibt von Foerster Organismen als nichttriviale Maschinen, bei denen der Output nicht durch den vorhergehenden Input bestimmt wird, sondern durch ihn in Verbindung mit dem »zuvor erzeugten Output der Maschine« (von Foerster 1999, S. 12). Da der Begriff der Maschine hier rein formal (als zwischengeschaltete Struktur zwischen Input und Output) verwendet wird, sind Menschen ebenso wie alle anderen Organismen nichttriviale Maschinen, da sie aus Erfahrungen lernen und ihre Erfahrungseindrücke vermittels ihres Gedächtnisses und vor dem Hintergrund ihrer Entwicklungsgeschichte verarbeiten, was allein den Output determiniert (Verhalten, Handeln, Kommunikation), der damit eben nicht trivial, vorhersagbar und linear-kausal erklärbar ist (von Foerster u. Pörksen 1998, S. 38 ff.).
Organismen sind aufgrund der Nichtdeterminierbarkeit ihrer inneren Zustände durch ihre Umgebung autonom, d. h., sie organisieren und regeln sich selbst in einer kreiskausalen (zirkulären) Weise, die den eigenen Output zur Eingangsgröße macht:
»Der Sinn (oder die Bedeutung) der Signale des Sensoriums wird durch das Motorium bestimmt, und der Sinn (oder die Bedeutung) der Signale des Motoriums wird durch das Sensorium bestimmt« (von Foerster 1999, S. 66).
Wie kommt bei dieser operationalen Schließung Erkenntnis zustande? Was ermöglicht Kognition?
Das »Prinzip der undifferenzierten Codierung« (ebd., S. 69) besagt, dass die Erregungszustände einer Nervenzelle nicht die Natur einer Erregungsursache (z. B. visuelle, auditive oder taktile Reize) codieren, sondern ausschließlich die Reizstärke (Amplitude und Frequenz) und den Ort der Sinneserregung im Körper. Was im Nervensystem verarbeitet wird, sind deshalb keine qualitativen Umweltdaten, sondern ausschließlich interne, quantitative Signalgrößen. Realität ist daher kein Abbild der Außenwelt, sondern stellt ein Ergebnis einer Er-Rechnung dar, wobei der Begriff des »Rechnens« nicht auf das Operieren mit Zahlen verweist, sondern »jede (nicht notwendig numerische) Operation« benennt, »die beobachtete physikalische Entitäten (›Objekte‹) transformiert, modifiziert, ordnet, neu anordnet usw.« (ebd., S. 30).
Er-Kennen ist für von Foerster das Er-Rechnen einer (nicht der!) Realität bzw. das Errechnen einer Beschreibung einer Realität bzw. das Errechnen von Beschreibungen bzw. das Errechnen von Errechnungen. Der Prozess des Erwerbs von Kenntnissen stellt sich so als rekursives Errechnen dar (ebd., S. 68 f.; vgl. auch Simon 2011, S. 35 ff.). Diese Kybernetik der Kybernetik bzw. Kybernetik 2. Ordnung macht die Annahme einer Wirklichkeit, die unabhängig vom Beobachter untersucht werden könnte, obsolet. Dennoch bedeutet die Autonomie des Beobachters nicht, dass Erkenntnis beliebig ist. Die kontinuierliche Rekursion von internen Interaktionen im Nervensystem führt nämlich (in einer halbwegs stabilen Umgebung) zu durchaus stabilen Zuständen, die von Foerster »Eigenwert« bzw. »Eigen-Verhalten« nennt. Sein »Postulat der epistemischen Homöostase« besagt, dass das Nervensystem als Ganzes sich so organisiert, dass es eine stabile Realität errechnet (von Foerster 1999, S. 79). Gleiches gilt auch für größere nichttriviale Systeme:
»Bei Familientherapien etwa, da sieht man dieses Verhältnis auf wunderbare Weise. Da hat sich eine Familie in einen Eigenwert hineingespielt, der Mann betrinkt sich und prügelt, wenn er nach Hause kommt, jedes Mal seine Frau. Das hat sich praktisch stabilisiert, ist voraussagbar. Das Problem des Therapeuten liegt nun darin, die beiden Personen aus diesem Eigenwert, aus dieser Selbsttrivialisation herauszuziehen. Wenn ich glaube, dass eine Familie ein triviales System ist, kann ich sie nicht heilen. Wenn ich aber weiß, dass hinter diesen scheinbaren Trivialitäten tiefe Nichttrivialitäten lagern, kann ich mich an sie wenden und versuchen, eine Emergenz von neuen Verhaltensweisen hervorzuholen, indem ich dieses Ensemble so bewege, dass plötzlich ein neuer dynamischer Gleichgewichtszustand entsteht« (von Foerster, Müller u. Müller 2002, S. 53 f.).
Das Konzept der Autonomie des Beobachters hat weitreichende Konsequenzen für soziale Systeme, da es die Übernahme der Verantwortung für die eigenen Beschreibungen (und ihre Implikationen) fordert, eine Position, die von Foerster zum Ausgangspunkt einer »KybernEthik« macht (von Foerster 1993; vgl. auch Pörksen 2011a).
Die Rezeption der Arbeiten von Foersters und Humberto Maturanas13 (vgl. Abschn. 1.3.5) zu Beginn der 1980er-Jahre, vor allem der Theorien des Beobachters, der Selbstreferenzialität und der Selbstorganisation – auch durch Niklas Luhmann (Abschn. 1.3.6; vgl. auch A. Müller 2000, S. 28) –, führte zur konstruktivistischen Wende im Feld der Familientherapie und machte die Kybernetik 2. Ordnung zur zentralen Referenztheorie des systemischen Ansatzes.