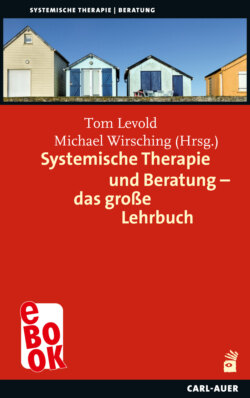Читать книгу Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch - Группа авторов - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.4Radikaler Konstruktivismus
ОглавлениеTom Levold
In der Gründungsphase der systemischen Therapie und Beratung Anfang der 1980er-Jahre spielte der radikale Konstruktivismus eine entscheidende Rolle (z. B. Köck 1983; Schmidt 1987; Watzlawick 1994), als dessen Hauptvertreter neben seinem Namengeber Ernst von Glasersfeld (1917–2010) auch Humberto Maturana und Heinz von Foerster galten, die sich selbst übrigens nicht als Konstruktivisten bezeichneten (vgl. von Foerster u. Pörksen 1998, S. 29 f.). Seitdem hat sich der Konstruktivismus als theoretischer Bezugsrahmen für Systemiker durchgesetzt. Wie die weiteren Beiträge dieses Epistemologiekapitels zeigen, kann allerdings von einem einheitlichen Verständnis konstruktivistischer Theorie nicht wirklich die Rede sein. Eher handelt es sich um einen »inkohärenten Diskurs mit ziemlich unterschiedlichen Stimmen und Verzweigungen« (S. J. Schmidt 2010, S. 6). Der kleinste gemeinsame Nenner der unterschiedlichen Konstruktivismen dürfte darin bestehen, Aussagen und Beschreibungen nicht als objektive Abbildung von Realität zu verstehen, sondern als grundsätzlich abhängig von der Perspektive eines Beobachters und damit subjektgebunden aufzufassen. Das hat insofern Folgen für das therapeutische Selbstverständnis, als die – z. B. diagnostische (vgl. Kap. 1.6) – Beschreibung dessen, was der Fall ist, keinen überlegenen Zugang zu objektivierbarem (Experten-)Wissen mehr markiert, sondern nur den Beschreibungen der Klienten weitere Beschreibungen hinzufügt. So weit, so trivial. Betrachtet man den systemtherapeutischen Diskurs etwas genauer, lässt sich feststellen, dass die Diskussion des Konstruktivismus und seiner Grundlagen im systemischen Feld vielfach eher oberflächlich, theoretisch unterbestimmt und eklektizistisch geführt wird. Widersprüche, Kontroversen und Kritik werden eher nicht, zumindest nicht systematisch rezipiert.14
Von Glasersfeld bezieht die Bausteine seiner Theorie des radikalen Konstruktivismus aus mehreren Quellen (von Glasersfeld 1994). Neben den Entwicklungslinien einer erkenntnisskeptischen Philosophie seit der Antike sind dies vor allem die darwinsche Evolutionstheorie, die konstruktivistische Psychologie Jean Piagets, der den Aufbau des Wissens »als Instrument der Anpassung an die Erlebenswelt« (von Glasersfeld 1998, S. 39) entwicklungspsychologisch untersucht, und die Kybernetik mit ihren Konzepten der Selbstorganisation und Selbstregulierung (von Glasersfeld 1992). Sein prominentestes Konzept ist der evolutionstheoretisch begründete Begriff der Viabilität von Erkenntnis, der die Vorstellung »wahren Wissens« durch die Pragmatik erfolgreicher Anpassung ersetzt und
»sich immer und ausschließlich nur auf die Fähigkeit bezieht, innerhalb der Bedingungen und trotz der Hindernisse zu überleben, welche die Umwelt oder ›Wirklichkeit‹ dem Organismus als Schranken in den Weg stellt« (von Glasersfeld 2012, S. 25; vgl. auch Köck 2011).
Nach der systemischen Anfangseuphorie der 1980er-Jahre wurde der radikale Konstruktivismus zunehmend auch kritischer betrachtet. Bedeutsame Einwände richten sich z. B. gegen seine Verwendung naturwissenschaftlicher Argumente, die im Rahmen des Selbstverständnisses als »empirischer Erkenntnistheorie« die Konstruktivität der Wahrnehmung beweisen sollen, ohne dass diese Argumente selbst ebenfalls als soziale Konstruktionen betrachtet werden, womit die Theorie ein Selbstanwendungsproblem habe (Groeben 1998, S. 155; Janich 1992, S. 34 f.). Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich gegen die einseitige Orientierung an kognitiven Aktivitäten: Affekte und Gefühle werden im radikalen Konstruktivismus ebenso vernachlässigt wie Handlungen bzw. körperliche Tätigkeiten (Janich 1992, S. 39). Siegfried J. Schmidt, der in den 80er-Jahren maßgeblich zu seiner Verbreitung im deutschsprachigen Raum beigetragen hat, hat schon früh diese und andere Kritikpunkte aufgegriffen (1992; 1998) und sich von der eingeschränkten Perspektive des radikalen Konstruktivismus entfernt, vor allem von seiner Konzentration auf den biologisch-individuellen Beobachter als Erkenntnissubjekt, welche die sozialen, historischen und institutionellen Voraussetzungen von Erkenntnis und sprachlichem Handeln ausblendet. Mit seinem eigenen Konzept Geschichten & Diskurse, das im therapeutischen Feld bislang eher verhalten zur Kenntnis genommen wird, leitet er einen bemerkenswerten Abschied vom Konstruktivismus ein (2003). Dem Philosophen Josef Mitterer zufolge gelingt es dem Konstruktivismus nicht, den Dualismus zwischen einer konstruierten »Wirklichkeit« und einer dahinter liegenden, nicht zugänglichen »Realität« aufzulösen (2001). Zudem läuft die – im systemischen Feld gerne als ethisch geboten betrachtete – Anerkennung aller Konstruktionen als prinzipiell gleichwertig darauf hinaus, dass Wirklichkeiten zu wenig »Ausdehnung« haben, um Platz für Meinungsverschiedenheiten bieten zu können:
»Wenn in einer Welt-1 [Sprach-, Theorie- oder Kulturwelt; T. L.] nur konsensuelle Auffassungen möglich sind, dann entspricht jede konfligierende Auffassung einer anderen Welt, und für Konflikte ist kein Platz« (ebd., S. 59).15
Dies könnte auch ein Grund sein, warum trotz z. T. beträchtlicher konzeptueller Unterschiede im systemischen Diskurs theoretische Kontroversen nur recht selten zu finden sind.
Über die Beschäftigung mit den verschiedenen konstruktivistisch inspirierten Konzepten hinaus, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, lohnt sich eine Auseinandersetzung mit weiteren konstruktivistischen Theorien (bzw. ihren Vorläufern), die jedoch im systemischen Diskurs nur teilweise Resonanz gefunden haben. Bernhard Pörksen hat eine beachtliche Zahl von Schlüsselwerken des Konstruktivismus zusammengestellt (2011c), deren Autoren sich auf jeweils verschiedene Theorietraditionen (naturalistisch vs. kulturalistisch fundiert) und Begründungsmodi (philosophisch, psychologisch, kybernetisch, biologisch oder wissenssoziologisch) beziehen.
Neben den bereits erwähnten Protagonisten seien von den dort vorgestellten Theoretikern bzw. Forschungsprogrammen hier einige genannt: die Philosophen Immanuel Kant und John Dewey (auf den sich ausführlich Kersten Reich mit seiner konstruktivistischen Pädagogik bezieht; vgl. Abschn. 1.2.5; Reich 2009a, b), der Psychologe George Kelly (1991), der Anthropologe und Linguist Benjamin Lee Whorf, der Vertreter des sozialen Konstruktionismus Ken Gergen (vgl. Abschn. 1.3.7; sowie Gergen 2002), der Mathematiker und Differenztheoretiker George Spencer-Brown (1997), der lange unbeachtete Klassiker der Wissenschaftsforschung, Arzt und Biologe Ludwik Fleck (1994), der ebenso wie Karin Knorr-Cetina (2002) und Bruno Latour (Latour u. Woolgar 1979) zeigte, dass auch vermeintlich objektive naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse in einem sozialen Konstruktionsprozess hervorgebracht werden, die Wissenssoziologen Peter Berger und Thomas Luckmann, die sich mit der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit beschäftigten (2010), und schließlich der methodische Konstruktivismus der Erlanger Schule von Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen, der aktuell vor allem von Paul Janich vertreten wird (1992).
Alle diese Autoren und Theorielinien machen die vielfältigen Perspektiven und Facetten sowie das enorme, aber bislang im systemischen Diskurs vor allem von Praktikern nur z. T. rezipierte erkenntnistheoretische Potenzial des Konstruktivismus deutlich. Die Spielarten konstruktivistisch-systemischen Denkens werden in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter vorgestellt.