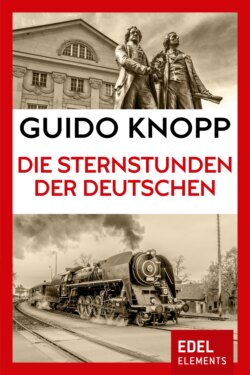Читать книгу Die Sternstunden der Deutschen - Guido Knopp - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1450 Gutenbergs Erfindung
Оглавление»Ohne Gutenberg hätte Kolumbus den Seeweg nach Amerika nicht gefunden, hätte Shakespeares Dichtergenius keine Verbreitung gefunden und wären Martin Luthers Thesen ohne jede Wirksamkeit geblieben.« Mit dieser Begründung setzten vier amerikanische Journalisten 1999 den Mainzer Johannes Gutenberg, der Mitte des 15. Jahrhunderts den mechanischen Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand, auf den ersten Platz ihres Rankings zum »Mann des Jahrtausends«.
Auf den ersten flüchtigen Blick sind es »lediglich« eine Reihe von technischen Verbesserungen und Entwicklungen, an denen Johannes Gutenberg gearbeitet – und sich damit beinahe an den Rand des Ruins gebracht hat. Doch der Buchdruck, wie der Mainzer ihn entwickelt hat, wurde zu einem ganz entscheidenden Motor für neue Ideen und veränderte schließlich die ganze Welt.
Bis zu jener Erfindung hatte man Texte vervielfältigt, indem man sie per Hand abschrieb: eine zeitaufwendige, teure und sehr exklusive Prozedur. Zwar gab es damals schon den Druck mit Holztafeln, doch war diese Technik langwierig und umständlich, und die schweren Tafeln hatten den Nachteil, dass man sie nur für eine begrenzte Zahl von Drucken einsetzen konnte.
Gutenbergs geniale Idee: Er zerlegte Texte in ihre kleinsten Einzelteile, die Buchstaben. Mit einem speziellen Handgießinstrument konnten die Drucklettern nun einzeln, schnell und in feiner Qualität gegossen werden. Außerdem verbesserte Johannes Gutenberg die Druckerpresse und optimierte die bisher genutzte Druckfarbe. Seine Bleilettern hatten mehrere Vorteile: Da man sie immer wieder verwenden konnte, ließen sich Druckerzeugnisse in großer Zahl und relativ preisgünstig produzieren. Außerdem sahen die Buchstaben auch nach Tausenden von Druckvorgängen noch gestochen scharf aus.
Um 1447 nutzte Gutenberg diese neue Technik wohl erstmals und erstellte einen Kalender, der als das älteste Druckwerk nach diesem Verfahren gilt. Zwischen den Jahren 1450 und 1456 produzierte er dann die berühmte 42-zeilige Bibel. Es war ein wahrhaft monumentales Unterfangen: 100000 Drucktypen, Häute von 3200 Tieren, 1000 Gulden Materialkosten und allein 230 760 Arbeitsgänge wurden benötigt, um die 180 Exemplare mit jeweils 1282 Seiten anzufertigen. Heute existieren von der Gutenberg-Bibel noch 49 bekannte Exemplare weltweit, teilweise nur noch in Fragmenten. Im Jahr 1987 erzielte eine jener Bibeln den höchsten Kaufpreis, der jemals für ein Druckwerk bezahlt wurde: insgesamt 9,75 Millionen DM (knapp 5 Millionen Euro).
Die gutenbergsche Erfindung kam just zum richtigen Zeitpunkt. Schon im 14. Jahrhundert war das Interesse am Lesen gestiegen, und auch die Vielfalt an Themen hatte beständig zugenommen. Neben der Religion wurden weltliche Themen immer interessanter für die Menschen – eine Tendenz, die der Renaissance-Humanismus weiter beförderte. Zudem gab es gestiegene Ansprüche an Schriftwerke: So hatte Nikolaus von Kues bereits seit dem Konstanzer Konzil (1414– 1418) eine größere Einheitlichkeit der Gebetbücher gefordert. Technische Vorboten der Umwälzung durch den Buchdruck waren die Einführung des Holzschnitts im Süden Deutschlands um 1380 und die Gründung der ersten deutschen Papiermühle in Nürnberg. In Ostasien wurden zudem bereits Ton- und Kupferstempel zum Druck von Banknoten und Texten genutzt, und manche Buchbinder verwendeten schon metallene Stempel für den Blinddruck von Buchstaben. Unklar ist, ob Johannes Gutenberg von diesen Techniken wusste. Fakt ist, dass er es war, der die Entwicklungen zusammenführte – und die Buchdruckerkunst begründete, die bis zur digitalen Medienrevolution die Grundlage aller Kommunikation darstellte. Sein technisches Verständnis und vor allem auch seine Risikofreude als Unternehmer waren das Fundament, auf dem der immense Erfolg seiner Erfindung aufbaute.
»Die hohen Wohltaten der Buchdruckerei sind mit Worten nicht auszusprechen. Durch sie wird die Heilige Schrift in allen Zungen und Sprachen eröffnet und ausgebreitet, durch sie werden alle Künste und Wissenschaften erhalten, gemehrt und auf unsere Nachkommen fortgepflanzt.«
MARTIN LUTHER
Geboren wurde Gutenberg um 1400 als Sohn des Kaufmanns Friele Gensfleisch, der im Mainzer Hof »zum Gutenberg« wohnte – daher der Name, unter dem der Patriziersohn bekannt wurde. Seine ersten Jahre verbrachte Johannes Gutenberg hier im Zentrum der Domstadt, er lernte vermutlich in dem nahe gelegenen St.-Victor-Stift Lesen, Schreiben und Latein. Im Jahr 1411 zog die Familie nach Eltville. Nach dem Tod seines Vaters kehrte Gutenberg 1419 nach Mainz zurück und erhielt Einblick in die Goldschmiedekunst, die er bei einem mindestens zehnjährigen Aufenthalt (gesichert ist die Zeit von 1434 bis 1444) in Straßburg vertiefte. Hier arbeitete er auch bald an der Entwicklung eines neuen Druckverfahrens, an der Herstellung von Lettern und an der Druckerpresse.
So einleuchtend uns heute die Genialität von Gutenbergs Erfindung gegenüber der umständlichen handschriftlichen Vervielfältigung von Schriftwerken erscheint – seinen Zeitgenossen musste der Mainzer erst »beweisen«, dass er große Mengen von Druckwerken mit einer gleichbleibenden und vor allem hohen Qualität herstellen konnte. Dazu brauchte er die Unterstützung von Geldgebern: Zurück in Mainz, schloss Gutenberg deshalb anno 1450 mit dem Verleger und Geldverleiher Johannes Fust einen Vertrag über die Errichtung einer Druckerei und den Druck ebenjener 42-zeiligen Bibel. Damit wollte Gutenberg zeigen, dass seine Erfindung marktreif war. Doch die Produktion der Bibel war viel teurer und langwieriger, als Gutenberg es sich vorgestellt hatte. Er schaffte es nicht, die Kredite termingerecht zurückzuzahlen. Kurz nach Fertigstellung der ersten Bibel-Exemplare in der Zeit 1454 / 1455 kam es deshalb zu einem Rechtsstreit mit Johannes Fust. Gutenberg musste seine Druckerei samt Material und Geräten an den Geldgeber abtreten, der mit einem Gesellen und Mitarbeiter des Erfinders die Werkstatt weiterführte. Gutenberg selbst kehrte in sein Elternhaus zurück und gründete dort offenbar mit neuen liquiden Geschäftspartnern eine eigene Druckerei. Dass er trotz seiner finanziellen Probleme ein geachteter Bürger war, lässt Gutenbergs Ernennung zum Hofedelmann des Erzbischofs von Mainz, Adolf II. von Nassau, anno 1465 vermuten. Als »Hofmann« erhielt er jährlich Kleidung, Korn und Wein und wurde auch von Diensten und Steuern befreit. Doch große Reichtümer brachte ihm seine Erfindung nicht ein. 1468 starb Gutenberg in Mainz: »Anno Domini 1468 uf Sankt-Blasius-Tag starb der ehrsam Meister Henne Gensfleisch, dem Gott gnade.« (Notiz von unbekannter Hand in einem frühen Mainzer Druck.)
»Mehr als das Blei in den Kugeln hat das Blei in den Setzkästen die Welt verändert.«
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Gleichwohl entwickelte sich die »Schwarze Kunst«, die Johannes Gutenberg aus der Taufe gehoben hatte, in rasantem Tempo weiter: Gab es im späten 15. Jahrhundert in Europa erst einige Dutzend Druckereien, waren es im Jahr 1500 schon etwa tausend. Die Ausbreitung des Buchdrucks war maßgeblich und grundlegend für die Verbreitung neuer Ideen in der Gesellschaft – und sie ist an deren Auflagenhöhen messbar: So sollen anno 1521 bereits eine halbe Million Nachdrucke der lutherschen Schriften im Umlauf gewesen sein. Die spätere Bibelübersetzung hatte 1523 eine Auflage von 5000 Exemplaren erreicht, 15 Jahre später umfasste sie schon 200000. Damit war die Reformation die erste Auseinandersetzung der Weltgeschichte, die von der Publizistik entscheidend bestimmt wurde.
Der Buchdruck war zur rechten Zeit gekommen: Im 15. Jahrhundert förderten vor allem neue wissenschaftliche und religiöse Ansichten und Erkenntnisse seine Verbreitung. Nun wurden nicht mehr nur Schriften, die der Obrigkeit nach dem Mund redeten, veröffentlicht. Auch kritische Gedanken fanden ihren Weg in eine breitere Öffentlichkeit: Neben Protestantismus und Reformation ist auch die Aufklärung ohne diese Möglichkeit, Texte schnell und einfach zu vervielfältigen, undenkbar. Die Bürgerschaft, die sich schrittweise emanzipierte, und ein weit verbreiteter Wunsch nach geistiger »Neuorientierung« führten zu einem gesteigerten Informationsbedürfnis. Die allgemeine Bildung erfuhr ebenfalls einen Aufschwung: Waren Lesen und Schreiben lange Zeit kleinen, hauptsächlich geistlichen Eliten Vorbehalten gewesen, musste jetzt, wer informiert sein wollte, das Lesen lernen. Gutenbergs Erfindung eröffnete Chancen, die man nutzen wollte. Im Zuge dessen wurde auch die zeitgenössische Dichtung von ihren mittelalterlichen Fesseln befreit: Hans Sachs, Ulrich von Hutten und William Shakespeare konnten so ihre Werke einem breiteren Publikum zugänglich machen, das ihnen ohne die Erfindung Gutenbergs versagt geblieben wäre. Alles in allem ist die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern epochal: Wie kaum eine andere Entwicklung repräsentiert sie das Ende des Mittelalters, hat sie die Welt verändert. Gutenberg selbst profitierte davon zu Lebzeiten wenig. Die Verehrung seiner Person setzte erst im 18. / 19. Jahrhundert ein: In seiner Heimatstadt errichteten ihm die Bürger 1837 ein Denkmal. Und heute wissen wir: Als »Mann des Jahrtausends« wird Gutenberg auch in Zukunft als Wegbereiter von Aufklärung und moderner Kommunikation geehrt werden – und das nicht nur in Deutschland.
»Diese Erfindung ist das größte Ereignis der Geschichte, die Mutter allen Umsturzes, eine Erneuerung menschlicher Ausdrucksmittel von Grund auf.«
VICTOR HUGO