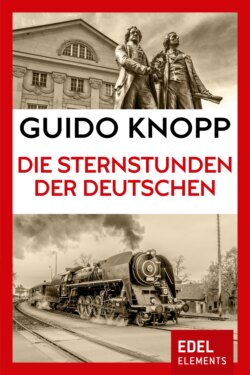Читать книгу Die Sternstunden der Deutschen - Guido Knopp - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
955 Sieg auf dem Lechfeld
ОглавлениеEs war die »Stunde null« der deutschen Geschichte. Am 10 . August des Jahres 955 standen sich auf dem Lechfeld bei Augsburg 12 000 ungarische Steppenreiter und 12 000 Krieger aus Franken, Bayern, Böhmen und Schwaben gegenüber. Mehr als fünfzig Mal waren die Magyaren schon ins Ostfränkische Reich eingefallen, hatten Städte zerstört, geraubt und gemordet. Auf dem Lechfeld riskierte König Otto I. alles: sein Leben und seine Krone – und seinen Traum.
Karl der Große – das war das Maß, mit dem Otto sich messen wollte, die Tradition, in welcher er sich selbst sah. Den Anspruch auf die Kaiserkrone hatte er 19 Jahre zuvor in Aachen vor aller Welt verkündet. Er war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 23 Jahre alt gewesen. In diesem bis dahin feierlichsten und bedeutsamsten Moment seines jungen Lebens krönten ihn, einen Sachsen, die Fürsten aus Bayern, Schwaben, Franken und Sachsen zum »Rex Francorum«, zum König der Franken. Im Gegensatz etwa zum König von Frankreich, der die Königswürde ererbte, konnte Otto I. nur durch die Wahl der Fürsten seine Krone erlangen. Und so würde es auch bleiben – bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806.
Einen »deutschen« König oder gar »König der Deutschen« hatte es vor ihm noch nicht gegeben. Und dass die germanischen Stämme sich einmal zu den »Deutschen« zusammenfinden würden, daran dachte in diesen Tagen niemand. Doch bevor Otto ein Weltreich erschaffen konnte, musste er sich zunächst auf dem Thron der Ostfranken behaupten – mit dem Schwert und gegen Mitglieder seiner eigenen Familie. Da waren Ottos Brüder Thankmar und Heinrich, die ihre Ansprüche geltend machen wollten. Als sie besiegt waren, verbündete sich 954 ausgerechnet Ottos Sohn Liudolf hinter dem Rücken des Vaters mit den Ungarn, um den Regenten vom Thron zu stoßen. Im Roßtal bei Regensburg kämpften die zwei mit ihren Männern gegeneinander, Auge um Auge, um Leben und Tod. Der König gewann. Allein, barfuß und im Büßergewand, musste sich Liudolf dem Vater unterwerfen. Otto ließ Milde walten und schloss den abtrünnigen Sohn wieder in die Arme. Doch alle anderen Anführer ließ er hinrichten.
Während die Familienstreitigkeiten damit beigelegt worden waren, nutzten die Ungarn das vermeintliche Machtvakuum und verwüsteten erneut das Land. Otto wusste, dass es kaum möglich war, den Feind in einen offenen Kampf zu zwingen. Die Ungarn führten keine gewöhnlichen Kriegszüge mit großen, schwerfälligen Armeen, sondern kämpften nach Art der Hunnen vom Pferderücken aus und verließen sich auf die Kunst ihrer legendären Bogenschützen. Doch im Gefühl der eigenen militärischen Überlegenheit begingen die Angreifer dieses Mal einen entscheidenden Fehler: Sie ließen sich auf eine offene Feldschlacht ein. Anfang August erreichten die ersten Nachrichten den König, dass die Steppenreiter von ihrer Taktik der schnellen Raubzüge abgelassen hätten und nun Augsburg belagerten.
»Die Feinde Gottes und der Menschen haben das Volk gefangen oder getötet, noch triefen die Straßen vom Blut«, klagte Otto. Waren die heidnischen Magyaren nicht eine Naturgewalt wie Hagel und Sturm, gegen die man nichts ausrichten konnte? Oder konnte man sie sich vielleicht doch mit Tributen vom Leib halten, wie es viele Fürsten taten? Sollte Otto wirklich alles aufs Spiel setzen und gegen die gefürchteten ungarischen Bogenschützen auf ihren schnellen und wendigen Pferden auf offenem Felde in den Krieg ziehen?
»Die Ungarn zündeten Burgen und Städte an und richteten überall ein solches Blutbad an, dass eine totale Entvölkerung drohte.«
CHRONIK WIDUKIND VON CORVEYS
Otto entschloss sich zur Tat. Doch anstatt sich den Ungarn entgegenzustellen, umging er sie, um ihnen den Rückzug an die Donau abzuschneiden. Es war ein großes Risiko, denn durch die Konzentration seiner Truppen stand das ganze Land den magyarischen Reitern offen – bis hinauf nach Sachsen und bis zum Rhein. Otto wusste, er würde alle Kräfte mobilisieren müssen, um zu siegen. Auch die »himmlischen«. Er sei ein Großer im Beten, hieß es damals über ihn. Tief in der Kultur des Mittelalters verwurzelt, bat er um himmlischen Beistand für die Schlacht gegen den heidnischen Feind. Aus diesem Grund führte er auch eine »Wunderwaffe« des Mittelalters mit sich, die »Heilige Lanze«. Zusammen mit dem Reichsapfel, dem Zepter und der Reichskrone zählte sie zu den Reichsinsignien und war eine der bedeutendsten Reliquien der Christenheit. Der Legende nach hatte ein römischer Legionär mit der Lanze Christus am Kreuz die Seite geöffnet, um zu prüfen, ob er auch tot sei. Auch sollte in die Lanzenspitze ein Nagel vom Kreuz Christi eingearbeitet sein.
»Vor den Pfeilen der Ungarn beschütze uns, o Herr«, hieß das Gebet von Otto und seinen Kriegern. Sie waren gut gerüstet. Ihre Helme, Kettenhemden, Arm- und Beinschienen sowie schwere eisenbeschlagene Holzschilde schützten sie vor dem mörderischen Pfeilhagel der Steppenreiter. Zuletzt kamen Otto auch noch die Naturgewalten zu Hilfe: Ein schweres Sommergewitter ging über dem Lechfeld nieder und machte die hölzernen Bögen der Ungarn unbrauchbar. Erbarmungslos wurden sie nun von Ottos Truppen niedergemacht. Kein Magyare sollte lebend in seine Heimat zurückkehren. Denn zu oft waren sie ins Land eingefallen. Es sollte das letzte Mal gewesen sein – und es war das letzte Mal. Viele der Gefangenen wurden geköpft oder gehenkt.
Nicht nur für Otto war die blutige Schlacht auf dem Lechfeld ein entscheidender Wendepunkt. In der Pannonischen Tiefebene entlang der Donau wurden die ungarischen Steppenreiter, die über Jahrzehnte von ihren kriegerischen Raubzügen durch Europa gelebt hatten, sesshaft. Und sie traten unter ihrem ersten König Stephan sogar zum Christentum über.
Otto hatte viel gewagt und viel gewonnen. Hätte der König mit seinem Aufgebot nicht den Sieg erkämpft, die deutsche Geschichte hätte wohl einen ganz anderen Verlauf genommen. Angesichts der tödlichen Bedrohung durch eine Macht von außen gelang es Otto I. auf dem Lechfeld zum ersten Mal, den bis dahin lockeren Verband der Stämme zusammenzuschmieden. Unter den Stämmen der Bayern, Franken, Schwaben und Sachsen festigte sich erstmals in der Geschichte das Gefühl, einer Gemeinschaft anzugehören.
Für den Sieg auf dem Lechfeld erhielt Otto schon zu Lebzeiten den Beinamen »der Große«. Und das christliche Europa sah in ihm den »Retter der Christenheit«. Nun schien die Zeit reif, die Nachfolge Karls des Großen als Kaiser anzutreten. Die Kaiserkrone erhielt man nur aus der Hand des Papstes in Rom. Mit einem Gefolge von über tausend Kriegern aus allen Stämmen überquerte Otto der Große im August 961 die Alpen. Im Januar 962 hielt er Einzug in Rom. Die Römer allerdings waren nicht gerade erfreut. Wer wollte schon einen Sachsen als Herrscher über das Land? Noch am Grabe des Apostels Petrus, unter den Augen des Papstes, musste Otto um sein Leben fürchten. Und er ahnte, ohne Gegenleistung war die Kaiserkrone nicht zu haben. Im geheimen Archiv des Vatikans in Rom liegt eine der wichtigsten Urkunden des Mittelalters, das »Ottonianum«, ein Vertrag zwischen dem Oberhaupt der Christenheit und dem ostfränkischen König. Darin garantierte Otto als Schutzherr der Kirche dem Papst die weltliche Herrschaft über den Kirchenstaat, den es im Kleinen als Vatikanstaat noch heute gibt.
Am 2. Februar 962 krönte Papst Johannes XII. Otto den Großen zum Kaiser – mit der Reichskrone, die heute noch in Wien zu besichtigen ist. Mit der überaus kostbaren Arbeit in Edelstein, Gold und Silber trug Otto sein Selbstverständnis offen zur Schau. So zeigen einige Bildplatten Könige aus dem Alten Testament, die sich Otto zum Vorbild nahm: König David steht für den »ehrenhaften König, der den Rechtsspruch liebt«; der weise König Salomo für »Gottesfurcht und Gerechtigkeit«; und die »Majestat-Domini-Platte« zeigt Christus mit dem Spruchband: »Per me reges regnant, durch mich regieren die Könige.«
Jetzt hatte Ottos Imperium europäische Dimensionen, es umfasste Germanien und Italien. Dem Herrscher und seiner Gefolgschaft aus dem kühlen Norden gefiel es in »Bella Italia« ausnehmend gut. Hier blühten die Zitronen, die Frauen waren rassig, der Wein war nicht so sauer wie da heim. Politisch indes herrschte kaum eitel Sonnenschein. Um die Herrschaft über Italien zu sichern, führte Otto jahrelang Krieg – gegen italienische Fürsten, gegen die Araber, die Normannen und schließlich gegen Byzanz. Am Ende blieb Kaiser Otto der Große mit Tausenden Gefolgsleuten fünfzehn lange Jahre im Land. Als Sachsen, Schwaben, Franken und Bayern waren sie einst gekommen. »Teutonen« oder »Tedeschi« ,die »Deutschen«, wurden sie in Italien genannt. Mit diesem Namen kehrten sie in ihre Heimat zurück.
»Durch den herrlichen Sieg mit Ruhm beladen, wurde der König von seinem Heer als Vater des Vaterlandes und als Imperator, als Herrscher über die Völker begrüßt. Denn solch eines Sieges hatte sich kein König vor ihm in zweihundert Jahren erfreut.«
CHRONIK WIDUKIND VON CORVEYS
Das Osterfest des Jahres 973 feierte Otto wieder in Sachsen. Zum Hoftag in Quedlinburg kamen Gesandte aus ganz Europa, um ihm zu huldigen. Nur wenige Wochen später, am 7. Mai des Jahres 973, starb Otto der Große. Was er erreichen wollte, hatte er erreicht. Die monarchische Macht der Ottonen war gefestigt, das werdende Reich hatte erste Konturen angenommen. Und aus Italien brachte Otto nicht nur die Kaiserkrone, sondern auch einen Sammelnamen für die Vielzahl der altgermanischen Stämme mit: »Die Deutschen.«