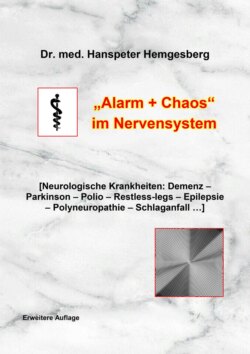Читать книгу Neurologische Krankheiten - Hanspeter Hemgesberg - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Therapie
ОглавлениеFakt Nr. 1:
Bis zum heutigen Tage gibt es in der gesamten Medizin (aller „Ausrichtungen“ in der Schul- und der Biologisch-naturheilkundlichen Medizin) keine primär und somit kausal wirksame arzneiliche und nicht-arzneiliche Therapie zur kausalen Behandlung einer Alzheimer-Demenz und schon überhaupt nicht, um diese Krankheit zu heilen!“
Fakt Nr. 2:
Menschen mit einer Alzheimer-Demenz könnten länger selbständig leben, wenn ihre Krankheit so früh wie möglich diagnostiziert und umgehend einer Behandlung zugeführt würde.
Der Schlüssel zur längeren Selbständigkeit heißt „Früherkennung“!
Dazu als „Faustregel“:
Auch ein bisschen verwirrt ist ein bisschen zu viel.
Spätestens dann, wenn ‚verdächtige Anzeichen‘ sechs Monate unverändert anhalten, sollten Betroffene von sich aus einen Arzt aufsuchen oder die Angehörige sollten mit dem ‚Patienten‘ einen Arzt aufsuchen und dort eine zielführende Untersuchung durchführen lassen (unmittelbar auf den Patienten bezogen und/oder als Test für Angehörige).
Fakt Nr. 3:
Wenngleich es bis heute keine Behandlung gibt, die Alzheimer-Krankheit zu heilen oder zum Stillstand zu bringen, so gibt es dennoch – zumindest in der Anfangszeit der Krankheit und bei nicht wenigen Patienten sogar über eine längere Zeit – für den Kranken ein alles-in-allem „lebenswertes Leben“. Die Beschwerden lassen sich mit einer passenden Behandlung lindern, der Verlauf der Krankheit kann verzögert werden.
Auf den Verlauf der Krankheit abgestimmt kommen bei der Therapie der Alzheimer-Demenz Medikamente ebenso zum Einsatz wie nicht-medikamentöse Behandlungs-Maßnahmen.
Mittlerweile werden diese als gleichrangig mit medikamentöser Therapie angesehen.
Wie schon das Procedere bei der Alzheimer-Diagnostik, so sollte auch die Therapie bei einer diagnostisch gesicherten Alzheimer-Krankheit sich weitgehend orientieren an den aktuellen Leitlinien „Demenz“ der DNG.
Arzneiliche (chemisch-definierte) Therapie bei M. Alzheimer
(Demenz vom Alzheimer-Typ)
Ziele der medikamentösen Therapie sind:
Linderung/Ab-Milderung der Alzheimer-Symptome und -Defizite und die Behandlung möglicher Begleiterkrankungen.
Ferner soll die geistige Leistungsfähigkeit der Patienten verbessert und ihre Alltagsbewältigung erleichtert werden; zudem sollen mögliche Verhaltens-Auffälligkeiten oder Depressionen gemildert werden.
Es gilt:
Um den unterschiedlichen Phasen einer Alzheimer-Demenz bzw. den Schweregraden gerecht zu werden, ist es wichtig, die medikamentöse Behandlung kontinuierlich durch den behandelnden Arzt kontrollieren und anpassen zu lassen. Auch die Angehörigen sind gefragt, wenn es darum geht, die regelmäßige Einnahme der Medikamente im Blick zu behalten.
Die Basistherapie der Alzheimer-Demenz sieht derzeit drei Arten von Wirkstoffen vor: Antidementiva, Neuroleptika und Antidepressiva.
Darüber hinaus können hirnleistungsfördernde Wirkstoffe wie Ginkgo biloba zum Einsatz kommen.
1. Antidementiva
= chemisch definierte Arzneistoffe, die zur Therapie bei Demenzen eingesetzt werden; sie zählen zu den sogen. „Nootropika“.
Zu unterscheiden sind: a) Acetylcholinesterase-Inhibitoren (Hemmer) und b) NMDA-Antagonisten (NMDA = N-Methyl-D-Aspartat / Gegenspielern am NMDA-Rezeptor – dieser zählt zu den Glutamat-Rezeptoren)
Antidementiva werden gegen die Haupt-Symptome der Alzheimer-Krankheit eingesetzt.
[Ind: kognitive Einbußen, Verzögerung der Krankheitsverlaufs]
Zurzeit in Deutschland zur Behandlung zugelassen sind folgende Antidementiva:
I. Acetylcholinesterase-Hemmer
a. Donezepil (u.a. Aricept®)
b. Rivastigmin (u.a. Exelon®)
c. Galantamin (u.a. Reminyl®)
Ind: leicht- bis mittelgradige Alzheimer-Demenz
II. NMDA-Antagonisten
(N-Methyl-D-Aspartat-Antagonist, NMDA-Rezeptor-Antagonist // z.B. Ketamin, Dextromethorphan [DXM], Opioide wie Tramadol, Methadon)
d. Memantine (u.a. Axura®)
Ind: mittelschwere & schwere Alzheimer-Krankheit
2. Neuroleptika
[Synonym: Antipsychotikum = chemisch-definierte Arzneistoffe, welche „psychotrope“ (anti-psychotische), „neurologische“ (insbes. extrapyramidal-motorische) und „andere“ (u.a. endokrine, kardiale, metabolische) Wirkungen/ Neben-Wirkungen hervorrufen].
Ind: manische Psychosen, Schizophrenie, psychomotorische Erregungszustände,
chronische Schmerzen (adjuvant), als Prämedikation bei Neurolept-Analgesie und -Anästhesie oder auch als Antiemetika.
Zu unterscheiden sind
a) Konventionelle Neuroleptika wie 1. Trizyklische Neuroleptika, 2. Butyrophenone, 3. Diphenylbutylpiperidine,
b) Atypische Neuroleptika wie: 4. Dibenzepine, 5. Benzisoxazol-, Benzisothiazol- und Indol-Derivate, 6. Benzamide und 7. Weitere Neuroleptika
Neuroleptika werden gegen Begleit-Symptome der Alzheimer-Krankheit
eingesetzt.
[Ind: Beruhigung, antipsychotische Wirkung; Schlafstörungen]
Vorsicht: Nebenwirkungen unbedingt beachten!
(d.h. Anwendung nur dann, wenn „Benefit“ für den Patienten erreicht wird!)
Wichtig::
Unter Neuroleptika-Therapie kommt es öfters zur deutlichen Progredienz der Alzheimer-Demenz!
Die Behandlung mit Neuroleptika führt auch zu einer dosis- und zeitabhängigen Veränderung der Gehirnstruktur und einer Verringerung des Volumens verschiedener Strukturen des Gehirns und der Hirnrinde. Auch die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu begreifen und neue Informationen zu verarbeiten, kann durch Neuroleptika negativ beeinflusst werden.
z.B.:
a. Trizyklische Neuroleptika
[u.a. Chlorpromazin, Triflupromazin, Levomepromazin, Perazin, Perphenazin,
Fluphenazin, Flupentixol …]
b. Butyrophenone
[u.a. Halopertidol, Benperidol, Droperidol, Melperon, Pipasmperon …]
1. Diphenylbutylpiperidine
[u.a. Pimozid, Fluspirilen, …]
2. Dibenzepine
[u.a. Clozapin, Olanzapin, Quetiapin, …]
3. Benzisoxazol-, Benzisothiazol-, Indol-Derivate
[u.a. Risperidon, Ziprasidon, Sertindol, Iloperidon …]
4. Benzamide
[u.a. Sulpirid, Amisulprid, Tiaprid]
3. Antidepressiva
[= chemisch-definierte Arzneistoffe, die primär zur Therapie von Depressionen eingesetzt werden]
Eingeteilt werden die Antidepressiva in:
1. Trizyklische Antidepressiva,
2. Tetrazyklische Antidepressiva,
3. Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI),
4. Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SNRI),
5. Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (NARI),
6. Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer),
7. Atypische Antidepressiva und
8. Sonstige Antidepressiva
Die sich ändernden Lebensumstände sind für Menschen mit Alzheimer nicht
leicht zu akzeptieren. Eine Depression kann die Folge sein.
[Ind: Depression bei Alzheimer-Demenz]
Hinweis:
Die anzuwendenden Wirkstoffe sollten unbedingt einen „Benefit“ für den Kranken haben!
Empfehlung:
Als am effektivsten und zugleich Nebenwirkungs-ärmsten hat sich eine zumindest zeitweise Behandlung mit sogen. „Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern“ (SSRI) zur Behandlung von Depressionen bei Alzheimer-Demenz herausgestellt.
z.B.:
a. Fluoxetin
b. Citalopram
c. Escitalopram
d. Fluvoxamin
e. Paroxetin
f. Sertralin
4. Hirnleistungsfördernde Maßnahmen (Nootropika)
[Ind: Verbesserung der Hirnfunktionen & Hirnleistungen]
Hinweis:
Hinsichtlich der Wirksamkeit der Nootropika wird in der Wissenschaft nach wie vor äußerst kontrovers „Pro + Contra“ diskutiert; sprich Wirksamkeit bei Alzheimer oder keine!
Wenn mit solchen Nootropika therapiert wird, dann einzig mit standardisierten, normierten hoch- bis höchst-dosierten Präparaten.
Zu beachten:
Angezeigt allenfalls bei leichten bis mittelschweren kognitiven Defiziten!
Nicht geeignet zur Prävention!
Empfehlung:
1. Ginkgo-biloba-Extrakt
z.B. Tebonin konzent® 240mg (W. Schwabe)
(Ds: 2-2-0 tgl)
2. Phospholipide
a. Phosphatidyl-Serin
z.B. Phosphatidyl-Serin (VitaBasix)
= standardisiertes Phosphatidyl-Serin-Präparat auf pflanzlicher Basis
(Ds:je 1 Morgen- und 1 Abend-Kps)
b. Phosphatidyl-Cholin
z.B. CPD-Cholin (Ceraxon®) (Trommsdorff)
= standardisiertes Cytidin-5’-Diphosphocholin
(Ds: 2-4 Btl. Tgl)
! Neue(re) Alzheimer-Medikamente !
Neue Alzheimer-Medikamente in Entwicklung
Die Entwicklung neuer wirksamer Alzheimer-Medikamente hat bei den Pharmaunternehmen seit vielen Jahren hohe Priorität. Allerdings haben die letzten Jahre fast ausschließlich Misserfolge gesehen:
Etliche Arzneien/ Medikamente haben sich in der Erprobung mit Patienten nicht bewährt und ihre Entwicklung musste eingestellt werden.
Trotz dieser ernüchternden Bilanz werden auch weiterhin Alzheimer-Medikamente in klinischen Studien erprobt. 14 Medikamente mit neuen Wirkstoffen und 3 mit schon für andere Zwecke zugelassenen Wirkstoffen haben das letzte Stadium der klinischen Erprobung (Phase III) erreicht und könnten in einigen Jahren die Zulassung erlangen, wenn sie sich bewähren.
Dazu kommen zahlreiche Medikamente in den Phasen II (Erprobung mit wenigen Kranken) und Phase I (Erprobung mit Gesunden).
Eine wichtige Erkenntnis aus den Studien der letzten Jahre ist, dass die Behandlung wohl sehr frühzeitig begonnen werden muss, wenn sie noch wirksam ins Krankheitsgeschehen eingreifen soll, also nicht erst, wenn die Alzheimer-Symptome schon ausgeprägt sind.
Die Medikamente in Entwicklung greifen an verschiedenen Stellen in den Krankheitsprozess ein. Die Alzheimer-Medikamente, die bereits die letzte Erprobungsphase mit Patienten (Phase III) erreicht haben, bietet die folgende Auflistung (Stand: 17.07.2018):
Zuerst die sogen.
„Passiv-Impfung“ gegen Alzheimer-Demenz
[Passive Immunisierung gegen Alzheimer-Demenz]
Die am weitesten fortgeschrittenen Medikamente dieser Art enthalten künstlich hergestellte Antikörper (monoklonalen Antikörper), die sich an Beta-Amyloid-Protein heften und dieses so „markieren“. Das Immunsystem baut das markierte Protein dann ab. Der Raum zwischen den Nervenzellen wird dadurch gereinigt. Dieser Ansatz wird auch „passive Immunisierung gegen Alzheimer-Demenz“ oder (nicht ganz exakt)
„Passivimpfung gegen M. Alzheimer“.
D.h.: Anwendung von monoklonalen humanen Antikörpern []:
a. Solanezumab
= humaner monoklonaler IgG-1-Antikörper (mAK) / fördert den Abbau der Amyloid-Plaques
Aber:
Neuer Alzheimer-Wirkstoff Solanezumab gescheitert!
Das US-Pharmaunternehmen Eli Lilly hat die Endergebnisse zu einer großen Studie mit dem Wirkstoff Solanezumab veröffentlicht. Die Auswertung der Phase-3-Studie mit 2100 Probanden im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit ist ernüchternd. Die Probanden, die mit Solanezumab behandelt wurden, hatten keinen signifikanten Vorteil in Gedächtnistests gegenüber der Placebogruppe.
b. Gantenerumab
= humaner monoklonaler IgG-1-Antikörper (mAK) / fördert den Abbau der Amyloid-Plaques
Hinweis:
Roche will seinem Alzheimer-Medikament Gantenerumab eine neue Chance geben. Nachdem das Mittel im Jahr 2014 in einer Studie-III gescheitert war.
c. Aducanumab
= humaner monoklonaler IgG-1-Antikörper (mAK) / fördert den Abbau der Amyloid-Plaques
Aktuell laufen Studien Phase-III.
Weitere Wirkstoffe in Phase III:
d. AZD3293 (LY3314814) (Amaranth®)
= ein Beta-Sekretase-Hemmer (BACE) / dadurch wird Bildung von Amyloid-Plaques verhindert
e. Nilvadipin (Nivadil®)
= Kalzium-Kanal-Antagonist; in der Hochdruck-Therapie etabliert / der Wirkstoff entfernt Amyloid-Plaques
f. MK-8931(Verubecestat)
= Beta-Sekretase-Hemmer (BACE 1 und 2) / dadurch wird Bildung von Amyloid-Plaques verhindert
g. Mastinib
= ein Tyrosinkinase-Hemmer
h. Leuko-Methylthioninium
= hemmt die Verklumpung (Aggregation) von Tau-Protein-Fibrillen
i. Caprylat-Triglycerid (Caprylic-Triglyceride)
= mittelkettige Triglyceride aus Kokos-Öl = Energiequelle für das Gehirn, bes. für den Glucose-Stoffwechsel im Gehirn
j. Idalopirdin
= potenter, selektiver 5-HT6-Rezeptor-Antagonist (5-HT6 = Subtyp des 5-HT-Rezeptors) – der den endogenen Neurotransmitter Serotonin (=5-HT = 5-Hydroxy-Tryptamin) bindet –. HT-Rezeptor 6 bezeichnet das menschliche Gen, das für den Rezeptor codiert. Die Substanz wirkt nicht nur antidepressiv i.S.e. Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmers (SSRI), sondern pos. bei bestehenden kognitiven Defiziten und ferner konnte mit dem Wirkstoff eine Verbesserung von Alltags-Funktionen von Alzheimer-Kranken erreicht werden.
Vielfach auch n Kombination mit
k. Donezepil (Aricept®)
= Nootropikum (Neuroleptikum; s.o.) = reversibler Acetylcholin-Esterase-Blocker (= hemmt den Abbau von Acetylcholin und steigert dadurch die ACh-Konzentration im ZNS); dadurch Verbesserung der kognitiven Leistungen von Alzheimer-Kranken
l. AVN-211
= hochselektiver 5-HT-Rezeptor-6-Antagonist (5-HT = 5-Hydroxytryptamin = Serotonin) / hat prokognitive Wirkungen
m. Encenicline (Nuedexta®)
= selektiver, partieller Antagonist des alpha-7-Nikotinsäure-Rezeptors – dadurch Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten
n. SK-PC-B70M
(aus der Pflanze Pulsatilla koreana = koreanische Kuhschelle)
= Ölsäure-Glycosid-Steroid (enthalten in der Pflanze) / hat antioxidative Wirkung / reduziert den Beta-Amyloid-Spiegel im Gehirn
o. Azeliragon
= ein sogen. „Small Molecule/Niedermolekulare Verbindung“ (d.i. eine Gruppe von Wirkstoffen, deren Molekülmasse einen bestimmten Wert nicht überschreitet) / es hemmt den Rezeptor für Advanced Glycation End products („AGE“), daher genannt „RAGE“ / RAGE gehört zur Familie der Immunglobulin-Supergene / offenbar trägt das „Schlüssel-Protein“ RAGE maßgeblich zur Entstehung von Nervenschäden bei
p. Pioglitazon (Actos®)
= ein Insulin-Sensitizer (Ind. orales Diabetes mellitus-Typ-2 Medikament) / Forscher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE, Bonn) haben festgestellt, dass der Wirkstoff bei damit behandelten Diabetes-Kranken das Risiko für eine Demenz-Erkrankung, insbes. für die Alz-heimer-Demenz senkt
q. Roflumilast (Daxas® 500µg)
= Phosphodiesterase-4-Hemmer (PDE-4-Hemmer) {Ind. zugelassen zur Behandlung bei COPD = Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung und Asthma Bronchiale} / PDE-4-Hemmer haben aber zudem eine Wirkung auf das ZNS und zwar bzgl. einer Verbesserung kognitiver Defizite und zur Wiederherstellung von Speicherfunktionen bei Demenz-Kranken
r. Albutein® 50 g/l (i.v.-Infusionslösung)
(= humanes Albumin)
{Arzneimittel gehört zur Gruppe der Plasma-Ersatzmittel und Plasma-Protein-Fraktionen / Ind: Blutverlust}
Zurzeit Studie Phase III zur Verbesserung von Hirnfunktionen bei Demenz/ Alzheimer
Dazu kommen Medikamente, die die psychotische Begleit-Symptome lindern sollen, wie sie manche Alzheimer-Patienten zeigen; sie sind gegen andere Krankheiten schon zugelassen (Stand: 05.06.2014):
s. Brexpiprazole (Rexulti®)
= partieller Dopamin-D2-Rezeptor-Agonist = Chinolonderivat (= Nachfolger von Aripiprazol {Aripriprex®}) (Ind: Add-on-Therapie {Zusatztherapie} bei Depressionen + Schizophrenie) = Wirkstoff aus der Gruppe der atypischen Neuroleptika / wirkt bei Alzheimer Aufmerksamkeits- & Aktivitäts-steigernd und Verhaltensweisen stabilisierend
t. Aripiprazole (Aripridex®)
= Wirkstoff aus der Gruppe der atypischen Neuroleptika (Ind: Schizophrenie, Bipolare Störungen, Prävention manischer Episoden) = partieller Dopamin-D2-Rezeptor-Agonist = Chinolonderivat / Wirkung wie Brexpiprazole
Stammzell-Therapie beim M. Alzheimer
Immer wird in der letzten Zeit von einer hilfreichen + wirkungsvollen „Therapie mit Stammzellen“ [] – eigenen = autologen Knochenmarks-Zellen – bei Demenzen, so auch bei der Alzheimer-Krankheit, gesprochen. Insbesondere wird eine solche Behandlung – eine sehr teure zudem – von Privatkliniken angeboten.
Stammzellen sind gegenwärtig regelrecht „in“!
Sie werden zur Behandlung angeboten bei den unterschiedlichsten – hierbei auch neurologischen bzw. neuro-degenerativen Krankheiten wie Multiple Sklerose (MS), Amyotrophische Lateralsklerose (ALS) und eben auch bei den verschiedenen Demenz-Krankheiten – Krankheiten.
Die DGN (Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V.) warnt eindringlich vor ungeprüften (und teuren) Stammzell-Behandlungen bei neurologischen und neuro-degenerativen Erkrankungen des Menschen außerhalb seriöser klinischer Studien.
Stand heute ist zwar, dass Stammzellen in vielen internationalen Studien getestet werden, bis heute liegen aber keine Daten vor, die eine Anwendung von Stammzellen bei Demenzen rechtfertigen!
Dieser Ansicht schließe ich mich uneingeschränkt an.
An dieser Stelle soll aber bereits hingewiesen werden auf eine absolut ungefährliche und sichere Methode i.S.e. „Biologischen Stammzell-Behandlung“ (s.u.).
Nicht-Arzneiliche Therapien bei Alzheimer-Demenz
Nicht-medikamentöse Therapien können helfen, die Teilnahme der Demenz-Kranken am gesellschaftlichen Leben so lange wie möglich aufrecht zuerhalten, positive Auswirkungen auf die Gemütslage sind ebenfalls dokumentiert.
Bei den emotions-orientierten Therapieansätzen wie der Valadiktion [] stehen die die Wertschätzung der Gefühle und der Erlebenswelt des Patienten sowie die Mobilisierung noch vorhandener Ressourcen im Mittelpunkt.
Die Kommunikation bezieht sich weniger auf die Faktenerinnerung, sondern zunehmend auf die subjektive Erinnerung, Sichtweise und Wahrnehmung des Patienten. Auch die Umgebung spielt hier eine Rolle, so wird zunehmend die Herkunft der Patienten bei der Gestaltung der Räumlichkeiten und Aktivitäten berücksichtigt.
Sinnes- und Bewegungs-bezogene Ansätze zielen mit Hilfe der multi-sensorischen Stimulation sowohl auf Veränderungen im Verhalten, in der Interaktion und Kommunikation mit anderen, sowie im Erleben der Betroffenen ab.
Der Schlaf-Wach-Rhythmus kann durch eine strukturierte soziale Aktivierung und familien-ähnliche Ess-Situationen verbessert werden.
Einen besonderen Stellenwert nimmt das Training des Pflegepersonals und der pflegenden Angehörigen ein.
Das Verständnis für die Defizite von Demenzpatienten soll hier ebenso geschult werden wie das Fördern noch vorhandener Ressourcen und die Verbesserung kommunikativer Fähigkeiten seitens der Patienten. Durch Angehörigentraining scheint sich die Unterbringung von Demenz-Patienten in einem Pflegeheim deutlich herauszögern zu lassen. In diesem Rahmen werden auch Einzel- und Gruppengespräche eingesetzt, in denen der Informations- und Erfahrungs-Austausch im Vordergrund stehen.
Die „gängigsten“ nicht-arzneilichen Therapien bei/für eine Alzheimer-Demenz:
I. Verhaltenstherapie
Ein psychotherapeutisches Verfahren für Demenzkranke im Frühstadium. Wird eingesetzt zur Bewält-igung von Angst, Wut oder Depressionen. Betreuer werden geschult, selbstständiges Verhalten durch positive Zuwendung zu fördern.
II. Physiotherapie
Die Bewegungstherapie soll körperlichen Beschwerden entgegenwirken und hat Einfluss auf das Verhalten und die Körperwahrnehmung der Patienten. Hausarzt und Physiotherapeut einigen sich vor Beginn einer Therapie auf ein Therapieziel.
III. Ergotherapie
Die Ergotherapie soll durch funktionelle, spielerische, handwerkliche und gestalterische Techniken die praktischen Alltagshandlungen der Patienten wiederherstellen oder so lange wie möglich erhalten. Besonders gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die Therapie im häuslichen Umfeld stattfindet.
IV. Gedächtnis-Stimulation
Für Patienten im leichten bis mittleren Stadium sehen die Experten einen Nutzen in der kognitiven Stimulation wie z.B. über die Aktivierung von Altgedächtnisinhalten oder die Einbindung in Konversationen.
Dies gilt jedoch nicht für Gedächtnistrainings.
V. Realitäts-Orientierungs-Training
Diese Therapieform unterstützt die räumliche und zeitliche Orientierung der Patienten und ist geeignet für alle Stadien. Den Patienten werden aktiv Informationen zu Zeit und Ort angeboten, jedoch ohne sie zu überfordern.
VI. Biografie-Arbeit oder Erinnerungstherapie
Ein strukturiertes Verfahren, bei dem Erinnerungen des Patienten aktiv wiederaufleben sollen und Erlebnisse aus der Vergangenheit verarbeitet werden. Stützt sich auf das Langzeitgedächtnis und ist (mit Hilfsmitteln wie Fotoalben) oft lange möglich.
VII. Musiktherapie
Gemeinsames Musizieren, Singen und Tanzen gehören in diese Kategorie. Positive Effekte der Behandlung sind auch in späteren Stadien der Alzheimer-Krankheit spürbar, da sich deren Wirkung auf emotionaler Ebene abspielt.
VIII. Tier-gestützte Therapie
Hier kommen ausgebildete Kleintiere, aber auch Hunde oder Schweine zum Einsatz. Der Kontakt mit Tieren soll Patienten aktivieren und die soziale Interaktion fördern, selbst wenn keine verbale Kommu-nikation mehr möglich ist.
IX. Snoezelen und Aromatherapie
Snoezelen (aus dem Niederländischen, sprich: „snuselen“) bezeichnet eine Reihe von Aktivitäten auf der sensorischen Ebene. Dabei kommen Licht, Klang, Berührung, Geschmack oder Duft zum Einsatz. Diese Therapieform ist für jedes Stadium geeignet und hat zumindest geringe positive Effekte auf allgemeine Verhaltenssymptome der Patienten.