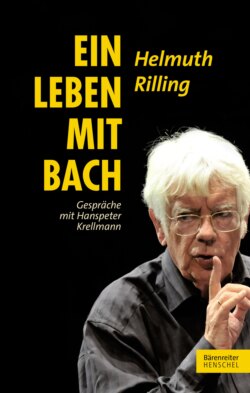Читать книгу Ein Leben mit Bach - Helmuth Rilling - Страница 23
»Das Geld blieb die leidige Frage«
ОглавлениеDie Gäste kosteten Geld.
Das Geld blieb durchgehend die leidige Frage, ich musste immer darum kämpfen. Aber das entwickelte sich. Ich erzähle immer gern eine im Grunde unglaubliche Geschichte: Ein Herr Bernhard Müller, den ich nicht kannte, schrieb mir, ihm hätte der Chor in der letzten Abendmusik sehr gut gefallen, nicht dagegen die Instrumentalisten. Er verstünde diesen Qualitätsunterschied nicht. Meine Antwort war einfach: Der Chor sänge umsonst, bessere Instrumentalisten als die vorhandenen hätten jedoch bezahlt werden müssen. Da dafür kein Geld vorhanden sei, sprängen Freunde, Studenten und Dilettanten aus Freude und ohne Geld ein. Der nächste Brief von diesem Herrn Müller ließ nicht lange auf sich warten. Er fragte mich, welches Stück ich unbedingt aufführen möchte und was das bei erstklassiger Qualität kosten würde. Nach vielem Rechnen antwortete ich beinahe zögernd. Ich nannte Bachs Johannes-Passion und bezifferte die Kosten auf fünfzehntausend Mark, eine für mich damals ungeheure Summe. Wieder kam ein Brief, diesmal mit einem Scheck über fünfzehntausend Mark.
Das klingt heute unglaublich.
Solche großzügigen Leute gab es in der Gemeinde. Aus dieser Zelle entstand allmählich ein Förderkreis, der unsere kirchenmusikalische Arbeit stützte. Und Herr Müller war immer dabei. Als einmal mein schmales Kirchenmusikergehalt an der Gedächtniskirche zur Sprache kam, reagierte Herr Müller mit dem Hinweis, er könne vielleicht helfen. Ab dann erschien am ersten eines jeden Monats an der Tür meiner studentenbudenartigen Kellerwohnung in der Feuerbacher Heide eine Dame: Sie komme vom Verein Zur Erziehung und Förderung e. V. und überbringe mir zweihundert Mark. Das ging über Jahre so; woher das Geld wirklich kam, habe ich nie erfahren – wahrscheinlich von Herrn Müller selbst, und der Verein war nur eine Erfindung. Ich kann von heute aus sagen: Man wurde und wird gewissermaßen zu der Einsicht erzogen, dass offizielle Stellen das, was für eine lebendige Kultur vonnöten wäre, nicht leisten können oder wollen und man infolgedessen auf andere Quellen angewiesen ist.
Sie formulieren das ausgesprochen nachsichtig.
Dabei ist es in meinem Leben zum beherrschenden Thema geworden, immer wieder Menschen zu finden, die bereit waren, nicht bloß zweihundert Mark, sondern ein Vielfaches davon für unsere Arbeit zur Verfügung zu stellen.
Sie hatten sich damit im Stuttgarter Musikleben etabliert. Die Weichen waren zunächst in Richtung Kirchenmusik gestellt. Hatten Sie eigentlich Chordirigieren gelernt, richtig gelernt? Im Rahmen des Schulmusikstudiums wohl eher nicht.
Der dafür damals zuständige Hochschulprofessor in Stuttgart war der weithin bekannte Hans Grischkat. Von heute aus gesehen, hätte ich im Grunde zu diesem Mann sofort Kontakt gefunden haben müssen. Er machte künstlerisch das, was mich als Jugendlichen brennend interessiert hatte. In Reutlingen führte Grischkat mit seinem Singkreis Bachs Oratorien auf. Die fanden wir Seminaristen, siebzehn-, achtzehnjährige Jungen, unglaublich. Wir sind mit unseren Rädern vom Seminar Urach zu den Konzerten gefahren und waren begeistert. Aber mit Grischkat als Lehrer in Stuttgart kam ich nicht zurecht. Er lag mir schon als Typ nicht. Er trug Schillerkragen, im Sommer wie im Winter, alltags in Grau, bei Konzerten in Schwarz.
Er kam aus der Jugendbewegung …
Ja, aus der damit verbundenen Singbewegung. Und daher rührte seine grundlegende Abneigung gegen die gesamte Chormusik der Romantik. Sie sei schlecht, sei ein Fehler, argumentierte er, dürfe nicht gesungen werden. Brahms’ und Mendelssohns Musik bezeichnete er als Gefühlsduseleien. Bruckner akzeptierte er als Ausnahme.
Immerhin die Musik eines zutiefst katholischen Komponisten.
Er empfand die Existenz der Gächinger Kantorei als unnötig, wie er offen sagte, und er wollte die Mitgliedschaft von Hochschulstudenten in unserem Chor verbieten. Die sollten studieren und nichts sonst. Vielleicht erkannte er auch eine kommende Konkurrenz, die die Gächinger Kantorei später in der Tat darstellte.
Grischkat hat auch das große Verdienst, eine Gesamtaufführung der Bach-Kantaten in der Stuttgarter Stiftskirche zustande gebracht zu haben. Diese hatte man in Stuttgart vorher nie geschlossen gehört. Er besaß zudem als einziger das Aufführungsmaterial zu allen Bach-Kantaten. Das benötigte ich nun und musste mich deshalb als Bittsteller an ihn wenden. Er war so großzügig, meiner Bitte zu entsprechen. Aber wirklich gefördert hat er mich nie. Ich erinnere mich an einen für ihn typischen Vorgang. Ich machte, schon nach meiner Studienzeit, mit den Gächingern einen A-cappella-Abend mit weltlicher Chormusik von Brahms und Mendelssohn. Danach kam er zu mir und sagte: »Herr Rilling, ich muss protestieren. Sie bringen alles das wieder rein, was wir mühsam durch die Hintertüre rausgeschoben haben.«
Haben Sie, vielleicht trotzdem, das Chordirigieren bei Grischkat oder bei wem auch immer gelernt?
Sie wissen, es wird oft gefragt, ob man das Dirigieren im eigentlichen Sinn lernen kann. Ich habe es durch die Praxis mit der Gächinger Kantorei gelernt. Es ist für mich zum Glücksfall geworden, dass ich gleich in meinem ersten Studiensemester Kommilitonen und Schüler der letzten Schulklassen davon überzeugen konnte, dass es schön wäre, gemeinsam zu musizieren. An eine Chorgründung dachte zunächst niemand. Wir kamen in Gächingen zusammen, einem Dörfchen auf der Schwäbischen Alb, wo die mit meinen Eltern befreundete Familie Haberer ihr Haus, eine Art Wochenendbleibe, zur Verfügung stellte. Dort probten, sangen und spielten wir. Wer da mitmachen wollte, musste drei Bedingungen erfüllen: Er musste gut singen, er musste ein Instrument spielen (damit er auch instrumental einzusetzen war), und er musste nett sein, also zu uns passen. Wir studierten anspruchsvolle A-cappella-Werke ein, mit Schwerpunkten auf alter und auf ganz neuer Musik.
Kein Bach, keine Romantik!
Bewusst nicht! Schütz, Schein, Scheidt, andererseits Hugo Distler, Ernst Pepping, Siegfried Reda, Helmut Bornefeld und Johann Nepomuk David – Werke solcher Komponisten bildeten unser Repertoire. Meine vorläufige Entscheidung gegen Bach hatte einzig den Grund: Ich hielt seine Musik für zu schwierig, zumindest vorerst.
Das war Ihre alleinige Entscheidung?
Ich habe das vorgeschlagen, weil ich es für vernünftig hielt. Ansonsten war ich in den Gächinger Anfangszeiten immer einer unter vielen. Wir haben alle Beschlüsse gemeinsam getragen. Ich war Student wie die anderen. Es gab auch andere außer mir, die dirigiert haben. Nach der ersten Gächinger Probenwoche wollten wir die Ergebnisse vorführen. Wir veranstalteten eine Abendmusik in der kleinen Dorfkirche und dankten mit ihr allen Unterstützern, etwa den Dorfbewohnern, bei denen wir zum Teil übernachtet hatten. Danach haben wir beschlossen, uns Gächinger Kantorei zu nennen, obwohl niemand aus Gächingen stammte. Bei dieser Arbeit habe ich für mein Leben gelernt, dass der Dirigent allein, besser gesagt: ich als Dirigent, nichts ausrichten kann ohne das Zusammenwirken vieler Gleichgesinnter. Die gemeinsam getragene künstlerische Meinung stellt eine entscheidende Stärke dar, sie ist höher anzusetzen als Wissen und Überzeugung eines einzelnen Dirigenten. Diese frühe Einsicht hat mich für mein Leben geprägt.