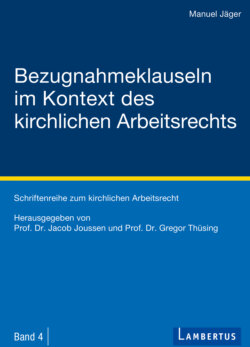Читать книгу Bezugnahmeklauseln im Kontext des kirchlichen Arbeitsrechts - Manuel Jäger - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.Sonderfall: Tarifvertrag Nordelbische Kirche
ОглавлениеDie ehemalige Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche (NEK) hat sich durch Fusionsvertrag vom 05.02.2009 im Jahre 2012 mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) zusammengeschlossen.128 Für die Arbeitsrechtssetzung in der Nordkirche ist zunächst das „kleine Trennungsmodell“ vorgesehen.129 Nach diesem Modell erfolgt die Schaffung arbeitsrechtlicher Regelungen in dem Gebiet der ehemaligen NEK nach dem bisher dort geltenden „Kirchengesetz über die Regelung der Rechtsverhältnisse der in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis beschäftigten Mitarbeiter in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG-NEK)“ vom 05.11.1979 in der Fassung vom 26.05.2014. § 1 Abs. 1 ARRG-NEK sieht vor, dass die Dienstverhältnisse nach den „abgeschlossenen Tarifverträgen“ zu gestalten sind. Für das bisherige Gebiet der NEK ist deshalb weiterhin der „Zweite Weg“ kirchengesetzlich vorgesehen.
Dagegen werden in den ehemaligen Kirchenkreisen von Mecklenburg und Pommern weiterhin auf Grundlage der dort jeweils geltenden Arbeitsrechtsregelungsgesetze arbeitsrechtliche Regelungen durch Arbeitsrechtliche Kommissionen nach dem „Dritten Weg“ erlassen. Deshalb gelten für die Mitarbeiterschaft in der Nordkirche mehrere ganz unterschiedlich gestaltete Arbeitsrechtsregelungen.130
Die Tarifverträge der ehemaligen NEK wurden ursprünglich zwischen dem Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger Nordelbien (VKDA)131 und mehreren Gewerkschaften geschlossen. Die Parteien haben den Kirchlichen Arbeitnehmerinnen132 Tarifvertrag (KAT) und den Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD) abgeschlossen. Vom Geltungsbereich dieser Tarifverträge werden zurzeit etwa 27.000 Dienstnehmer erfasst.133 Diese zwei kirchlichen Tarifverträge weichen in der Ausgestaltung des Rechtsgehalts von den anderen Tarifverträgen des „Zweiten Weges“ ab.
Zunächst ordnet § 1 ARRG-NEK an, dass auf Dienstgeberseite nur der VKDA befugt ist, für seine Mitglieder Tarifverträge mit den Mitgliederorganisationen auszuhandeln und zu vereinbaren. Durch diese Ausschließlichkeitsregelung soll verhindert werden, dass sich im Bereich der ehemaligen NEK weitere Arbeitgeberverbände bilden, die Tarifverträge abschließen können.134 Zusätzlich verhandelt der VKDA nur unter Beteiligung aller Gewerkschaften.135 Dadurch soll verhindert werden, dass mit verschiedenen Gewerkschaften als Tarifpartner oder mit verschiedenen Arbeitgeberverbänden Tarifverträge unterschiedlichen Inhalts vereinbart werden. Es wird letztlich also eine Tarifeinheit gewahrt, die dem Leitgedanken der Dienstgemeinschaft entspricht. Bei der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse soll die Einheit des kirchlichen Dienstes erhalten bleiben und so der für die Kirche maßgebliche Grundsatz der Lohngerechtigkeit als Ausfluss der Dienstgemeinschaft garantiert werden.
Außerdem sieht § 2 ARRG-NEK ein „Differenzierungsverbot“ vor. Gegenstand des Differenzierungsverbots ist, dass die tarifvertraglichen Regelungen, die nach § 1 ARRG-NEK vereinbart werden, auf alle Mitarbeiter anzuwenden sind „ohne Rücksicht darauf, ob sie Mitglieder einer Mitarbeiterorganisation sind oder nicht“. Mit Blick auf die strengen Voraussetzungen einer normativen Wirkung eines Tarifvertrages nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 TVG kann daraus aber keine normative Wirkung für die Fälle hergeleitet werden, in denen eine beiderseitige Tarifgebundenheit von Dienstgeber und Dienstnehmer fehlt.136 Die Regelung ist vielmehr so zu verstehen, dass die tarifgebundenen Dienstgeber verpflichtet werden, auch mit den Dienstnehmern, die nicht tarifgebunden sind, die Anwendung des Tarifvertrages zu vereinbaren.
Darüber hinaus sieht § 3 Abs. 2 ARRG-NEK die Möglichkeit vor, dass die Kirchenleitung die tariflichen Regelungen für den Bereich der ehemaligen NEK für allgemeinverbindlich erklären kann.137 Von dieser Option wurde mit Beschluss der Kirchenleitung der NEK vom 14./15.04.1980 auch Gebrauch gemacht.138 Diese kirchenrechtliche Allgemeinverbindlichkeit unterscheidet sich jedoch maßgeblich von einer säkularen Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Tarifvertrages i.S.d. § 5 TVG. Zunächst fehlt den Kirchenleitungen schlicht die Kompetenz, kirchliche Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären.139 Denn nach § 5 Abs. 1 TVG hat grundsätzlich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales diese Befugnis inne. Darüber hinaus ist eine Allgemeinverbindlichkeit nur im Einvernehmen mit Vertretern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen möglich. Die von der NEK vorgesehene Allgemeinverbindlichkeit erfordert dagegen nur einen einseitigen Beschluss durch die Kirchenleitung. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der NEK verfügt deshalb nicht über den im weltlichen Arbeitsrecht vorgesehenen normsetzenden Charakter.140 Stattdessen führt die kirchliche Allgemeinverbindlichkeitserklärung dazu, dass auch für kirchliche Anstellungsträger, die nach § 1 ARRGNEK in den Geltungsbereich des ARRGNEK fallen, sich aber nicht dem VKDA als Tarifvertragspartei auf Dienstgeberseite angeschlossen haben, die Tarifverträge des VKDA als geschaffenes kirchliches Arbeitsrecht verbindlich wirken. Dadurch wird die Privatautonomie der Anstellungsträger, die sich nicht dem VKDA angeschlossen haben, erheblich eingeschränkt.141 Das formelle Recht kirchlicher Einrichtungen, sich an einem Tarifvertrag nicht zu beteiligen und eigene Arbeitsvertragsrichtlinien zu beschließen, wird gewissermaßen durch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung ausgeräumt.142 An der 1980 beschlossenen Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge wurde auch nach der Fusion zur Nordkirche festgehalten.143
Letztlich führt die kirchliche Allgemeinverbindlichkeitserklärung also nur zu einer dienstgeberseitigen Verbindlichkeit, die mit derjenigen des TVEKBO vergleichbar ist. Die Dienstgeber sind verpflichtet, stets Individualarbeitsverträge abzuschließen, die den tarifvertraglichen Regelungen entsprechen. Erreicht wird dies durch die Vereinbarung einer Bezugnahmeklausel auf den jeweiligen Tarifvertrag. Wegen des Verbots, nach der Gewerkschaftszugehörigkeit zu fragen,144 das zudem ausdrücklich in § 2 S. 2 ARRGNEK angeordnet ist, müssen die Dienstgeber im Geltungsbereich des KAT und des KTD ebenfalls mit allen Dienstnehmern eine Bezugnahme auf die Tarifverträge vereinbaren.