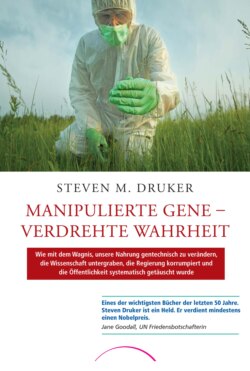Читать книгу Manipulierte Gene – Verdrehte Wahrheit - Steven M. Druker - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die allgemeinen Sicherheitsargumente werden mit solider Wissenschaft angegangen
ОглавлениеWeil die Regierung aufgrund ihrer Ideologie zur Deregulierung tendierte und weil die Biotech-Verfechter ihre Kampagne so nachdrücklich betrieben, machten sie stetige Fortschritte auf ihr Ziel zu. Als sie 1983 vor dem Durchbruch standen, beschlossen Ernst Mayr und Philip Regal, mit echter Wissenschaft dagegenzuhalten.
Regal berichtet: „Im Laufe der folgenden Monate sprach ich mit möglichst vielen Molekularbiologen und Biotech-Förderern, um eine systematische Liste ihrer Argumente zu erstellen, mit denen sie die Deregulierung befürworteten, und um Punkt für Punkt darauf einzugehen.“ (18) Er bezeichnet diese Argumente als „allgemein“, weil sie sich praktisch auf alle GVOs erstreckten und auf der vereinfachenden Annahme basierten, in puncto Sicherheitsbewertung könne man sie als einheitliche Klasse behandeln. (19) Schon bald erkannte er, dass sich die verschiedenen dargelegten Konzepte auf einige wenige grundlegende Argumente eindampfen ließen, die nicht nur „beunruhigend oberflächlich“ waren, sondern auch auf veralteten Vorstellungen sowohl von Ökologie als auch von biologischer Anpassung basierten.
Nach einer dieser Vorstellungen ist die Biosphäre so eng integriert, dass sie keine Nischen für GVOs bietet. Laut Regal rührt diese Vorstellung von der Auffassung her, die Evolution habe die Biosphäre so fein abgestimmt, dass jegliche unnatürliche Veränderung nachlassen werde, wenn sie nicht durch menschliche Vermittlung erhalten werde – dass „sich die Natur selbst von allem Künstlichen reinigt“. (20) Die Vertreter dieser Auffassung argumentierten, die gentechnisch veränderten Entitäten seien durch die an ihnen vollzogenen Modifikationen zwangsläufig so beeinträchtigt, dass sie außerhalb kontrollierter landwirtschaftlicher Einrichtungen nicht mit anderen Organismen konkurrieren könnten – und sich deshalb nicht in der Umwelt ausbreiten und Schaden anrichten könnten. Ein Artikel der Fachzeitschrift Genetic Engineering News brachte diese Auffassung 1984 zum Ausdruck; darin wurde behauptet, jede Spezies habe sich an eine spezielle ökologische Nische angepasst und „jede im Labor herbeigeführte genetische Modifikation wird mit unendlich höherer Wahrscheinlichkeit die Anpassung verschlechtern, statt sie zu verbessern, wenn die Umgebung nicht ebenfalls verändert wird.“ (21)
Regal führt an, die Auffassung, wonach Spezies optimal angepasst seien, habe zwar im 19. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wissenschaftlich gewirkt, doch die Forschungen von Ökologen und Experten für biologische Anpassung hätten sie schließlich als nicht stichhaltig offenbart. Er stellt fest: „Es gibt eine Fülle von Beweisen dafür, dass Organismen für das Überleben nur angemessen angepasst sind und nicht optimal oder perfekt angepasst. Eine sorgfältige biomechanische Analyse und vergleichende Studien zeigen, dass es in der Regel Spielraum für Verbesserung gibt.“ (22) Er betont, das Genspleißen lähme die Überlebensfähigkeit eines Organismus nicht immer – und manche Veränderungen könnten ihm einen Vorsprung verschaffen, sodass er sich in der freien Natur sehr gut entwickeln und ein bedeutender Schädling werden könne.
Freilich, selbst wenn dieses Argument der „nicht vorhandenen Nische“ wissenschaftlich stichhaltig gewesen wäre, wäre es psychologisch immer noch ungünstig gewesen, denn es stellte GVOs als unnatürlich dar – und als unnatürlich beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu wählten manche Biotech-Befürworter einen Ansatz, mit dem sie das Genspleißen als im Grunde natürlich, statt als vollkommen künstlich, darstellen konnten. Doch auch wenn sie die Natürlichkeit der Technologie geltend machten, blieben sie dabei, dass sie die Lebenstüchtigkeit ihrer Nachkommen einschränke. Dabei argumentierten sie in zwei Schritten: Zuerst versicherten sie, die Biotechnologie ähnele der herkömmlichen Züchtung mittels geschlechtlicher Vermehrung, weil sich bei beiden Prozessen lediglich Gene verbänden. Dann behaupteten sie, genau wie die Produktion von Nutzpflanzen und Nutztieren nach dem traditionellen Verfahren diese unfähig mache, ohne menschliche Unterstützung zu überleben, so schränke die Herstellung von Organismen mit der moderneren Methode ebenfalls deren Fähigkeit ein, in der freien Natur zu bestehen. So konnten sie die Natürlichkeit der Gentechnologie verkünden und gleichzeitig hervorheben, dass deren Kreationen keine Umweltschädlinge werden würden.
Dies mag in vielen Ohren wissenschaftlich geklungen haben, Regal jedoch erschien dieses Argument ebenso fehlerbehaftet wie das andere. Denn wie er aufzeigt, verbindet die rDNA-Technologie Gene „radikal anders“ als die natürliche Züchtung. Dieser Unterschied ist offensichtlich, wenn man sich die Fakten vor Augen führt, über die das Werbeargument hinwegsah.
Von jedem Gen gibt es alternative Varianten, die als seine Allele bezeichnet werden. Jedes Gen hat multiple Allele, manche Gene besitzen viele. Unterschiedliche Allele führen zu unterschiedlichen Eigenschaften. Ein Beispiel dazu: Das Gen, das die Form einer Speiseerbse bestimmt, hat ein Allel, das die Erbsen glatt rund macht, und ein anderes Allel, das sie runzelig macht. (23)
Bei dem Prozess der Kultivierung (der in der Regel mehrere Zyklen selektiver Züchtung umfasst), werden mehrere Allele, die die in der freien Natur vorkommenden Formen dieser Spezies besitzen (Wildtyp-Allel genannt), nach und nach durch andere Allele ersetzt, was neue Eigenschaften hervorbringt. Somit ist das ein Abwägungsprozess (trade-off); und diese Abwägungen sind, wie Regal erklärt, nicht leicht vorzunehmen.
In der Praxis kann der Züchter normalerweise nicht einzelne Allele an jeweils nur einem Genort austauschen; damit können angrenzende Stücke unerwünschter Allele ‚per Anhalter mitfahren‘, und die Allele, die sich ursprünglich an allen diesen Orten befanden, können unterwegs verloren gehen. Somit muss der Züchter bei der konventionellen Züchtung üblicherweise abwägen und genetische Merkmale, die zu einem Überleben in der Natur beitragen, gegen solche austauschen, die der Züchter aus kommerziellen Gründen will. Infolgedessen haben viele konventionell! gezüchtete Organismen ihre natürliche Konkurrenzfähigkeit teilweise eingebüßt, und es ist unter normalen Umständen recht unwahrscheinlich, dass sie zu Umweltschädlingen werden. Mais beispielsweise ist so stark gezüchtet, dass er in der Natur auf Dauer nicht bestehen kann. Die Samenschalen sind dünn geworden, was sie leichter essbar macht, aber sie bieten auch weniger Schutz. Außerdem bleiben die Samen auf dem Kolben, ein Segen bei der Ernte, aber ein Nachteil in der freien Natur, denn eine überlebensfähige Pflanze sollte Samen haben, die abfallen und sich verbreiten.
Ganz im Gegensatz dazu spleißen die Biotechnologen neue Gene ein, während sie alle anderen beibehalten; sie fügen also neue Merkmale hinzu, ohne irgendwelche dafür aufzugeben, über die der Organismus bereits verfügt. Regal unterstreicht: Bei diesem neuartigen Vorgehen braucht man nicht die natürliche Kraft eines Organismus „abzuwägen“ und kann so die Konkurrenzfähigkeit eines bereits überlebensfähigen Organismus vom Wildtyp steigern – etwas, was bei der herkömmlichen Züchtung „fast unmöglich“ ist. (24)
Doch trotz ihrer Dissonanz mit der Realität wurden die allgemeinen Sicherheitsargumente im Allgemeinen nicht infrage gestellt; gedeckt durch Ansehen und Einfluss ihrer Vertreter, akzeptierten die Regierungsmitglieder und die Medien sie als verbindlich. Ebenso wenig hat die Wissenschaftsgemeinde diese Argumente oder das Thema Umweltsicherheit an sich ernsthaft analysiert. Ernst Mayr informierte Philip Regal darüber, dass die Erörterungen in der National Academy of Sciences (NAS) auf das Entweichen geschwächter Labormikroben beschränkt worden seien – und dass niemals richtig angesprochen worden sei, ob man vernünftigerweise davon ausgehen könne, alle anderen GVOs seien ebenso beeinträchtigt. Die Akademie habe zwar eine solche Untersuchung durchführen sollen, so erklärte Mayr, doch die interne Politik habe das verhindert. Die Molekularbiologen seien allzu misstrauisch gewesen, dass ihnen die Kontrolle über das Thema entgleiten könnte.
Damit betrat Regal Neuland, als er die Umweltgefährdungen gentechnisch veränderter Organismen und die Argumente derer, die deren unregulierte Freisetzung anstrebten, systematisch zu analysieren begann. Mayr arbeitete mit, ebenso Peter Raven, der wie Mayr ein höchst einflussreicher Biologe war, Mitglied der National Academy of Sciences und eine Autorität, deren Fachkompetenz weit über die Ebene der Moleküle und Zellen hinausging. Auch er war beunruhigt, in welchem Tempo die Biotechnologie kommerzialisiert wurde, obwohl nach wie vor nichts über ihre Risiken bekannt war. Er hielt es ebenfalls für zwingend erforderlich, einen echten Dialog in der Gemeinschaft der Biowissenschaftler anzustoßen – gerade weil die Biologen, die mit den neuesten Fortschritten in ökologischer Genetik und der Erforschung der Anpassung vertraut waren, nie zusammengekommen waren, um alle diese neuen Informationen einzuordnen, geschweige denn, um zu untersuchen, wie sie die Freisetzung von GVOs betrafen. (25)
Folglich hielten Mayr, Raven und Regal es für unverzichtbar, die vorläufige Analyse, die Regal vorbereitet hatte, anderen Fachleuten auf diesen Gebieten zur Bewertung vorzulegen. Regal bemerkt:
Peter, Ernst und ich waren nicht sicher, was dabei herauskommen würde. Würden diese anderen Experten meiner Analyse beipflichten oder würden sie Schwachstellen darin finden, die keinem von uns dreien aufgefallen waren? Ich hoffte inständig, sie würden Schwächen finden, denn wenn ich recht hatte, waren die Auswirkungen zutiefst beunruhigend. Die Gesellschaft würde einer Zeit vorsätzlicher Freisetzungen entgegengehen, von denen jede ein Lotteriespiel wird. Und im schlimmsten Fall würde die Zahl der Spiele rasch steigen, wobei sich der Einsatz im Lauf der Zeit immer erhöht, weil die rDNA-Techniken jedes Jahr effizienter würden.
Zum einen mussten also die führenden Experten für Ökologie und verwandte Fachgebiete eingebunden werden, und zum anderen mussten führende Molekularbiologen mit der aktuellen Befundlage konfrontiert werden – und es galt, sicherzustellen, dass sie deren Folgen verstanden. Darum animierten Mayr und Raven Philip Regal, ein Arbeitstreffen zu organisieren, das einen solchen Austausch ermöglichen würde.
In einem ersten Schritt flog Regal nach Washington, D. C., um Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten. Außerdem wollte er aus erster Hand erfahren, wie gut die Regierung mit den verschiedenen Themen rund um GVOs umging. Als er die Abteilungsleiter und Programmdirektoren bei der National Science Foundation und Schlüsselpersonen in anderen Behörden traf, waren die Auskünfte, die er erhielt, aufschlussreich – und wurden häufig mit Worten eingeleitet, die er immer wieder hören sollte, wenn er mit Regierungsvertretern zu tun hatte: „Wenn Sie mich zitieren, dementiere ich das, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, dass …“ Viele waren tief beunruhigt und froh, dass er sich engagierte und bereit war, „seinen Kopf zu riskieren“. Sie äußerten die Hoffnung, er werde die schwierigen Fragen besser anpacken als die Insider in Washington, die aufgrund des politischen Klimas in der Hauptstadt Angst hatten, ihren eigenen Kopf zu riskieren.
Diese Beamten erklärten, es sei schwierig für sie, angemessen zu handeln, weil angesehene Molekularbiologen und Führungskräfte aus der Biotechbranche bei der Reagan-Regierung Gehör gefunden und diese überzeugt hätten, dass die Biotechnologie entscheidend für die Wiederbelebung der Wirtschaft sei und deshalb eine besondere Behandlung erfahren solle. Regal berichtet: „Man teilte mir mit, die Regierung vertrete folgende Auffassung: Die meisten wirtschaftlichen Probleme des Landes ließen sich lösen, indem einerseits staatliche Vorschriften zu Krediten, Handel und Umweltverschmutzung abgebaut würden und andererseits eine enorme Verlagerung hin zur High-Tech-Industrie gefördert würde. Weil es sich außerdem für US-Unternehmen als schwierig erwiesen habe, sich ein Monopol in der Computerindustrie zu sichern, sei die Regierung entschlossen gewesen, die nationale Überlegenheit in der Biotechnologie zu wahren. Darum habe sie Staatsbeamte beauftragt, die rasche Entwicklung der Biotechnologie voranzutreiben – und (laut den Leuten, mit denen ich sprach) erfüllte sie den Molekularbiologen praktisch jeden Wunsch.“ (26)
Die Programmdirektoren bei der NSF standen nicht nur unter Druck, die Biotechnologie zu fördern. Regal erfuhr, dass sie „wie panisch“ waren, weil die Reagan-Regierung im Begriff war, fast alle Mittel für jegliche biologische Forschung zu kürzen, die nicht unmittelbar zur nationalen Anstrengung in der Biotechnologie beitrug. Von 93 Forschungsanträgen zur Ökologie, die die NSF-Mitarbeiter eingereicht hatten, hieß die Regierung nur die drei gut, in denen in heißen Quellen vorkommende Bakterien untersucht wurden. Denn die liefern nicht nur thermostabile Enzyme, sondern könnten daneben auch die Entwicklung von gentechnisch veränderten Mikroorganismen fördern, die bei höheren Temperaturen im Inkubator gezüchtet werden könnten und somit schneller chemische Substanzen produzieren würden. Regal berichtet, die Direktoren hätten sich „bitter beklagt“, dass die Grundlagenforschung aufgegeben werde.
In einem solchen Klima konnten Regals Bitten nicht erfüllt werden. Mehrere NSF-Vertreter wollten zwar gern behilflich sein, räumten aber ein, es sei für sie politisch zu riskant, ein Arbeitstreffen zu finanzieren, bei dem Sicherheitsfragen zu GVOs angesprochen werden sollten. Die Schwierigkeit werde noch durch die Tatsache erschwert, dass die Reagan-Regierung nicht einmal bereit sei, mit Ökologen zu reden, geschweige denn ein Forum zu finanzieren, in dem sie ihre Bedenken zur Schau stellen könnten. Die Regierungsmitglieder waren der – damals bei Politikern weit verbreiteten – irrigen Meinung, der Begriff „Ökologe“ sei gleichbedeutend mit „Umweltschützer“. Und ihrer Ansicht nach verfochten jene, auf die die Bezeichnung zutraf, lediglich eine für die Wirtschaftsentwicklung schädliche Politik und ebensolche Werte. Ihnen war nicht bewusst, dass die Ökologie – im Gegensatz zur Umweltschutzbewegung – kein Set politischer Präferenzen ist, sondern eine anerkannte Wissenschaft, die die komplexen Interaktionen zwischen Gruppen von Organismen und zwischen Organismen und ihrer nicht lebenden Umwelt untersucht. Ebenso wenig erkannten sie, dass sich Ökologen in ihrer politischen Grundhaltung und ihren Wertesystemen unterscheiden – und dass manche zu bestimmten politischen Themen völlig anderer Ansicht sind als viele Umweltschützer.
Zu allem Übel verwechselten viele Molekularbiologen Ökologie und Umweltschutz ebenso; und selbst die, die erkannten, dass die Ökologie ein Teilgebiet der Biologie ist und nicht nur ein politisches Programm, schauten dennoch auf sie herab. Weil die meisten von ihnen von ihrer Ausbildung her Physiker oder Chemiker waren, hatten sie nur ein begrenztes Verständnis dessen, was die traditionelle Biologie beinhaltet, und sie neigten dazu, das reine Sammeln und Kategorisieren der verschiedenen Lebensformen als die Hauptbeschäftigung von Biologen anzusehen. Dies verleitete etliche der einflussreichsten Molekularbiologen dazu, die Biologie als „Briefmarkensammeln“ abzutun. (27) Diese Wissenschaftler meinten, traditionelle Biologen studierten das Leben nicht auf eine Art, die seine grundlegenden Gesetzmäßigkeiten erkennen lasse; nur sie hätten die richtige Herangehensweise. Regal erklärt: „Die wirklich seriöse Art und Weise, die belebte Welt zu studieren, verläuft aus ihrer Sicht von den Molekülen aufwärts. Weil sie die Spezialisten für Moleküle waren und weil Moleküle die Grundbausteine des Lebens sind, glaubten sie, sie seien am besten in der Lage zu deduzieren, wie sich alles in der Komplexitätskette aufwärts verhalten sollte – sogar noch besser als organismische Biologen, als Ökologen und andere Wissenschaftler, die die höheren Komplexitätsebenen direkt studierten. Darum hielten sie es für wenig ergiebig, sich mit diesen Wissenschaftlern auszutauschen, und neigten dazu, jegliche Beiträge dieser Wissenschaftler, die ihren eigenen Annahmen widersprachen, zu verwerfen. Damit verachteten die mit der Froschperspektive diejenigen mit der Vogelperspektive.“
Regal hatte zwar viele Insider-Informationen erhalten, aber keine Mittel, deshalb musste er wieder nach Washington und erneut versuchen, das Geld zu beschaffen, mit dem der überfällige Dialog zwischen Ökologen und Molekularbiologen begonnen werden konnte. Eine der Hauptanlaufstellen war das stattliche Gebäude, in dem die National Academy of Sciences ihren Sitz hat. Dort hoffte er, die Abteilungsleiter des National Research Council (NRC), also den Arm der NAS, der Studien durchführt und Berichte veröffentlicht, zu überzeugen, das Arbeitstreffen, das er sich ausgemalt hatte, zu finanzieren. Allerdings stellte er schon bald fest, dass seine Hoffnungen unangebracht waren.
Wie er bei einem Termin mit einer Gruppe leitender Mitarbeiter des NRC erfuhr, befürchteten die Mächtigen in der Akademie, jede ökologische Analyse der GVOs, die nicht scharf beaufsichtigt werde, würde deren Gegnern Munition liefern. Außerdem wurde rasch offensichtlich, dass die Politik der NAS nicht nur von der Furcht vor einer ökologischen Analyse geprägt war, sondern von einer Respektlosigkeit gegenüber Ökologen. Regal berichtet: „Man sagte mir, die einflussreichsten Interessengruppen in der Akademie (die wirklichen ‚Bosse‘ der Leute, mit denen ich sprach) definierten wahre Wissenschaft als nur auf der Physik und Chemie basierend – und bestanden darauf, nur solche Wissenschaften könnten ausreichend aussagekräftig sein. Daher lehnten sie es ab, den Ökologen irgendeine Beteiligung an der Evaluation von GVOs zuzugestehen.“
Betroffen von der Inkongruenz zwischen den internen Arbeitsweisen der führenden wissenschaftlichen Institution des Landes und ihrer majestätischen Außendarstellung (die sie unter anderem dadurch kultiviert, dass sie ihren Hauptsitz als „einen Tempel der Wissenschaft“ bezeichnet), machte Regal die Entscheider auf die Gefahren aufmerksam, wenn man nur die Vertreter einer einzigen engen Sicht auf die Wissenschaft die nationale Politik diktieren lasse, zumal einer Sicht, die zahlreiche Wissenschaftler ablehnten und die nicht zu Recht die Überlegenheit über andere, umfassendere Perspektiven beanspruchen könne. (28) Sie stimmten zwar zu und hielten es ebenfalls für wertvoll und nützlich, die Anschauungen derer zu erweitern, die in der NAS und dem NRC das Sagen hatten, und sie dazu zu bringen, einen ernsthaften Dialog zwischen Molekularbiologen und Ökologen (und anderen „traditionellen“ Biologen) zu fördern. Doch sie sagten, solche Entwicklungen seien in der absehbaren Zukunft höchst unwahrscheinlich.
Als Regal sich verabschiedete, sagte ihm einer der Leiter, wie Regal notiert: „Ich möchte Ihnen etwas zeigen, bevor Sie gehen.“ Dann führte er ihn nach draußen zu einem besinnlichen Hain mit Ulmen und Stechpalmen, zwischen denen ein großartiges Denkmal eines der herausragendsten Akademie-Mitglieder stand. Regal berichtet:
Ich bewunderte eine herrliche Bronzestatue von Albert Einstein, ausgestreckt wie ein fasziniertes Kind, mit dem Universum als Fußboden seines Laufstalls. „Schauen Sie“, sagte mein Gastgeber und deutete auf eine Inschrift um den Fuß der Skulptur, die Einsteins Ermahnung an die enthielt, die sich mit Wissenschaft beschäftigen: Das Recht, nach der Wahrheit zu suchen, geht mit einer Pflicht einher; man darf nicht einen Teil dessen, was man als wahr erkannt hat, verheimlichen. Nachdem ich das gelesen hatte, schaute er mir in die Augen und lächelte wissend, bis er sich sicher war, dass er mich dazu angeregt hatte, gründlich über diese gewichtige Aussage nachzudenken. (29)
Mit einer Entschlossenheit, die Einsteins Anerkennung verdient hätte, bemühte Regal sich weiter, die Hinweise von der Ökologie in die Biotech-Arena zu bringen; und schließlich wurden ihm von der einzigen Bundesbehörde Mittel bewilligt, die damals sowohl die Notwendigkeit erkannte, die Freisetzung von GVOs umsichtig zu regulieren, als auch den Wert der Ökologie: der EPA (Umweltschutzbehörde).
Die EPA sagte nicht nur zu, das Arbeitstreffen zu finanzieren, sondern wollte auch aktiv an der Planung mitwirken. Ein EPA-Wissenschaftler (Jack Fowle) wurde Regals Mitorganisator. Mayr und Raven machten ebenfalls aktiv bei der Planung mit; und Regal besprach am Telefon mit beiden ausführlich, wer eingeladen werden und was auf die Tagesordnung des Treffens gesetzt werden sollte.
Eine weitere wichtige Überlegung war, welchen Charakter das Arbeitstreffen haben würde. Weil Regal zunehmend erkannte, wie politische Präferenzen und Pressionen den Diskurs der Wissenschaftler über die Gentechnologie korrumpiert hatten, versuchte er, solche Einflüsse zu mäßigen. „Ich wollte, dass alle Wissenschaftler offen reden, als Wissenschaftler über ein politisch äußerst heikles Thema“, sagt Regal. „Ich bestand darauf, dass alle Teilnehmer aus der Regierung oder aus der Industrie Wissenschaftler sein sollten, selbst wenn sie nach ihrer Promotion in die Verwaltung gegangen waren. Ich machte deutlich, dass das eine wissenschaftliche Diskussion sein sollte – keine politische. Und um die Versuchung zur Selbstdarstellung möglichst gering zu halten, lud ich die Presse nicht ein.“ Diese Entscheidung legte ihm nicht nur sein Wissen darüber nahe, dass die Medienpräsenz nicht nur bei einigen Teilnehmern zu Exzessen führen, sondern dass sie auf die Wissenschaftler aus der Regierung genau gegenteilig, also hemmend wirken würde. Mehrere von ihnen hatten nämlich die Angst geäußert, sie würden ihren Arbeitsplatz verlieren, sollten ihre aufrichtigen Äußerungen veröffentlicht werden. Anders als die Organisatoren der Konferenzen von Bethesda, Falmouth und Ascot, die die Medien ausschlossen, damit ihre politisch motivierten Annahmen als wissenschaftliche Schlussfolgerungen durchgehen könnten, schloss Regal die Medien aus, um die wissenschaftliche Integrität der Beratungen zu wahren.
Zwar war die EPA damit zufrieden, wie sich die Pläne entwickelten, die NAS war es jedoch nicht. Ein Arbeitstreffen zu den Umweltrisiken von GVOs, das von Ökologen geleitet wurde – und bei dem diese paritätisch mit den Molekularbiologen vertreten wären und reichlich Gelegenheit hätten, deren Vorstellungen zu kritisieren – diese Aussicht war für die Leitung der NAS besorgniserregend. Daher versuchte sie zu intervenieren. Regal berichtet: „Als sich herumsprach, dass ich von der EPA Mittel für das Arbeitstreffen bekommen würde, versuchte die NAS, es zu vereinnahmen. Jack Fowle sagte mir am Telefon, die NAS habe sich mit der EPA in Verbindung gesetzt und angeboten, ihre eigene Studie zu den Risiken durchzuführen, falls die EPA ihre Pläne fallen lasse. Doch nach der Vorstellung der NAS würde dazu nur ein Ökologe zugelassen werden: ich. Fowle fragte mich, ob mir diese Vorstellung gefalle. Das war ein so lächerlich durchsichtiger Versuch, die Molekularbiologen bei diesem Thema das Heft in der Hand halten zu lassen, dass ich laut lachte. Fowle sagte mir, die Idee gefalle den Leuten in der EPA auch nicht und sie hätten schon vermutet, dass ich sie ablehnen würde.“
Im August 1984 machte sich das Treffen schließlich an die Arbeit – und zwar im Banbury Center der renommierten Cold Spring Harbor Laboratories im Staat New York. Regal erklärt, die EPA habe diesen Ort ausgewählt, weil diese Forschungseinrichtung damals von James Watson geleitet wurde, einem der einflussreichsten und offensten Befürworter der Gentechnologie. Die Umweltschutzbehörde wollte ihm das Thema Umweltrisiken im wahrsten Sinn des Wortes nahebringen, nicht nur, damit er auf diesem Weg mit dem neuesten Kenntnisstand der Ökologie konfrontiert würde, sondern auch um festzustellen, ob er irgendwelche Fehler in Regals Analyse entdecken würde. Ein zusätzlicher Vorteil davon, die Veranstaltung dort abzuhalten, war, dass Barbara McClintock auf dem Gelände lebte und teilnehmen konnte. Wie Watson war sie eine der Giganten der Genetik und hatte für eine bahnbrechende Entdeckung den Nobelpreis gewonnen; doch auf der organismischen Ebene der Biologie kannte sie sich wesentlich besser aus als er.
Der Workshop war nicht nur für alle Teilnehmer eine Offenbarung, die Überraschungen, die er brachte, waren für beiden Seiten beunruhigend. Die Ökologen und andere organismische Biologen schlossen sich rasch Regals Fehleranalyse bei den allgemeinen Sicherheitsargumenten an – und bestätigten die Annahmen, auf denen diese Argumente basierten, als überholt. Darüber hinaus waren sie, so berichtet Regal, „schockiert“, als sie erfuhren, dass so viele einflussreiche Wissenschaftler behauptet hatten, alle GVOs seien sicher – aufgrund von Auffassungen, die sie für „wissenschaftlichen Unsinn“ hielten. „Sie waren außerdem schockiert“, so Regal, „über einige Projekte, die gerade liefen, wie uns die Leute aus der Regierung und Industrie mitteilten. Sie hatten keine Ahnung, dass so offensichtlich gefährliche Organismen überhaupt entwickelt wurden, geschweige denn, dass ihre baldige Freisetzung vorgesehen war.“
Die Molekularbiologen ihrerseits „waren schockiert und konnten es nicht glauben, dass ihre Sicherheitsargumente in den Augen der Fachleute für solche Fragen so gänzlich unseriös waren.“ Gelindert wurde ihr Unbehagen jedoch dadurch, dass die Ökologen zwar die Argumente dafür ablehnten, dass alle GVOs harmlos seien, aber doch glaubten, die meisten würden keine Probleme verursachen. Regal berichtet: „Alle Ökologen waren sich darin einig, dass das Gros selbst der ökologisch verträglichen GVOs keine Bedrohung für die Umwelt darstellen würde. Allerdings kamen wir auch zu dem Schluss, dass ein kleiner Prozentsatz sehr wohl enorme und irreversible Probleme hervorrufen könnte. Wir machten den Molekularbiologen und den Wissenschaftlern aus der Regierung klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie Schaden anrichten würden, gering war, dass aber bei dem kleinen Prozentsatz der Freisetzungen, die tatsächlich gefährlich wurden, der Schaden riesig sein könnte. Das hätte sie davon überzeugen sollen, dass es notwendig war, jeden GVO sorgfältig zu prüfen – und töricht, anzunehmen, man könne auf eine solche Vorsicht verzichten.“
Die Ökologen erklärten ausführlich, warum die den allgemeinen Sicherheitsargumenten zugrunde liegenden Annahmen fehlerbehaftet waren. An einem Punkt schaltete sich Barbara McClintock in die Diskussion ein und steuerte eifrig Argumente bei. Regal merkt an: „Viele Nicht-Ökologen bekamen einen weiteren Schock, als eine der Ikonen der modernen Genetik die Ansichten der biologischen Anpassung, die man bis dahin für wissenschaftlich solide und sogar selbstverständlich gehalten hatte, als einfältig und irreführend von der Hand wies.“
Zur Bestürzung vieler Molekularbiologen war es mit dem Ende der Banbury-Konferenz noch nicht damit vorbei, dass ihre Annahmen offener, wissenschaftlich begründeter Kritik ausgesetzt waren, sondern es wiederholte sich neun Monate später in einem noch größeren Rahmen – bei einer Konferenz, die von der im Banbury Center angeregt worden war und die nicht nur größer war, sondern zu der auch die Medien zugelassen waren. Diese Konferenz (die im Juni 1985 in Philadelphia stattfand) hatte einen noch stärkeren Rückhalt als die Zusammenkunft in Banbury und wurde von der American Society for Microbiology sowie sechzehn wissenschaftlichen Vereinigungen und Regierungsstellen finanziert.
Doch trotz des breiten Sponsorings kam es zu beträchtlicher Disharmonie. Regal, der gebeten wurde, die Eröffnungsrede zu halten, erinnert sich: „Insgesamt war die Veranstaltung alles andere als angenehm, und viele Molekularbiologen waren fuchsteufelswild, dass Ökologen eingeladen waren, um sich über ‚ihre‘ Wissenschaft zu äußern.“ Angefacht wurde ihr Ärger noch dadurch, dass diese Äußerungen weithin bekannt werden könnten, da die Presse ja über die Veranstaltung berichtete. Sie fürchteten, eine so unkontrollierte Diskussion über die Risiken würde nicht nur die Ängste der Öffentlichkeit schüren, sondern auch Investoren und Entscheidungsträger vergrätzen.
Außerdem waren die Eröffnungen im Banbury Center in so geringem Maße zur Gemeinschaft der Molekularbiologen durchgedrungen, dass viele von ihnen, die nach Philadelphia gekommen waren, keine Ahnung hatten, was dort vor sich gegangen war. Folglich wurden sie bei Regals Vortrag erstmals mit ein paar ernüchternden wissenschaftlichen Realitäten konfrontiert. In seiner Rede beschrieb er die Fortschritte, die die Ökologie und die ökologische Genetik in den Jahrzehnten zuvor gemacht hatte, und inwiefern sie die Argumente, alle GVOs seien sicher, widerlegten. Im Laufe der Veranstaltung erläuterten andere Ökologen den neuesten Kenntnisstand ausführlicher – und inwiefern dieser die Fehler in den allgemeinen Sicherheitsargumenten enthüllte. Regal sagt: „Sie haben hervorragend aufgezeigt, dass ihre Bedenken auf systematischer Wissenschaft basierten, und nicht, wie manche Kritiker es ihnen vorwarfen, auf einem emotionalen Vorbehalt gegen Fortschritt.“
Die Wirkung war erheblich; und wie die Wissenschaftspresse berichtete, zeigte die Konferenz im Endergebnis eindeutig die Notwendigkeit, Ökologen an der Aufstellung von Biotech-Richtlinien und der Bewertung der Risiken von GVOs zu beteiligen. Das führte zu Änderungen in der Regierungspolitik. Insider aus Washington informierten Regal, dass durch den Einfluss der Konferenzen im Banbury Center und in Philadelphia die Pläne zur Deregulierung der Biotechnologie neu bewertet und die geplanten Kürzungen bei der Förderung der ökologischen Grundlagenforschung zurückgenommen wurden und die EPA begann, zu GVOs aktiver den Rat von Ökologen zu suchen.