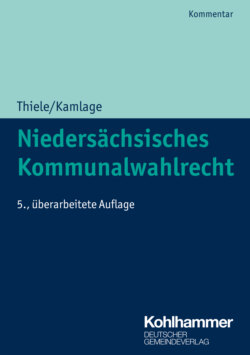Читать книгу Niedersächsisches Kommunalwahlrecht - Werner Schiefel - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.Niedersächsisches Kommunalwahlrecht 1947–1955
ОглавлениеDie Wahlergebnisse der Kommunalwahlen vom 15.9. und 13.10.1946 bestätigten die Befürchtungen des von den Briten Anfang des Jahres konsultierten Arbeitsausschusses. Vor allem in kleinen Gemeinden war der Sitzanteil der Parteien oftmals weit geringer als ihr prozentualer Stimmenanteil, während unabhängige Kandidaten besonders stark vertreten waren.9 Die Forderung nach Abänderung des geltenden Wahlsystems setzte gleich nach den Wahlen ein. Sowohl der jährliche Austausch eines Drittels der Vertreter als auch die als ungerecht empfundenen Ergebnisse der modifizierten Mehrheitswahl wurden beanstandet. Die kritischen Stimmen wurden lauter, nachdem im April 1947 die erste Wahl zum Niedersächsischen Landtag stattgefunden hatte. Diese war nicht aufgrund britischer Anordnungen, sondern nach gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt worden, die der von britischer Seite anhand des Ergebnisses der Kreiswahlen vom 13.10.1946 ernannte Niedersächsische Landtag beschlossen hatte.10 Bei der Landtagswahl galt ein mit der Mehrheitswahl in Wahlkreisen verbundenes Verhältniswahlsystem. Nachdrücklich wurde gefordert, eine entsprechende Regelung auch für die Kommunalwahlen einzuführen.
Nachdem die britische Militärregierung die Regelung des Kommunalwahlrechts den Deutschen übertragen hatte, beschloss der Landtag im September 1947 mit Genehmigung der Militärregierung, die Bestimmungen über den jährlichen Austausch eines Drittels der Vertreter aufzuheben und spätestens bis zum 1.12.1948 nach bis dahin neu zu schaffenden gesetzlichen Regelungen Neuwahlen durchzuführen.11 Wegen des selbstgesetzten Termins stand die Erarbeitung der kommunalen Wahlrechtsvorschriften unter großem Zeitdruck. Sie kamen erst im Oktober 1948 zum Abschluss, sechs Wochen vor den Neuwahlen am 28.11.1948.
Die getroffenen Regelungen gingen im Wesentlichen auf die Vorarbeiten einer „Wahlrechts-Arbeitsgemeinschaft“ zurück, der Vertreter von CDU, SPD, DP und KPD, des Städtetages, des Gemeindetages, des Landkreisverbandes sowie Beamte des Innenministeriums und von diesem benannte Sachverständige angehörten. Man einigte sich auf ein die Vorteile von Persönlichkeitswahl und Verhältniswahl verbindendes Wahlsystem.12 In bewusster Abkehr von den gebundenen Listen der Weimarer Zeit konnte der Wähler eine Auswahl unter verschiedenen Bewerbern treffen. Durch einen Verhältnisausgleich auf der Ebene des Wahlgebiets war sichergestellt, dass auch Minderheiten in einer ihrer Stimmenzahl entsprechenden Stärke vertreten waren. An die Stelle einer durch Elemente der Verhältniswahl modifizierten Mehrheitswahl trat nun – wie bei der Landtagswahl – eine durch Elemente der Persönlichkeitswahl modifizierte Verhältniswahl.
Für die Wahl der Vertreter in den Städten und Landkreisen und in Gemeinden mit mehr als 12 000 Einwohnern galt das Niedersächsische Kreiswahlgesetz vom 4.10.1948 (GVBI. S. 84), für die Wahl der Vertreter in den kreisangehörigen Gemeinden mit bis zu 12 000 Einwohnern das Niedersächsische Gemeindewahlgesetz vom selben Tage (GVBI. S. 90). Beide Gesetze fanden bis auf eine Ausnahme die Zustimmung der Militärregierung. Nach dem Wunsch des Britischen Gebietsbeauftragten sollte die Reihenfolge der nachrückenden Ersatzmänner nicht – wie vorgesehen – von den Parteien, sondern aufgrund der Stimmenzahlen der einzelnen Bewerber bestimmt werden. Noch kurz vor den Kommunalwahlen am 28.11.1948 wurden das Gemeinde- und das Kreiswahlgesetz durch Gesetze vom 21.11.1948 (GVBI. S. 173) entsprechend geändert.
Nach den Bestimmungen der Wahlgesetze galt das System einer Verhältniswahl mit freien Listen. Der Wähler hatte drei Stimmen, die er verschiedenen Bewerbern desselben oder verschiedener Wahlvorschläge geben konnte (Panaschieren). Die Abgabe von mehr als einer Stimme für einen Bewerber (Kumulieren) war nicht möglich. In Gemeinden bis zu 12 000 Einwohnern wurden die Sitze aufgrund der Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren auf die einzelnen Wahlvorschläge verteilt; die danach einem Wahlvorschlag zustehenden Sitze wurden den Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen zugewiesen. Größere Gemeinden und die Landkreise wurden in verschiedene „Wahlbezirke“ eingeteilt. In jedem Wahlbezirk wurden drei Bewerber direkt gewählt. Dabei wurden die Sitze zunächst nach dem d'Hondtschen Verfahren auf die verschiedenen Wahlvorschläge verteilt, die einem Wahlbezirksvorschlag zustehenden Sitze sodann an die Bewerber mit den höchsten Stimmenzahlen vergeben. Die übrigen Sitze wurden den Parteien im Verhältnisausgleich über Kreislisten zugewiesen.
Die Wahlperiode betrug 4 Jahre. Wahlberechtigt waren alle Deutschen, die am Wahltage das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten im Wahlgebiet ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hatten. Zu den Wählbarkeitsvoraussetzungen gehörten die Vollendung des 25. Lebensjahres und ein mindestens sechsmonatiger Wohnsitz oder ständiger Aufenthalt im Wahlgebiet. Bei den von der Entnazifizierung betroffenen Personen waren Wahlrecht und Wählbarkeit eingeschränkt.13
Abgesehen von den beschriebenen Besonderheiten bei der Sitzverteilung stimmten die Bestimmungen für Gemeinde- und Kreiswahl im Wesentlichen überein. Zur Regelung der Einzelheiten des Wahlverfahrens wurden die Niedersächsische Kreiswahlordnung und die Niedersächsische Gemeindewahlordnung vom 13.10.1948 (GVBI. S. 95 und 126) erlassen. Die Wahlordnungen knüpften an die Bestimmungen der Niedersächsischen Landeswahlordnung vom 31.3.1947 (GVBI. S. 17) an, diese hatte sich weitgehend an das bei den Reichstagswahlen der Weimarer Republik geltende Wahlverfahren angelehnt.
In den folgenden Jahren wurden die Wahlgesetze mehrfach geändert. Durch Gesetze vom 27.3.1949 (GVBI. S. 75) und erneut durch Gesetze vom 14.10.1953 (GVBI. S. 79) wurden die Modalitäten bei der Wiederholungswahl ergänzt. Die Gesetze zur Änderung des Kreis- und des Gemeindewahlgesetzes vom 12.7.1952 (GVBI. S. 57 und S. 61)14 enthielten verschiedene Ergänzungen und Berichtigungen, die die Rechtsentwicklung seit 1948 (u. a. Inkrafttreten des Grundgesetzes und der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung) berücksichtigten, aber auch das Wahlsystem berührten.
Eine wesentliche Änderung für die Kreiswahl bestand im Wegfall des Verhältnisausgleichs über eine Kreisliste. Wie bisher hatte der Wähler drei Stimmen. Das jeweilige Wahlgebiet wurde je nach Größe in 2 bis 5 Wahlbezirke eingeteilt, in denen zwischen 9 und 13 Vertreter zu wählen waren. Grundlage für die nur noch auf der Ebene der Wahlbezirke stattfindende Sitzverteilung war das Stärkeverhältnis der Wahlvorschläge in den einzelnen Wahlbezirken (regionalisierte Verhältniswahl). Nach dem Gemeindewahlgesetz bildeten kleinere Gemeinden – jetzt solche mit bis zu 10 000 Einwohnern – wie bislang nur jeweils einen Wahlbezirk. Außer von Parteien und Einzelbewerbern konnte ein Wahlvorschlag jetzt auch gemeinsam von mehreren Parteien eingereicht werden. In diesem Fall wurde auf dem Stimmzettel hinter dem Namen der Bewerber die abgekürzte Parteibezeichnung aufgeführt. Im Wahlprüfungsverfahren hatten bisher bei Beschwerden gegen den Beschluss der Vertretung Bezirkswahlgerichte zu entscheiden. Stattdessen wurde jetzt der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.