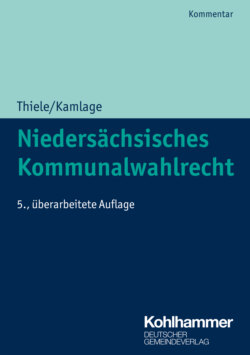Читать книгу Niedersächsisches Kommunalwahlrecht - Werner Schiefel - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.Umgestaltung des Wahlrechts 1955–1958
ОглавлениеVor den Gemeinde- und Kreiswahlen Ende 1956 kam es zu einer grundlegenden Umgestaltung des kommunalen Wahlrechts. Als letztes Bundesland unter den Flächenländern erhielt Niedersachsen 1955 eine Gemeindeordnung.15 Da die grundlegenden Wahlvorschriften über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit, die Wahlperiode, die Zahl der Vertreter, den Sitzerwerb und den Sitzverlust als Bestandteil des kommunalen Verfassungsrechts angesehen wurden, übernahm man diese in die Gemeindeordnung und drei Jahre später entsprechend in die Landkreisordnung.16
Dies war Anlass für eine grundlegende Überarbeitung des kommunalen Wahlrechts. Dabei wurden die Vorschriften für die Gemeindewahl und für die Kreiswahl in einem einheitlichen Kommunalwahlgesetz und einer einheitlichen Kommunalwahlordnung zusammengefasst.17 Ein Teil der bislang in den Wahlordnungen enthaltenen normativen Vorschriften wurde jetzt gesetzlich geregelt. Neben der Berücksichtigung der Rechtsprechung und praktischer Erfahrungen bei der Wahlabwicklung wurden vor allem folgende Änderungen vorgenommen:
1. Grundlage für die Sitzverteilung war einheitlich das Wahlergebnis im gesamten Wahlgebiet. Die bisher nach dem Kreiswahlgesetz vorgesehene Regionalisierung der Verhältniswahl, die für kleine Parteien wegen der geringen Zahl der zu vergebenden Mandate ein faktische 10 %-Sperrklausel zur Folge hatte, entfiel. Die einer Partei im Wahlgebiet zustehenden Sitze wurden nach dem d'Hondtschen Verfahren auf ihre Wahlvorschläge in den einzelnen Wahlbezirken verteilt.
2. Wahlbezirke zur technischen Durchführung der Wahl wurden nur noch in Landkreisen und in Gemeinden mit über 20 000 Einwohnern gebildet.
3. Die nach bisherigem Recht vorgesehenen gemeinsamen Wahlvorschläge mehrerer Parteien wurden durch „Wahlvorschlagsverbindungen“ ersetzt. Die für die – jetzt gesonderten – Listen der jeweiligen Parteien abgegebenen Stimmen wurden bei der Sitzverteilung auf der Ebene des Wahlgebiets zusammengefasst, wenn die betreffenden Parteien eine Wahlvorschlagsverbindung vereinbart hatten.
4. Für Parteien, die nicht im Landtag oder Bundestag vertreten waren, wurde – in Anlehnung an das Landtagswahlrecht – eine Wahlanzeige beim jeweiligen Wahlleiter als Voraussetzung für die Einreichung von Wahlvorschlägen eingeführt.
Das kommunale Wahlrecht ist in der Ausgestaltung, die es mit dem Erlass der NGO (1955), des NKWG (1956) und der NLO (1958) gefunden hatte, in seinen Grundzügen bis heute bestimmend geblieben. Das heute geltende Kommunalwahlrecht geht in seiner Systematik und in vielen Einzelregelungen auf die gesetzlichen Bestimmungen jener Jahre zurück. Seither hat das Wahlrecht zahlreiche Änderungen erfahren. Neue Regelungen wurden eingeführt, teilweise wieder aufgehoben und nicht selten erneut eingeführt. Eine Stabilisierung der Wahlrechtsgesetzgebung, wie sie damals gefordert wurde,18 trat nicht ein.