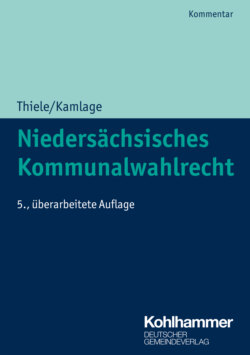Читать книгу Niedersächsisches Kommunalwahlrecht - Werner Schiefel - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.Regelungen der Kommunalverfassungsgesetze
Оглавление2Die Voraussetzungen der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit, die Dauer der Wahlperiode, die Zahl der Abgeordneten sowie der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der Ortsräte und der Einwohnervertretung im gemeindefreien Bezirk, die Regelungen des Sitzerwerbs und des Sitzverlustes sowie des Beginns, der Dauer und des Endes der Amtszeit der direkt Gewählten sind für alle der in Abs. 1 genannten Wahlen in den Kommunalverfassungsgesetzen bestimmt (Abs. 2), und zwar im NKomVG für den Rat, den Samtgemeinderat den Kreistag und die Regionsversammlung (§§ 46 bis 49, 51 und 52 NKomVG), für den Stadtbezirksrat und den Ortsrat (§ 91 Abs. 1 und 2 NKomVG), für den hauptamtlichen Bürgermeister, den Samtgemeindebürgermeister, den Landrat und den Regionspräsidenten (§ 80 Abs. 1, 3, 5 und 6 NKomVG) sowie in der VO über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete für die Einwohnervertretung (§ 5 Abs. 1).
32.1 Wahlberechtigung. Zu den Wahlrechtsvoraussetzungen gehören eine bestimmte Staatsangehörigkeit, ein bestimmtes Mindestalter, der Wohnsitz im Wahlgebiet und das Fehlen des Wahlausschlussgrundes nach § 48 Abs. 2 NKomVG (s. u. Rn. 12). Die dazu notwendigen Daten speichert die Meldebehörde (§ 3 Abs. 2 Nr. 1a BMG) aufgrund von Melde- oder Mitteilungspflichten (§§ 7 BMG, , § 13 Abs. 1 Nr. 5 EGGVG, Nr. 12 MiStra), die auch bei strafrechtlichen Verurteilungen von Unionsbürgern bestehen , und übermittelt sie den für Wahlen zuständigen Behörden und Stellen innerhalb der Gemeinde (§ 34 BMG).
42.1.1 Staatsangehörigkeit. Voraussetzung der Wahlberechtigung ist die deutsche Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit i. S. des Art. 116 Abs. 1 GG oder auf der Grundlage von Art. 8b Abs. 1 des EG-Vertrages und Art. 28 Abs. 1 GG, erstmalig für die Kommunalwahlen 1996 (Gesetz v. 20.11.1995, GVBl. S. 432), die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger) (§ 48 Abs. 1 NKomVG). Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit regelt das Staatsangehörigkeitsgesetz, die Staatsangehörigkeit von Unionsbürgern richtet sich nach dem jeweiligen Recht des betreffenden Staates. Zur EU gehören neben Deutschland (Stand: 1.2.2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs haben seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU zum 1. Februar 2020 kein aktives und passives Kommunalwahlrecht mehr (vgl. auch § 2 NBrexitÜG, Nds. GVBl. 2019 S. 78)). Die Wahlberechtigung anderer Ausländer setzt im Hinblick auf den grundsätzlich nur Deutsche umfassenden Volksbegriff in Art. 20, 28 GG eine Verfassungsänderung voraus (Art. 79 Abs. 3 GG; vgl. BVerfG, Urt. v. 31.10.1990, BVerfGE 83 S. 37). Das Wahlrecht aller Unionsbürger verletzt keine Grundrechte Deutscher (BVerfG, Beschl. v. 8.1.1997, NVwZ 1998 S. 98). Die staatsbürgerschaftliche Voraussetzung muss am Wahltag erfüllt sein, eine Wartezeit gibt es nicht.
52.1.2 Wahlalter. Weitere Voraussetzung der Wahlberechtigung ist seit der Herabsetzung des Wahlalters durch Gesetz v. 20.11.1995 (GVBl. S. 432), dass der Wähler am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist (§ 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NKomVG), so dass wahlberechtigt ist, wer am Wahltag 16 Jahre alt wird. Die Herabsetzung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre verstößt nicht gegen die Verfassung (VG Hannover, Urt. v. 3.7.1997, VwRR N 1999 S. 11).
62.1.3 Wohnsitz. Zu den Wahlrechtsvoraussetzungen gehört ferner die Innehabung eines Wohnsitzes seit drei Monaten in der Kommune (§ 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NKomVG), d. h. für die Gemeindewahl in der Gemeinde, für die Samtgemeindewahl in einer Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde, für die Kreiswahl im Kreisgebiet, für die Regionswahl im Regionsgebiet, für die Wahl zum Stadtbezirksrat im Stadtbezirk und zum Ortsrat in der Ortschaft (§ 91 Abs. 2 NKomVG) und zur Einwohnervertretung im gemeindefreien Bezirk (§ 5 Abs. 1 der VO über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete). Dahinter steht der Gedanke, dass nur derjenige an der Wahl teilnehmen soll, der in einem Mindestmaß mit den Gegebenheiten und Problemen des Wahlgebietes vertraut und als Bürger von der Wahlentscheidung selbst mitbetroffen ist (BVerfG, Beschl. v. 30.3.1992, NVwZ 1993 S. 55).
7Seit der Wahlrechtsnovelle vom 24.1.2001 (GVBl. S. 15) bestimmt sich der Wohnsitzbegriff nicht mehr nach § 7 BGB, sondern nach den melderechtlichen Vorschriften (§ 28 Abs. 1 NKomVG), womit ausgeschlossen wird, dass ein Wohnsitz an mehreren Orten besteht (§ 7 Abs. 2 BGB). Wohnsitz ist der Ort der Wohnung, als die § 20 BMG jeden umschlossenen Raum definiert, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird und als die auch die Unterkunft an Bord eines Schiffes der Bundeswehr in dessen Heimathafen gilt (NdsOVG, Beschl. v. 20.6.2011, R&R 1/2012 S. 1), Wohnwagen und -schiffe im Gebiet des Aufstellungs- oder Liegeplatzes aber nur dann, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden. Für Schiffsbesatzungen ist auf § 28 BMG, für den diplomatischen und konsularischen Dienst auf § 26 BMG, für das Beziehen einer Gemeinschaftsunterkunft der Bundeswehr oder des Bundesgrenzschutzes auf § 27 BMG, für vorübergehende Aufenthalte, z. B. auch zur Verbüßung einer Haftstrafe, auf § 27 Abs. 4 BMG und für Krankenhäuser und Heime auf § 32 BMG zu verweisen.
8Wer im Bundesgebiet mehrere Wohnungen hat, hat seinen Wohnsitz am Ort der Hauptwohnung und kann nur dort wählen (§ 28 Abs. 1 Satz 3 NKomVG); liegt die Hauptwohnung im Ausland, genügt für die Wahlberechtigung eine Nebenwohnung im Wahlgebiet. Welches bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung ist, bestimmt sich nach § 22 BMG, regelmäßig also danach, welches bei vorrangig quantitativer Berechnung (NdsOVG, Beschl. v. 25.4.2014, NdsVBl. 2014 S. 321) die vorwiegend benutzte Wohnung ist (§ 21 Abs. 2 BMG), in Zweifelsfällen, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen liegt (§ 22 Abs. 3 BMG). Für bestimmte Personen, Verheiratete und eine Lebenspartnerschaft Führende, Minderjährige und Behinderte, enthält § 22 BMG eine gesetzliche Vermutung der Hauptwohnung; die gesetzliche Vermutung für Verheiratete und eine Lebenspartnerschaft Führende ist auf sonstige Familienangehörige nicht übertragbar (NdsOVG, Beschl. v. 20.6.2011 a. a. O.). Weist jemand nach, dass der Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen sich am Ort seiner Nebenwohnung befindet, dann ist er auch ohne Hauptwohnsitz im Wahlgebiet dort wahlberechtigt (§ 28 Abs. 1 Satz 4 NKomVG). Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann dieser Nachweis nur von der betreffenden Person geführt werden, nicht auch von der Behörde, etwa um diese Person in die Wahlleitung (§ 9 Abs. 1) oder einen Wahlvorstand (§ 11 Abs. 1) berufen zu können. Die Meldebehörde hat jedoch das Melderegister notfalls von Amts wegen zu berichtigen (§ 6 Abs. 1 BMG; s. auch VG Hannover, Urt. v. 23.3.2005, R&R 4/2006 S. 11 und NdsOVG, Beschl. v. 20.6. 2011 a. a. O.).
9Als Wohnsitz von Personen ohne Wohnung gilt der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts (§ 28 Abs. 1 Satz 5 NKomVG). Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I, der einen allgemeingültigen Grundsatz enthält, hat jemand den gewöhnlichen Aufenthalt dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt (s. auch BVerwG, Urt. v. 4.6.1997, NVwZ-RR S. 751).
Die Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte aus EU-Staaten sind nicht meldepflichtig. Als Nachweis für das Vorliegen der Wohnsitzvoraussetzungen genügen bei ihnen amtliche Bestätigungen der zuständigen Dienststellen der Streitkräfte.
Zum Wohnungswechsel s. § 18 Rn 3.
10Im Falle von Gebietsänderungen gilt nach § 27 Abs. 3 NKomVG der Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gebietskörperschaft vor der Gebietsänderung als Wohnsitz oder Aufenthalt in der neuen Gebietskörperschaft. Das gilt nach § 27 Abs. 3 Satz 2 NKomVG auch für gemeindefreie Bezirke und entsprechend für Stadtbezirke und Ortschaften im Falle einer Änderung ihrer Grenzen, die nur zum Ende einer Wahlperiode möglich ist (§ 90 Abs. 4 NKomVG).
11Für die Berechnung der Drei-Monats-Frist gelten die §§ 187 Abs. 2, 188 Abs. 2 BGB, wobei aber der Tag der Wohnsitzbegründung entsprechend der Regelung in § 2 Satz 2 NLWG und § 12 Abs. 5 BWG mitzählt (§ 48 Abs. 1 Satz 2 NKomVG), so dass bei einer am 6.10. stattfindenden Wahl die Frist erfüllt ist, wenn der Wohnsitz am 6.7. begründet worden ist. Die Dreimonatsfrist beginnt nach dem Wortlaut des Gesetzes („seit“) mit der letzten Wohnsitzbegründung, eine Anrechnung von Wohnsitzzeiten vor einer zwischenzeitlichen Verlegung der Hauptwohnung oder des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen bei einer Nebenwohnung ist nicht möglich.
122.1.4 Ausschlussgründe. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse für Menschen mit Behinderungen vom 27. März 2019 (Nds. GVBl. S. 70) sind die Wahlrechtsausschlüsse im Kommunal- und Landeswahlrecht für Betreute in allen Angelegenheiten und für wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter (vgl. die bis dahin geltenden Regelungen in § 48 Abs. 2 Nrn. 1 und 3 NKomVG und § 3 Nr. 2 und 3 NLWG) abgeschafft worden. Der Gesetzgeber reagierte damit auf die am 21. Februar 2019 veröffentlichte Entscheidung des BVerfG, mit der es § 13 Nr. 2 BWahlG für unvereinbar mit Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 und Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG erklärt hat. Die Vorschrift verfehle jedenfalls die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine gesetzliche Typisierung, indem der Kreis der Betroffenen ohne hinreichenden sachlichen Grund in gleichheitswidriger Weise bestimmt werde. § 13 Nr. 3 BWahlG sei ebenfalls mit Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 und Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG unvereinbar und zudem nichtig. Die Vorschrift sei nicht geeignet, Personen zu erfassen, die typischerweise nicht über die Fähigkeit zur Teilnahme am demokratischen Kommunikationsprozess verfügten (BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 29. Januar 2019, 2 BvC 62/14, www.bverfg.de). Diese Maßgaben des BVerfG sah der Gesetzgeber als auf das niedersächsische Recht übertragbar an (siehe die Ausführungen in dem Schriftlichen Bericht, LT-Drs. 18/3343).
13Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind demnach nur noch Personen, die durch Entscheidung eines Gerichts nach deutschem Recht kein Wahlrecht besitzen (§ 48 Abs. 2 NKomVG). Hauptanwendungsfälle der Aberkennung des Wahlrechts sind der fünfjährige gesetzliche Verlust infolge Verurteilung zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe wegen eines Verbrechens (§ 45 Abs. 1 StGB) und die Aberkennung für die Dauer von zwei bis fünf Jahren als Nebenfolge einer Verurteilung durch ein deutsches Strafgericht nach § 45 Abs. 5 StGB. Der Verlust des Wahlrechts wird mit der Rechtskraft des Strafurteils wirksam (§ 45a Abs. 1 StGB), die Dauer rechnet aber erst von dem Tage an, an dem die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist oder eine neben der Freiheitsstrafe angeordnete freiheitsentziehende Maßnahme der Besserung und Sicherung erledigt ist (§ 45a Abs. 2 StGB). In einer Entscheidung über die Verwirkung von Grundrechten (Art. 18 GG) kann das Bundesverfassungsgericht auch die Verwirkung des Wahlrechts anordnen (§ 39 Abs. 2 BVerfGG). Zur Mitteilungspflicht s. oben Rn. 3.
142.2 Wählbarkeit. An die Wählbarkeit als Abgeordneter, d. h. als Ratsfrau oder Ratsherr der Gemeinde oder Samtgemeinde, als Kreistags- oder Regionsabgeordneter (§ 2 Abs. 2), und als Mitglied des Stadtbezirksrates, des Ortsrates und der Einwohnervertretung, das insoweit den Ratsmitgliedern gleichgestellt ist (§ 91 Abs. 2 Satz 1 NKomVG, § 5 Abs. 1 der VO über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete) sowie als Hauptverwaltungsbeamter, d. h. als hauptamtlicher Bürgermeister, Samtgemeindebürgermeister, Landrat oder Regionspräsident (§ 7 Abs. 2 NKomVG), werden höhere und andere Anforderungen gestellt als an die Wahlberechtigung.
152.2.1 Abgeordnete und Gleichgestellte. Die Abgeordneten und die ihnen Gleichgestellten müssen am Wahltag 18 Jahre alt sein (§ 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NKomVG). Diese Voraussetzung erfüllt auch, wer am Wahltag 18 Jahre alt wird. Ein Höchstalter, bei dessen Vollendung eine Kandidatur nicht mehr möglich ist, gibt es nicht.
16Weiterhin ist nur wählbar, wer am Wahltag dauerhaft seit mindestens sechs Monaten seinen Wohnsitz im Wahlgebiet hat, wobei für den Begriff des Wohnsitzes dieselben Grundsätze gelten wie beim Wahlrecht (§ 49 Abs. 1 Sätze 1 Nr. 2 und 2 NKomVG; s. oben Rn 6 ff). Zur Berechnung der Frist s. oben Rn 11. Zum Sitzverlust bei Aufgabe des Wohnsitzes s. unten Rn 35.
17Wählbar ist außerdem nur, wer am Wahltag Deutscher i. S. des Art. 116 Abs. 1 GG oder Unionsbürger ist (§ 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NKomVG; s. oben Rn 4). Die Regelung, dass wählbar nur ist, wer am Wahltag seit mindestens einem Jahr Deutscher oder Unionsbürger ist, ist durch Gesetz v. 18.5.2006 (GVBl. S. 202) aufgehoben worden.
18Von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind alle, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, d. h. nach § 48 Abs. 2 NKomVG nicht wählen dürfen (s. oben Rn 12 f), denen richterlich die Wählbarkeit und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt ist und die als Unionsbürger infolge einer Gerichtsentscheidung ihres Herkunftslandes die Wählbarkeit nicht besitzen (§ 49 Abs. 2 NKomVG).
19Wie das Wahlrecht kann auch die Wählbarkeit infolge der Entscheidung eines deutschen Gerichts ausgeschlossen sein. Wer wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, verliert automatisch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter und die Wählbarkeit für die Dauer von fünf Jahren (§ 45 Abs. 1 StGB). Wenn das gesetzlich vorgesehen ist, kann das Gericht dem Verurteilten diese Rechte auch für die Dauer von zwei bis fünf Jahren aberkennen (§ 45 Abs. 2 StGB). Außerdem kann das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung über die Verwirkung von Grundrechten (Art. 18 GG) wie das Wahlrecht (s. oben Rn 13) auch die Wählbarkeit aberkennen (§ 39 Abs. 2 BVerfGG). Ein nichtdeutscher Unionsbürger kann nicht gewählt werden, wenn er nach dem Recht seines Herkunftsmitgliedstaates infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung die Wählbarkeit nicht besitzt. Bewirbt er sich, dann hat er darüber, dass er weder durch Richterspruch nach dem Recht seines Heimatlandes noch und insoweit anders als der deutsche Bewerber nach deutschem Recht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist (§ 32 Abs. 5 NKWO).
20Vom Ausschluss von der Wählbarkeit zu unterscheiden ist die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat (§ 50 NKomVG). Liegt eine Unvereinbarkeit (Inkompatibilität) vor, kann der Bewerber zwar kandidieren, muss sich aber nach seiner Wahl zwischen Amt und Mandat entscheiden; fehlt die Wählbarkeit (Ineligibilität) ist bereits die Bewerbung um das Mandat ausgeschlossen. Art. 137 Abs. 1 GG lässt die Beschränkung der Wählbarkeit für Angehörige des öffentlichen Dienstes, Arbeiter ausgenommen, zu. Diese ist nur in Gestalt einer Unvereinbarkeitsregelung, nicht dagegen auch eines – auch zeitlich begrenzten – Ausschlusses von der Wählbarkeit zulässig (BVerfG, Beschl. v. 7.4.1981, BVerfGE 57 S. 43). Zur Annahme der Wahl im Falle einer Inkompatibilität s. unten Rn 42 und § 40 Rn 4.
21Auch Richter sind nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen. Zwar dürfen im Hinblick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung Richter nach § 4 Abs. 1 DRiG nicht gleichzeitig Aufgaben der rechtsprechenden, der gesetzgebenden und der vollziehenden Gewalt wahrnehmen. Aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift ergibt sich aber, dass ein Ausschluss der Übernahme eines kommunalen Mandats nicht beabsichtigt ist (s. näher StGH Bremen, Urt. v. 12.5.1978, DRiZ S. 248, OVG Münster, Urt. v. 20.7.1989, NWVBl. S. 437). Ebenso wenig ist den Angehörigen des Landesrechnungshofs durch § 8 Abs. 2 LRHG die Übernahme eines kommunalen Mandats verwehrt (OVG Lüneburg, Urt. v. 27.7.1990 – 5 L 38/89 –).
222.2.2 Hauptverwaltungsbeamte. Die Wählbarkeit zum Hauptverwaltungsbeamten ist in den § 80 Abs. 5 NKomVG geregelt.
Danach ist wählbar, wer am Wahltag das 23., aber noch nicht das 67. Lebensjahr vollendet hat. Bei der Berechnung des Lebensalters nach § 187 Abs. 2 BGB ergibt sich, dass wählbar ist, wer am Wahltag 23, aber nicht mehr wählbar, wer am Wahltag 67 Jahre alt wird. Maßgeblicher Wahltag ist für das Mindestalter der Tag der ersten Wahl (§ 45d); für einen neuen Bewerber bei einer Wiederholungswahl (§ 45m Abs. 2) ist deren Tag maßgebend. Dagegen ist für das Höchstalter maßgebender Wahltag der Tag, an dem die Wahl stattfindet, so dass, wer nach der ergebnislosen ersten Wahl, aber vor einer sich anschließenden Stich- oder Wiederholungswahl das 67. Lebensjahr vollendet, nicht mehr wählbar ist. Die Altersgrenze für die Wählbarkeit ist verfassungsgemäß (BVerfG, Beschl. v. 25.7.1997, NVwZ 1997 S. 1207 = VwRR N 1997 S. 10).
23Voraussetzung der Wählbarkeit zum Hauptverwaltungsbeamten ist der Besitz der Staatsangehörigkeit Deutschlands oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (s. oben Rn 4); eine bestimmte Dauer des Besitzes der Staatsangehörigkeit ist nicht mehr vorgeschrieben. Gegen die Wahl eines nichtdeutschen Unionsbürgers zum Hauptverwaltungsbeamten bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (BVerfG, Beschl. v. 8.1.1997, NVwZ 1998 S. 52), jedoch wäre auch der Ausschluss der Wählbarkeit rechtlich zulässig (BVerfG, Beschl. v. 14.10.1998, NVwZ 1999 S. 293).
24Weitere Voraussetzung der Wählbarkeit ist, dass der Bewerber die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten. Diese Gewähr ist bei jeder Berufung in das Beamtenverhältnis Voraussetzung (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG), die bei den Hauptverwaltungsbeamten unmittelbar aufgrund der Wahl und deren Annahme, nicht durch eine Ernennung erfolgt (§ 80 Abs. 6 Satz 3 NKomVG) und deshalb eine Wählbarkeitsvoraussetzung sein muss. Sie ist als erfüllt anzusehen, solange keine wesentlichen Anhaltspunkte für die Annahme des Gegenteils vorliegen.
25Zum Hauptverwaltungsbeamten kann nicht gewählt werden, wer nach § 49 Abs. 2 NKomVG von der Wählbarkeit zur Vertretung ausgeschlossen ist, d. h. das Wahlrecht infolge der richterlichen Aberkennung (s. oben Rn 13) oder als Deutscher oder Unionsbürger die Wählbarkeit infolge richterlicher Entscheidung (s. oben Rn 18) nicht besitzt.
Anders als bei der Wählbarkeit zu den Vertretungen ist für die Wählbarkeit zum Hauptverwaltungsbeamten der Wohnsitz im Wahlgebiet nicht Voraussetzung, damit auch qualifizierte auswärtige Bewerber berufen werden können.
262.3 Wahlperiode der Abgeordneten, Amtsdauer der Hauptverwaltungsbeamten. Die 1976 von vier auf fünf Jahre verlängerte Wahlperiode der Vertretungen beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober jedes fünften auf das Jahr 2011 folgenden Jahres (§ 47 Abs. 2 NKomVG). Die Wahlperiode einer aufgelösten Vertretung endet mit der Feststellung der Auflösung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 70 Abs. 1 NKomVG) und die für die nach der Auflösung neu gewählten Abgeordneten beginnt mit dem Tag der Neuwahl und endet mit dem Ablauf der allgemeinen Wahlperiode (§ 70 Abs. 4 Satz 1 NKomVG). Findet in einem Wahlgebiet innerhalb von zwei Jahren vor Ablauf der allgemeinen Wahlperiode eine einzelne Neuwahl oder eine Wiederholungswahl statt, dann endet die Wahlperiode mit dem Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode (§§ 42 Abs. 5, 43 Abs. 3 i. V. m. § 70 Abs. 4 Satz 2 NKomVG).
27Für die Wahlperiode der Stadtbezirks- und Ortsräte gilt dasselbe wie für die des Rates, sie sind jedoch bei Auflösung des Rates und Ungültigkeit seiner Wahl ebenfalls aufgelöst (§ 91 Abs. 7 NKomVG). Im Falle der Wiederholungswahl des Rates nach § 42 Abs. 3 Satz 2 nehmen sie allerdings daran nicht teil (s. § 42 Rn 6).
28Eine gesetzliche Verlängerung der laufenden Wahlperiode ist nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig. Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass die Verlängerung im Verhältnis zur Dauer der regulären Wahlperiode gering ist und wichtige Gründe des Gemeinwohls sie rechtfertigen (BVerfG, Beschl. v. 8.8.1972, MBl. S. 1212: Verlängerung im Zusammenhang mit der Gemeindereform).
29Die Hauptverwaltungsbeamten werden nach der Synchronisierung ihrer Wahl und Amtszeit mit der Wahl und der Wahlperiode der Vertretungen durch Gesetz vom 16.12.2013 (GVBl. S. 307), durch das die mit Gesetz vom 22.4.2005 (GVBl. S. 110) eingeführte achtjährige Amtszeit wieder abgeschafft worden ist, wie vor 2005 im Regelfall für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt (§ 80 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NKomVG). Eine Verkürzung der Amtszeit auf die restliche laufende Wahlperiode ergibt sich dann, wenn die Annahme der Wahl infolge einer erst nach Beginn der Wahlperiode stattfindenden Stichwahl, Nachwahl, Wiederholungswahl binnen sechs Monaten nach der ersten Wahl oder neuen Direktwahl erfolgt (§ 80 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 NKomVG), und eine Verlängerung auf die restliche laufende und die folgende Wahlperiode, wenn die Wahl und ihre Annahme aus anderen Gründen erst während der Wahlperiode erfolgt (§ 80 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 NKomVG).
302.4 Zahl der Abgeordneten und Gleichgestellten. Die Zahl der zu wählenden Abgeordneten (s. deren Definition in § 2 Abs. 2) beträgt abhängig von der Einwohnerzahl (§ 46 NKomVG) bei den Ratsfrauen und Ratsherren in den Gemeinden und Samtgemeinden von 6 (bis 500 Einwohner) bis 66 (mehr als 600 000 Einwohner), in den Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden in jeder Größenklasse jeweils ein Mandat mehr, und bei den Kreistagsabgeordneten von 42 (bis 100 000 Einwohner) bis 70 (mehr als 400 000 Einwohner) und ist bei den Regionsabgeordneten gesetzlich auf 84 festgelegt. Durch Satzung kann bis spätestens 18 Monate vor dem Ende der Wahlperiode die jeweilige Zahl um 2, 4 oder 6 verringert werden, in Gemeinden und Samtgemeinden jedoch erst bei mehr als 8000 Einwohnern und so, dass die Zahl von 20 nicht unterschritten wird (§ 46 Abs. 4 NKomVG); bei der Vereinigung oder Neubildung von Gemeinden und Landkreisen sowie der Neu- und Umbildung und dem Zusammenschluss von Samtgemeinden kann die jeweilige Zahl bis zum Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode um dieselben Zahlen durch übereinstimmende Satzungen der beteiligten Kommunen, bei Maßnahmen von Samtgemeinden durch deren Hauptsatzung erhöht werden (§ 46 Abs. 5 NKomVG). Nach dem Wortlaut des § 46 Abs. 4 Satz 2 muss die Vertretung die Entscheidung über die Satzung zur Verringerung der Zahl bis zum Stichtag treffen. Ein Inkrafttreten der Satzung bis zu diesem Zeitpunkt wird also nicht zwingend vorausgesetzt. Gleichwohl sollte die die Verkündung zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Die Verringerung wirkt nur für die bevorstehende Wahlperiode und muss erneuert werden, wenn sie auch für die dann folgende Wahlperiode wirksam sein soll. Die Satzungen zur Erhöhung der Zahl müssen vor Verkündung des Vereinigungs- oder Neubildungsgesetzes verkündet sein (§ 46 Abs. 5 Satz 3 NKomVG). Die Fehlerhaftigkeit der Verringerung oder Erhöhung kann mit dem Wahleinspruch geltend gemacht werden (VG Göttingen, Urt. v. 21.3.2007, R&R 3/2007 S. 3).
31Für die Bestimmung der Zahl der Abgeordneten ist, von der Region Hannover abgesehen, die Einwohnerzahl maßgebend, die die Landesstatistikbehörde aufgrund einer Volkszählung oder deren Fortschreibung für einen mindestens zwölf und höchstens 18 Monate vor dem Wahltag liegenden Stichtag ermittelt hat; regelmäßiger Stichtag ist der 30. Juni des der Wahl vorangehenden Jahres, jedoch kann auch ein davon abweichender Stichtag gewählt werden. Mit Rücksicht auf das Wahlrecht der Unionsbürger erhöht sich die Einwohnerzahl um drei für jede von nichtkaserniertem Personal der Stationierungsstreitkräfte und dessen Angehörigen am 30. Juni des vergangenen Jahres belegte und der Landesstatistikbehörde gemeldete Wohnung, soweit das Personal von Mitgliedstaaten der Europäischen Union gestellt wird (§ 52; § 177 NKomVG); das kasernierte Personal bleibt insoweit unberücksichtigt. Der vorgegebene Zeitraum ist nach den Kommunalwahlen 1986 um ein halbes Jahr vorverlegt worden (Gesetz v. 26.11.1987, GVBl. S. 214). Bis zur Vorlage ihres Ergebnisses bleibt auch im Jahr einer Volkszählung die fortgeschriebene Einwohnerzahl maßgebend.
32Die Zahl der Mitglieder der Einwohnervertretung des gemeindefreien Bezirks ist von der Einwohnerzahl abhängig, für deren Ermittlung § 177 NKomVG entsprechend gilt (§ 5 Abs. 1 der VO über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete). Der Stadtbezirksrat hat halb so viele Mitglieder, wie eine Gemeinde mit der Einwohnerzahl des Stadtbezirks Ratsmitglieder hätte (§ 91 Abs. 1 Satz 2 NKomVG), wobei die Einwohnerzahl für den Stichtag nach § 177 NKomVG von der Stadt zu ermitteln ist. Die Zahl der Ortsratsmitglieder bestimmt die Hauptsatzung, jedoch muss sie mindestens fünf betragen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 NKomVG).
332.5 Sitzerwerb der Abgeordneten, Amtsbeginn der Hauptverwaltungsbeamten. Die Mitgliedschaft in der Vertretung, mit deren Beginn der Sitz erworben wird, beginnt für die Abgeordneten (§ 2 Abs. 2) mit der Annahme der Wahl, die nach § 40 erfolgt, frühestens aber mit dem Beginn der Wahlperiode, bei einer nicht im gesamten Wahlgebiet durchgeführten Nachwahl oder einer Wiederholungswahl sowie beim Nachrücken als Ersatzperson frühestens mit dem Beschluss der Vertretung (§ 52 Abs. 2 NKomVG) über das Vorliegen der betreffenden Voraussetzungen (§ 51 NKomVG). Nach dem Beschluss der Vertretung kann die in der Nachwahl oder Wiederholungswahl gewählte Person oder die nachrückende Ersatzperson an der Sitzung teilnehmen, sofern sie die Annahmeerklärung abgegeben hat. Zur Annahme der Wahl s. Erl. zu § 40 und § 44 Rn 17.
34Die Hauptverwaltungsbeamten sind kraft Amtes Mitglied der jeweiligen Vertretung (§ 45 Abs. 1 Satz 2 NKomVG). Sie treten ihr Amt mit der Begründung des Beamtenverhältnisses an und werden zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Vertretung. Das Beamtenverhältnis wird, ohne dass es einer Ernennung bedarf (§ 7 Abs. 4 NBG), mit dem Tag der Annahme der Wahl (s. Erl. zu § 45h) begründet, jedoch frühestens mit dem Beginn der Wahlperiode, wenn der Hauptverwaltungsbeamte zusammen mit den Abgeordneten in einer allgemeinen Direktwahl gewählt worden ist, mit dem Wirksamwerden der Neu- oder Umbildung oder des Zusammenschlusses von Kommunen (i. S. von § 1 Abs. 1 NKomVG) oder mit dem Beginn des Antragsruhestandes (§ 83 NKomVG) des bisherigen Amtsinhabers (§ 80 Abs. 6 NKomVG).
352.6 Sitzverlust der Abgeordneten, Abwahl der Hauptverwaltungsbeamten. Die Mitgliedschaft in der Vertretung endet vor Ablauf der Wahlperiode für Abgeordnete (§ 2 Abs. 2) außer im Falle des Todes
– durch Verzicht, der dem Hauptverwaltungsbeamten schriftlich, aber nicht elektronisch, erklärt werden muss und unwiderruflich ist (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NKomVG),
– durch Verlust der Wählbarkeit oder nachträgliche Feststellung ihres Fehlens zur Zeit der Wahl (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NKomVG),
– durch Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei durch das Bundesverfassungsgericht (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NKomVG),
– durch Berichtigung des Wahlergebnisses oder seine Neufeststellung aufgrund einer Neuwahl oder Wiederholungswahl (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NKomVG),
– durch eine Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren, nach der die Wahl des Rates oder des Ratsmitgliedes ungültig ist (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 NKomVG),
– durch Wegfall der Gründe für das Nachrücken als Ersatzperson (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 NKomVG),
– durch ergebnislosen Ablauf der Fristen für den Nachweis, dass die zur Auflösung einer Unvereinbarkeit erforderlichen Maßnahmen getroffen worden sind (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 NKomVG),
– durch Verwendung in einem eine Unvereinbarkeit begründenden Dienstverhältnis (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 NKomVG).
Der Sitzverlust tritt nach diesem Katalog nicht und auch nicht analog § 44 Abs. 2 ein, wenn ein gewählter Bewerber vor der Annahme der Wahl aus der Partei, auf deren Vorschlag er gewählt worden ist, ausgetreten oder ausgeschlossen worden ist (VG Hannover, Urt. v. 21.2.2007, R&R 3/2007 S. 9).
36Dazu im Einzelnen:
Der Verzicht kann nicht für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt erklärt werden, sondern wird mit dem Beschluss der Vertretung wirksam, mit dem das Vorliegen seiner Voraussetzungen festgestellt wird, wenn er nicht für einen künftigen Zeitpunkt gelten soll; eine solche Zeitbestimmung stellt keine unzulässige Bedingung dar (a. A. VG Osnabrück, Urt. v. 30.8.2005, R&R 6/2005 S. 4). Die Erklärung ist entsprechend § 123 BGB wegen arglistiger Täuschung oder Drohung anfechtbar (OVG Lüneburg, Urt. v. 24.1.1954, OVGE 4 S. 139; Hess.VGH, Urt. v. 16.8.1983, Fundstelle 1984 Nr. 142); für die Anfechtbarkeit wegen Irrtums entsprechend § 119 BGB soll das mit Rücksicht auf den Vertrauensschutz des Nachrückers nicht gelten (OVG Lüneburg a. a. O., Hess.VGH a. a. O., VG Stade, Urt. v. 31.3.1987 – VG A 568/86 –), obwohl der Verzicht erst nach der Anhörung des Abgeordneten, bei der er spätestens Kenntnis von dem Anfechtungsgrund erlangt, und dem Beschluss der Vertretung, nicht schon mit dem Zugang beim Hauptverwaltungsbeamten (VG Braunschweig, Urt. v. 30.11.1984 – 1 VG A 11/84 –; VG Stade, Beschl. v. 5.12.1984 – 1 VG D 47/84 –), wirksam wird. Mit welcher Motivation der Verzicht erklärt wird, ist für seine Wirksamkeit angesichts der Freiheit des Mandats unerheblich.
37Die Voraussetzungen der Wählbarkeit müssen nicht nur im Zeitpunkt der Wahl, sondern während der gesamten Wahlperiode erfüllt sein. Gibt ein Gewählter seinen Wohnsitz im Wahlgebiet auf, verliert er die Staatsangehörigkeit als Deutscher und als Unionsbürger oder tritt nachträglich eine Voraussetzung für den Ausschluss der Wählbarkeit ein, dann endet die Mitgliedschaft in der Vertretung. Daran ändert auch nichts, wenn später die Wählbarkeitsvoraussetzungen wieder erfüllt werden. Der Sitzverlust tritt auch dann ein, wenn nachträglich festgestellt wird, dass der Gewählte eine Voraussetzung zum Zeitpunkt der Wahl nicht erfüllt hat; auch in diesem Fall hilft die nachträgliche Erfüllung der fehlenden Voraussetzung nichts. Beschlüsse, an denen ein nicht wählbarer Vertreter mitgewirkt hat, bleiben wirksam, weil das Mandat bis zur Feststellung des Sitzverlustes wirksam ausgeübt worden ist (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 18.3.1985, DÖV 1986 S. 156). Zum Verlust der Wählbarkeit nach der Wahl, aber vor Zuteilung der Sitze und zum Bekanntwerden des Verlustes nach Feststellung des Wahlergebnisses s. § 36 Abs. 5 Sätze 2 und 3.
38Art. 21 Abs. 2 GG erklärt Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefährden, für verfassungswidrig und weist die Entscheidung darüber dem Bundesverfassungsgericht zu. Stellt das Gericht die Verfassungswidrigkeit einer Partei oder einer ihrer Teilorganisationen, z. B. eines ihrer Landesverbände fest, dann verlieren alle Abgeordneten, die Mitglieder dieser Partei oder ihrer Teilorganisation sind oder auf dem Wahlvorschlag dieser Partei oder Teilorganisation kandidiert haben, ihre Mandate (§ 52 Abs. 3 NKomVG). Der Sitzverlust tritt nach dem die Voraussetzungen feststellenden Beschluss der Vertretung ein.
39Auch der Verlust der Mitgliedschaft in der Vertretung infolge einer Berichtigung des Wahlergebnisses (§ 48 Abs. 2 Nr. 2) oder seiner Neufeststellung wegen einer Nachwahl oder Wiederholungswahl, die dann erfolgt, wenn diese Wahlen nur in einem Teil des Wahlgebiets stattgefunden haben (§§ 41 Abs. 4, 42 Abs. 4), tritt nicht schon mit diesen wahlrechtlichen Entscheidungen ein, sondern erst nach dem Beschluss der Vertretung über das Vorliegen der Voraussetzungen (VG Oldenburg, Urt. v. 5.5.1977 – II A 63.77 S –).
40Wird die Wahl der Vertretung insgesamt oder in einem Wahlbereich oder Wahlbezirk im Wahlprüfungsverfahren für ungültig erklärt (§ 48 Abs. 2 Nr. 2), dann findet eine Wiederholungswahl statt (§ 42 Abs. 1), wobei nach einer Wiederholungswahl im gesamten Wahlgebiet für die Wahlperiode § 70 Abs. 4 NKomVG gilt (§ 42 Abs. 5); wird die Wahl von einzelnen Abgeordneten für ungültig erklärt, rücken für sie für den Rest der Wahlperiode Ersatzpersonen nach (§ 44 Abs. 1). Der Sitzverlust tritt für die bisherigen Abgeordneten mit dem Wirksamwerden des Beschlusses der Vertretung über die Wahlprüfungsentscheidung (§ 47 Abs. 1) ein, für einen weiteren Beschluss über die Voraussetzungen für den Verlust ist kein Raum.
41Die Gründe für das Nachrücken als Ersatzperson sind dann weggefallen, wenn der ursprüngliche Abgeordnete die Feststellung des Verlustes seiner Mitgliedschaft erfolgreich angefochten hat und in die Vertretung zurückgekehrt ist.
42Im Falle einer Unvereinbarkeit von Amt und Mandat (§ 50 Abs. 1 und 2 NKomVG) hat der Gewählte bei der Annahme der Wahl innerhalb der dafür bestehenden Frist (s. § 40 Rn 1) dem Wahlleiter die Einleitung der Beendigung des Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnisses (s. zu den Folgen der nicht erfolgten Einleitung § 40 Rn 4) und innerhalb von vier Monaten nach Annahme der Wahl und, wenn die Unvereinbarkeit erst nachträglich festgestellt wird, innerhalb eines Monats seit ihrer Feststellung dem Hauptverwaltungsbeamten die Beendigung nachzuweisen. Führt er den Nachweis der Beendigung nicht zeitgerecht, verliert er mit Ablauf der Frist sein Mandat, was der Wahlleiter feststellt (§ 50 Abs. 3 NKomVG).
Geht ein Abgeordneter in der laufenden Wahlperiode ein Dienstverhältnis ein, das mit seinem Mandat unvereinbar ist, dann verliert er dieses, wenn er nicht innerhalb von vier Monaten seit der Eingehung die Beendigung des Dienstverhältnisses nachweist (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 NKomVG).
43Die Rechtsnatur des Beschlusses der Vertretung über das Vorliegen der Voraussetzungen des Sitzverlustes (§ 52 Abs. 2 NKomVG), der außer in den Fällen der schon bei Annahme der Wahl bestehenden Unvereinbarkeit nur bei einer Wahlprüfungsentscheidung, nach der die Wahl der Vertretung oder eines Abgeordneten ungültig ist, und in dem gesetzlich nicht behandelten Fall des Todes eines Abgeordneten nicht gefasst werden muss, ist unklar. Er hat nicht die Feststellung des Sitzverlustes zum Inhalt. Nur für den Fall, dass der Nachweis über die Beendigung einer Unvereinbarkeit nicht geführt ist (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 NKomVG), ist gesetzlich geregelt, dass diesen nach dem Beschluss der Vertretung der Wahlleiter feststellt (§ 50 Abs. 3 Satz 6 NKomVG). In den anderen Fällen fehlt es seit der Änderung des § 41 NGO als Vorgängervorschrift des § 52 NKomVG (Gesetz v. 18.4.1963, GVBl. S. 255) und des § 32 NLO (Gesetz v. 26.4.1968, GVBl. S. 69), durch die die Bestimmung, dass die Vertretung den Sitzverlust feststellt, ersatzlos gestrichen worden ist, an einer solchen gesetzlichen Regelung im NKomVG (s. Anm. zu VG Hannover, Beschl. v. 9.7.2004, R&R 5/2004 S. 1). Allerdings stellt der Wahlausschuss oder der Wahlleiter nach dem Tod oder dem Sitzverlust eines Abgeordneten den Sitzübergang auf die Ersatzperson fest (§ 44 Abs. 1 und 5). Man wird also annehmen müssen, dass in der Feststellung des Sitzübergangs zumindest auch konkludent der Sitzverlust festgestellt wird. Der betroffene Abgeordnete ist von der Mitwirkung an dem Beschluss über das Vorliegen der Voraussetzungen, der keine unmittelbaren Auswirkungen entfaltet (§ 41 Abs. 1 Satz 2 NKomVG), nicht ausgeschlossen. Der Feststellungsbeschluss der Vertretung kann selbstständig, also nicht im Rahmen eines Wahlprüfungsverfahrens angefochten werden (so ausdrücklich VG Osnabrück Urt. v. 30.8.2005, R&R 6/2005 S. 4, bestätigt durch NdsOVG, Beschl. v. 29.1.2007, R&R 2/2007 S. 7). Im Hinblick auf den innerorganisatorischen und Mitgliedschaftsrechte berührenden Charakter der Entscheidung bedarf sie nicht der Vorbereitung durch den Hauptausschuss und kommt dafür die kommunale Verfassungsstreitigkeit in Betracht (so auch VG Osnabrück, Urt. v. 30.8.2005 a. a. O.). Zur Anfechtbarkeit der Feststellung des Sitzübergangs s. § 49a.
Zur Berufung einer Ersatzperson nach einem Sitzverlust s. Erl. zu §§ 44 und 45.
44Die Amtszeit des Hauptverwaltungsbeamten endet regelmäßig mit dem Ende der fünfjährigen allgemeinen Wahlperiode der Abgeordneten, für die er gewählt worden ist, auch wenn die Stichwahl, Nachwahl, Wiederholungswahl oder neue Direktwahl erst nach deren Beginn erfolgt, in sonstigen Fällen einer Wahl während einer Wahlperiode mit dem Ende der darauf folgenden (§ 80 Abs. 3 NKomVG) oder vorzeitig mit der Versetzung in den Ruhestand auf Antrag aus besonderen Gründen (§ 84 NKomVG) oder nach Vollendung des 65. Lebensjahres und Absolvierung von fünf Jahren in der laufenden Amtszeit (§ 83 NKomVG), ferner durch Entlassung (§ 23 BeamtStG, § 31 NBG), Verlust der Beamtenrechte (§ 24 BeamtStG, § 33 NBG) oder Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit (§ 26 BeamtStG, § 43 NBG). Sie kann außerdem durch Abwahl vorzeitig beendet werden (§ 82 NKomVG). Die Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf eines von mindestens drei Vierteln der Abgeordneten gestellten Antrags, über den in einer Sondersitzung der Vertretung, die unter Ausschluss der Ladung mit abgekürzter Ladungsfrist frühestens zwei Wochen nach Eingang des Antrags stattfindet, ohne Aussprache namentlich abgestimmt wird. Der Beschluss bedarf wiederum einer Drei-Viertel-Mehrheit. Die Abwahl erfolgt durch die Bürger nach § 45o, wenn nicht der Hauptverwaltungsbeamte auf die Durchführung des Abwahlverfahrens verzichtet (§ 82 Abs. 3 NKomVG). Das Amt endet mit Ablauf des Tages, an dem der Wahlausschuss die Abwahl feststellt (§ 82 Abs. 4 NKomVG).