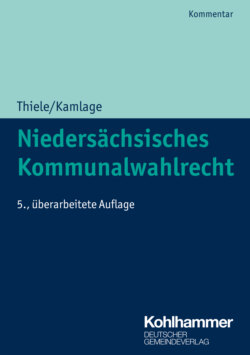Читать книгу Niedersächsisches Kommunalwahlrecht - Werner Schiefel - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.Wahlvorschläge
Оглавлениеa) Träger von Wahlvorschlägen. Träger von Wahlvorschlägen konnten von Anfang an Parteien und Einzelpersonen sein. Als Parteien wurden auch örtliche Wählervereinigungen (Rathausparteien) angesehen, wenn sie bestimmten Mindestanforderungen entsprachen, die das OVG Lüneburg in ständiger Rechtsprechung entwickelt hatte.36 Im Gegensatz hierzu entschieden das Bundesverfassungsgericht37 und das Bundesverwaltungsgericht38, dass Organisationen mit lediglich kommunaler Zielsetzung keine Parteien im Sinne des Grundgesetzes seien. Das Bundesverwaltungsgericht kam allerdings in einer weiteren Entscheidung zu der Auslegung, dass – nach geltendem niedersächsischem Kommunalwahlrecht – auch Rathausparteien als politische Parteien verstanden werden könnten.39
Zur Klarstellung wurde schließlich im Einvernehmen aller Parteien gesetzlich festgelegt, dass Wahlvorschläge künftig nur noch von Parteien im Sinne des Grundgesetzes, nicht aber von Wählervereinigungen eingereicht werden konnten (G 1). Die Wahlausschüsse hatten fortan aufgrund der Wahlanzeige festzustellen, welche Vereinigungen für die Wahl als Parteien anzuerkennen waren. Bereits fünf Monate später wurden erneut auch Wahlvorschläge von Wählergruppen zugelassen (G 3), nachdem das Bundesverfassungsgericht überraschend in einer Entscheidung zum Kommunalwahlgesetz des Saarlandes festgestellt hatte, dass ortsgebundene Wählervereinigungen bei Kommunalwahlen nicht vom Wahlvorschlagsrecht ausgeschlossen sein dürften.40 Mit dieser Gesetzesänderung entfiel zugleich das Erfordernis der Anerkennung der Parteieigenschaft durch die Wahlausschüsse, wenig später (G 5) auch die Wahlanzeigepflicht. Letztere wurde 1971 wieder eingeführt. Die Beteiligung an der Wahl war nun beim Landeswahlleiter anzuzeigen, die Feststellung der Parteieigenschaft lag beim Landeswahlausschuss (G 12). Dies diente einer landeseinheitlichen Abgrenzung zwischen Parteien und örtlichen Wählergruppen, was vor allem die Arbeit der örtlichen Wahlorgane erleichtern sollte.41
b) Wahlvorschlagsverbindungen. Die seit 1956 bestehende Möglichkeit einer Verbindung von Wahlvorschlägen entfiel – gegen den Widerstand der oppositionellen CDU – im Jahre 1960 mit der Begründung, dass der Wählerwille klar und unverfälscht zum Tragen kommen und das Wahlsystem vereinfacht werden solle (G 1).42 Bei Einführung des Wahlvorschlagsrechts der Wählergruppen (G 3) wurde im selben Jahr die Möglichkeit der Wahlvorschlagsverbindung wieder eingeführt.43 Eine ergänzende Regelung bestimmte wenig später, dass nicht nur Parteien und Wählergruppen, sondern auch Einzelbewerber an einer Wahlvorschlagsverbindung beteiligt sein konnten (G 5).
Die Möglichkeit von Wahlvorschlagsverbindungen wurde 1971 – erneut gegen die Stimmen der CDU – wieder gestrichen (G 12). Dies sollte dem Grundsatz der Klarheit der Wahl dienen und die Entscheidung des Wählers vor jeglicher Einengung bewahren.44 1984 setzte die CDU die Wiedereinführung der Wahlvorschlagsverbindung durch (G 22). Begründet wurde dies damit, dass so ein Minderheitenschutz für kleinere Gruppierungen geschaffen werde, die in kleinen Wahlgebieten oft nur im Rahmen einer Wahlvorschlagsverbindung einen Sitz erlangen könnten. Außerdem seien frühere Bedenken wegen einer möglichen Einschränkung der Wählerentscheidung entfallen, nachdem inzwischen ein Personenwahlrecht mit drei Stimmen und mit der Möglichkeit des Panaschierens eingeführt worden sei.45
2006 (G 32) ist die Möglichkeit von Wahlvorschlagsverbindungen mit der Begründung aufgehoben worden, dass das BVerfG (Urt. v. 29.9.1990, BVerfGE 82 S. 322) sie als Verstoß gegen die Chancengleichheit bezeichnet habe, weil sie den Erfolgswert der Wählerstimmen ohne zwingenden Grund für einzelne Wahlvorschläge und einer Wahlvorschlagsverbindung angehörende Wahlvorschläge ungleich gewichtet, und das BVerwG (Urt. v. 10.12.2003, R&R 2/2004 S. 5 = NdsVBl. 2004 S. 229) diese Entscheidung „wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt“ habe.
c) Unterstützungsunterschriften. Von dem Erfordernis, eine bestimmte Zahl von Unterstützungsunterschriften als Nachweis für die Ernsthaftigkeit eines Wahlvorschlags vorzulegen, waren zunächst nur die im Bundestag oder im Landtag vertretenen Parteien befreit. Nachdem das Bundesverfassungsgericht diese Regelung für nichtig erklärt hatte, da sie gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße,46 wurde die Befreiung vom Unterschriftenquorum auch auf die in der jeweiligen kommunalen Vertretungskörperschaft bereits vertretenen Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber ausgedehnt (G 5).