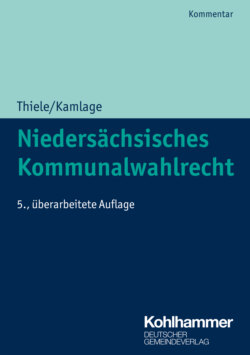Читать книгу Niedersächsisches Kommunalwahlrecht - Werner Schiefel - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.Kommunalverfassungsrechtliche Wahlvorschriften
ОглавлениеDie Bestimmungen über aktives und passives Wahlrecht, Sitzerwerb und Sitzverlust wurden mehrfach geändert und mit den entsprechenden Regelungen des Landtags- und Bundestagswahlrechts harmonisiert (G 2, 6, 10, 21 und 24).19 Die Regelvermutung des Wohnsitzes am Ort der Hauptwohnung, die zunächst im NKWG geregelt war (G 12), wurde später in die NGO und NLO übernommen (G 15), die 2011 zusammen mit dem Gesetz über die Region Hannover zum NKomVG (G 37) zusammengefasst wurden, wobei seit 2001 nicht mehr der bürgerlich-rechtliche, sondern der melderechtliche Wohnsitzbegriff maßgebend ist (G 29). Das Wahlalter wurde 1970 zunächst von 21 auf 18 (G 9) und dann 1995 auf 16 Jahre (G 26), das Wählbarkeitsalter 1970 von 25 auf 21 (G 9) und 1982 auf 18 Jahre (G 21) herabgesetzt. Gegenstand mehrerer Novellen waren die im weiteren Sinne zum Wahlrecht zu zählenden Bestimmungen über die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat (G 8, 20, 28, 31 und 34). Eine Ausweitung der für Kreis- und Gemeindewahlen geltenden Verfahrensregelungen auf andere Wahlarten brachten die Einführung der Ortschaftsverfassung und der unmittelbaren Wahl der Samtgemeinderäte (G 11) sowie die Einführung der Stadtbezirksverfassung (G 19).
Die laufende Wahlperiode wurde mehrfach verlängert. Im Jahre 1960 hatte das Bundesverfassungsgericht im Verfahren über eine Verfassungsbeschwerde gegen Bestimmungen des NKWG (vgl. unten IV 5 c) den bereits auf den 23.10.1960 festgesetzten Wahltermin durch einstweilige Anordnung aufgehoben und bestimmt, dass ein neuer Wahltermin erst nach der Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde festgelegt werden dürfe.20 Da diese Entscheidung erst nach dem bevorstehenden Ende der laufenden Wahlperiode zu erwarten war, wurde diese bis längstens Mai 1961 verlängert (G 4); die folgende Wahlperiode wurde auf 3 1/2 Jahre verkürzt (G 5). 1972 wurde wegen der ungünstigen Terminlage zur Zeit der Olympischen Spiele in München das Ende der kommunalen Wahlperiode um einen Monat verschoben (G 13). Damit wurde der Beginn der Wahlperiode für die Zukunft auf den 1.11. (nicht mehr 1.10.) festgelegt. Um im Zusammenhang mit der Gebietsreform zu vermeiden, dass in einigen Neugliederungsgebieten kurz hintereinander mehrfach gewählt werden musste, nämlich im Oktober 1972 bei den allgemeinen Neuwahlen und erneut im Anschluss an die zum 1.1.1973 vorgesehenen Gebietsänderungen, wurde die Wahlperiode in den betroffenen Landkreisen und Gemeinden um zwei Monate bis zum 31.12.1972 verlängert (G 14).21 1976 wurde die bis dahin vierjährige Wahlperiode auf 5 Jahre verlängert (G 17).