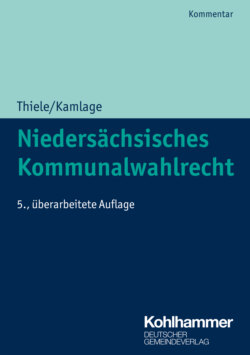Читать книгу Niedersächsisches Kommunalwahlrecht - Werner Schiefel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.Kommunalwahlen nach alliiertem Recht
ОглавлениеAls im Herbst 1946 in der damaligen britischen Besatzungszone die ersten Kommunalwahlen nach dem Kriege stattfanden, existierte das Land Niedersachsen noch nicht. Noch vor Gründung des aus den Ländern Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gebildeten Landes Niedersachsen im November 1946 wurden auf Anordnung der britischen Militärregierung1 am 15.9.1946 Gemeindewahlen und am 13.10.1946 Kreiswahlen abgehalten.
Ziel der britischen Besatzungspolitik war es, die Demokratie in Deutschland von unten nach oben aufzubauen, wobei die britischen Traditionen als geeignetes Vorbild für die künftigen politischen Verhältnisse Deutschlands angesehen wurden. So wie die Briten der deutschen Tradition der kommunalen Selbstverwaltung misstrauten und die englische Kommunalverfassung zur Maxime der Demokratisierung machten,2 so lehnten sie auch die Wiedereinführung des in der Weimarer Republik geltenden Verhältniswahlrechts ab, das ihrer Meinung nach die Parteienzersplitterung fördern und den persönlichen Kontakt zwischen Wählern und Gewählten erschweren würde. Anders als in der amerikanischen Besatzungszone, wo im Januar 1946 Kommunalwahlen nach dem Verhältniswahlsystem stattgefunden hatten, wurde daher für die Kommunalwahlen in der britischen Zone das Mehrheitswahlsystem eingeführt.3
An den Vorbereitungen der Kommunalwahlen wurde als beratendes Organ ein deutscher „Arbeitsausschuss“ beteiligt. Zu den 17 Mitgliedern dieses Gremiums gehörten elf Verwaltungsbeamte, je ein Mitglied von CDU, SPD und KPD, je ein Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeber sowie ein Unabhängiger. Die drei Letztgenannten wurden von der Militärregierung ernannt. Vorsitzender des Ausschusses war der spätere Bundesminister Gerhard Schröder. Der Arbeitsausschuss widersetzte sich den britischen Absichten zur Einführung des reinen Mehrheitswahlsystems, insbesondere weil er fürchtete, dass hierdurch die Bildung von Oppositionsparteien erschwert würde. Nach mehreren Zusammenkünften im Januar, Februar und April 1946 fanden sich die Briten zu einem Kompromiss bereit, wobei jedoch die Elemente der Mehrheitswahl weiterhin dominierten.
Nach den Bestimmungen der Verordnung Nr. 32 vom 30.5.19464 hatte jeder Wähler so viele Stimmen, wie Vertreter im Wahlgebiet zu wählen waren. Den größten Teil der Sitze erhielten die Bewerber mit den höchsten Stimmenzahlen. Ein kleinerer Teil wurde nach dem Proportionalsystem über Reservelisten verteilt. Dieser Verteilung lagen die unverbrauchten Reststimmen zugrunde, d. h. die für unterlegene Bewerber abgegebenen Stimmen, soweit sie über die zur Gewinnung des Sitzes erforderliche Stimmenzahl hinausgingen. Für Gemeinden bis zu 500 Einwohnern galt eine Sonderregelung.
Nach Art. IV der Verordnung Nr. 31 vom 30.5.19465 sollte jedes Jahr ein Drittel der Vertreter sein Mandat niederlegen. Jährlich sollten Ergänzungswahlen stattfinden, bei denen eine Wiederwahl der zurückgetretenen Mandatsträger möglich war. Die Bedenken, die der Arbeitsausschuss gegen diese Regelung, die ebenfalls auf britische Vorbilder zurückging, vorbrachte, blieben erfolglos.
Die britische Besatzungsmacht sorgte in einer Reihe von begleitenden Regelungen dafür, dass bei den ersten Wahlen in ihrem Besatzungsgebiet alle Grundsätze einer freien und demokratischen Wahl beachtet wurden.6 Als Kandidat konnte nur benannt werden, wer von der Militärregierung „als zum Vertreter geeignet“ anerkannt wurde. Vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen waren alle Mitglieder ehemaliger NS-Organisationen oder der NSDAP nahestehender Vereinigungen sowie ehemalige aktive Wehrmachtsoffiziere. Die Militärregierung konnte allerdings Ausnahmen zulassen. In Ausführungsbestimmungen wurden Einzelheiten des Wahlverfahrens geregelt.7 Offenbar waren sich die Briten nicht sicher, dass die Deutschen mit allen demokratischen Spielregeln vertraut waren, wie die detaillierten Vorschriften über Einzelheiten des Wahlablaufs zeigen. So wurde z. B. den Mitgliedern des Wahlvorstandes ausdrücklich untersagt, auf einen Wähler einzuwirken, während dieser seinen Stimmzettel ausfüllt.8