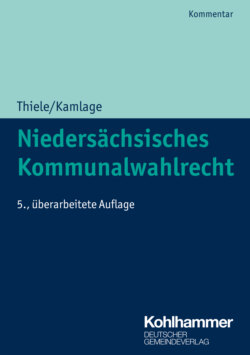Читать книгу Niedersächsisches Kommunalwahlrecht - Werner Schiefel - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9.Sonstiges
ОглавлениеNeben verschiedenen Änderungen vorwiegend redaktioneller und verfahrensrechtlicher Art (G 1, 10, 24 und 25) erscheinen folgende weitere Wahlrechtsregelungen erwähnenswert:
a) Briefwahl. Die Möglichkeit der Briefwahl wurde 1956 für die Bundestagswahl und 1962 für die Landtagswahl eingeführt. Mehrere Gesetzesanträge der CDU, die Briefwahl auch bei den Kommunalwahlen einzuführen, wurden vor allem unter Hinweis auf die Gefährdung des Wahlgeheimnisses von der Landtagsmehrheit abgelehnt.47 Das Bundesverfassungsgericht stellte 1961 fest, dass keine verfassungsrechtliche Pflicht des Gesetzgebers zur Einführung der Briefwahl bestehe.48 Erst 1967 – die CDU war inzwischen Regierungspartei – wurde die Briefwahl durch fast einstimmigen Beschluss des Landtags auch für die niedersächsischen Kommunalwahlen eingeführt (G 7). Gleichzeitig wurden die Bestimmungen über das Ruhen des Wahlrechts von Straf- und Untersuchungshäftlingen, die jetzt auf brieflichem Wege an der Wahl teilnehmen konnten, aufgehoben (G 6). Der anfängliche Ausschluss der Übersendung von Briefwahlunterlagen bei Stichwahlen (G 28) ist 2001 insoweit gelockert worden, dass ihn die Wahlleitung nur noch bei Vorliegen besonderer Umstände anordnen kann (G 29). Schließlich ist die Briefwahl dadurch erleichtert worden, dass in Übereinstimmung mit dem Bundestagswahlgesetz und dem Europawahlgesetz die Erteilung eines Wahlscheins auf Antrag ohne die Angabe und Glaubhaftmachung von Hinderungsgründen möglich ist (G 36).
b) Stimmbezirk, Wahlbezirk, Wahlbereich. Der Begriff „Stimmbezirk“ wurde 1977 in Angleichung an das Bundeswahlrecht durch den Begriff „Wahlbezirk“ ersetzt (G 18). Bis dahin hatte der Wahlbezirk die für die Aufstellung der Wahlvorschläge maßgebliche Untergliederung des Wahlgebiets bezeichnet. An seine Stelle trat jetzt der neu geschaffene Begriff „Wahlbereich“. Die an der Zahl der zu wählenden Vertreter orientierte Anzahl der Wahlbereiche (bzw. zuvor Wahlbezirke) der einzelnen Wahlgebiete wurde mehrfach geänderten Verhältnissen angepasst (G 1, 12, 16, 18 und 36).
c) Reihenfolge der Wahlvorschläge. Für die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel war seit 1961 nicht mehr das Ergebnis der letzten Landtagswahl maßgebend, sondern die Stimmenzahl, die die mit mindestens einem Mandat vertretenen Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber bei der letzten Wahl im Wahlgebiet errungen hatten (G 5).
d) Stimmenzählgeräte. Im Jahre 1985 wurden die Möglichkeit zur Verwendung von Stimmenzählgeräten und die Ermächtigung zum Erlass einer entsprechenden Durchführungsverordnung, von der nie Gebrauch gemacht worden war, gestrichen (G 23). Nach einem erfolgreichen Einsatz bei der Europawahl 1999 sollte nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung vom 27.9.2000 (LT-Drs. 14/1905) der Einsatz rechnergesteuerter Wahlgeräte auch bei Kommunalwahlen ermöglicht werden. Der Landtag hat nach den Problemen mit diesen Geräten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA 2000 davon abgesehen. Seit 2006 ist der Einsatz nach weiterer erfolgreicher Erprobung anlässlich der Bundestagswahl 2002 und der niedersächsischen Landtagswahl 2003 auch bei den Kommunalwahlen möglich (G 32).
e) Fristen. Die für die Aufstellung und Einreichung der Wahlvorschläge zur Verfügung stehende Zeitspanne wurde erweitert (G 24).
f) Geschlechtsneutrale Begriffe. Durch die Einführung geschlechtsneutraler Begriffe (Ersatzperson, Vertrauensperson) wurde die sprachliche Diskriminierung der Frauen abgebaut (G 24).
g) Wahlordnungen. In den parallel zu den Gesetzesänderungen geänderten bzw. neu gefassten Wahlordnungen finden sich Ausführungsvorschriften zu den Einzelheiten des Wahlverfahrens.49 Sie enthalten aber auch wichtige materielle Bestimmungen. Hierzu gehören z. B. die 1972 erlassenen Sonderregelungen für einzelne Neuwahlen, für die insbesondere im Hinblick auf die zahlreiche Neuwahlen nach sich ziehende Gebietsreform ein Bedürfnis bestand. 1985 wurden die Bestimmungen über das Briefwahlverfahren strenger gefasst, um einer weiteren Zunahme der Briefwahlquote und der mit der Briefwahl verbundenen Gefahr einer unzulässigen Wählerbeeinflussung entgegenzuwirken. Weitere Änderungen der NKWO betrafen die Aufnahme einer Reihe von Datenschutzbestimmungen und eine weitgehende Harmonisierung zwischen Landes- und Bundeswahlrecht einerseits sowie zwischen Landtags- und Kommunalwahlrecht andererseits.