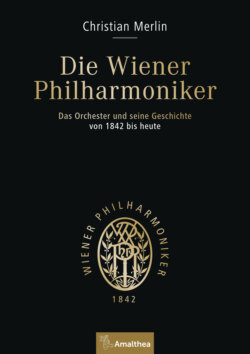Читать книгу Die Wiener Philharmoniker - Christian Merlin - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Zwischenspiel von Hellmesberger jun.
ОглавлениеZur gleichen Zeit verschlechterten sich die Beziehungen zwischen dem Operndirektor und den Philharmonikern derart, dass Mahler, der sich aus Gesundheitsgründen schon zurückgezogen hatte, 1901 seine Position als Leiter der Abonnementkonzerte nicht verlängerte. Eine Delegation des Komitees – Ladislaus Kohut (Bratsche), Franz Simandl (Kontrabass), Alois Markl (Flöte) und Victor Christ (Trompete) – bat ihn, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Der Direktor habe die Delegation sehr freundlich empfangen, steht im Bericht des Komitees, aber mit Bedauern mitgeteilt, er könne auf ärztlichen Rat von Prof. Hohenegg die Leitung der philharmonischen Konzerte nicht mehr ausüben. In der Versammlung der Philharmoniker vom 13. Mai wurde darüber abgestimmt, ob man einen oder mehrere Wiener Dirigenten, einen ausländischen oder mehrere ausländische Dirigenten wählen sollte: 51 Orchestermitglieder votierten für einen Wiener Dirigenten, 9 für mehrere, 18 für einen ausländischen, 10 für mehrere ausländische Dirigenten.
Die Mehrheit bestimmte Josef »Peppi« Hellmesberger jun., den Repräsentanten einer verklärten Wiener Vergangenheit, zum Leiter der philharmonischen Konzerte: Der Ballettkapellmeister, Sohn und Enkel von ehemaligen philharmonischen Konzertmeistern, Komponist von 22 Operetten, hatte schon 1901 immerhin 19 Stimmen bekommen (Mahler 61). Während einige Musiker aufbegehrten, rieben sich andere ob dieser Mahler zugefügten Kränkung die Hände. Aber selbst Mahlers Gegner merkten bald, dass der charmante und mondäne Hellmesberger Mahler als Dirigent nicht das Wasser reichen konnte und dass auch die Konzertauslastung zurückging, wie ein Artikel der Neuen Freien Presse am 10. Oktober 1903 feststellte: »Die Philharmoniker hatten ein zuverlässiges Barometer für die Stimmung des Publikums: die Einnahmen aus ihren Konzerten. Unter Richter entfiel auf ein Mitglied durchschnittlich ein Betrag von mehr als 300 Gulden. Nachdem Mahler Richter am Dirigentenpult abgelöst hatte, stieg die Quote per Person auf 350 Gulden. In den letzten zwei Jahren, da Hellmesberger den Taktstock in die Hand nahm, gingen die Einnahmen wieder zurück. Im vorletzten Jahre konnte man den Mitgliedern wieder nur 300 Gulden als Anteil am Reingewinn ausbezahlen, und in der letzten Saison verschlechterte sich das finanzielle Ergebnis der Konzerte derart, dass die Partizipation pro Musiker im Ganzen 200 Gulden betrug.«
Wie ein junger moderner Musiker zur Person Hellmesberger stand, geht aus einem Brief Bruno Walters, damals dritter Hofopernkapellmeister unter Mahler, an seine Eltern hervor: »Mahler hat die fernere Leitung abgelehnt. Schalk lieben sie zu wenig; faute de mieux haben sie Hellmesberger, einen Schuhmachermeister (!) ersten Ranges genommen.«26 Hellmesbergers Mandat wurde am 1. März 1903 nicht erneuert, aber da Mahler nicht bereit war, die Leitung der philharmonischen Konzerte wieder zu übernehmen, behalf man sich in den nächsten fünf Jahren mit Gastdirigenten. Hellmesberger legte alle seine Funktionen noch im gleichen Jahr nieder. Eines Tages musste der stadtbekannte Schürzenjäger seine Eskapaden büßen: Der Vater einer Tänzerin, mit der er eine Liaison unterhielt, verpasste ihm eine derartige Tracht Prügel, dass er die Beine unter die Arme nahm und auf die Albrechtsrampe der Albertina flüchtete – ein peinliches Ende für ein ehemaliges Wunderkind! In der Folge findet sich seine Spur als Kapellmeister in Stuttgart, bevor er 1907 weitgehend unbeachtet im Alter von nur 52 Jahren in Wien starb. Mit ihm ging eine Epoche zu Ende.
Josef Hellmesberger war in dem Krieg, den Mahler und das Orchester miteinander führten, allem Anschein nach instrumentalisiert worden. Dabei ging es weniger um den unnachgiebigen Charakter des Dirigenten oder künstlerische Differenzen, sondern vielmehr um das Streben der Philharmoniker nach Unabhängigkeit und Selbstverwaltung, Prinzipien, die sich mit der Autorität und den fest umrissenen Vorstellungen des Operndirektors nicht vertrugen.
Um die ersten Pulte der Primgeigen zu vervollständigen, musste Mahler auch einen Nachfolger für Alois Hilbert finden, der seit 1859 Orchestermitglied und seit 1886 Ballettkonzertmeister gewesen war: Er hielt sich dabei an die Tradition und stellte einen Musiker aus der Gruppe in die vorderste Reihe: August Siebert, zweiter Geiger im Rosé-Quartett und damit ein Vertrauter seiner rechten Hand Rosé. Außerdem entstammte Siebert einer philharmonischen Familie, da Vater Josef Bratschist und Bruder Rudolf Kontrabassist bei den Philharmonikern waren.
Mit 20 Pensionierungen in den Jahren 1898 und 1899 stellte sich die dringliche Aufgabe, die Lücken zu schließen. In Mahlers Zeit verließen die letzten Musiker, die für die Einweihung der neuen Oper am Ring engagiert worden waren, das Orchester, bis auf einen: Solokontrabassist Franz Simandl räumte seinen Posten erst 1904. Einige wurden mit dem Vermerk »dienstuntauglich« in Pension geschickt. Was hart klingt, war in Wirklichkeit eine Wohltat; denn diese durch ein Attest bestätigte Beurteilung war tatsächlich für den Betroffenen die einzige Möglichkeit, eine Pension zu beziehen. So geschah es im Fall des Geigers Otto Zert. Er wurde 1904 offiziell für arbeitsunfähig erklärt, war aber schon ein Jahr zuvor in die sogenannte »Landes-Irrenanstalt« eingewiesen worden.
Mahler verlor keine Zeit und ging an die wichtigste aller Reformen seit 1869: die Senkung des Durchschnittsalters der Musiker. Zunächst waren die Ergebnisse nicht auffallend: 1896, ein Jahr vor Mahlers Amtsantritt, lag das Durchschnittsalter bei 40 Jahren, 1903 hatte es sich um ganze drei Jahre auf 37 gesenkt. Aber die Verjüngung ging weiter: 24 von Mahlers Neuengagements waren jünger als 25. Zum Beispiel waren der Primgeiger Franz Mairecker 19, der Primgeiger Hugo Riesenfeld, der Bratschist Karl Freith, der Kontrabassist Eduard Madensky und der Posaunist Karl Wesecky 22 Jahre alt.