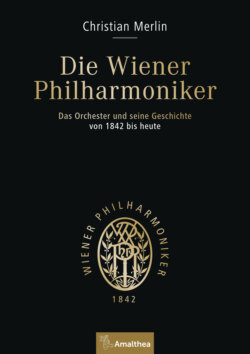Читать книгу Die Wiener Philharmoniker - Christian Merlin - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Wiener Identität
ОглавлениеNicht nur persönliche Konflikte und Machtkämpfe prägten das Orchesterbild dieser Epoche. Zum ersten Mal in der Geschichte der Philharmoniker fanden grundlegende Überlegungen zur künstlerischen Identität des Orchesters statt. Anstoß dazu gab bei der Hauptversammlung am 30. Mai 1904 die Ansprache des Geigers Stefan Wahl35, seit 25 Jahren Orchestermitglied. Er begann damit, seinen Kollegen ihre Passivität bei den geschäftlichen Angelegenheiten des Orchesters vorzuwerfen, während sie sich nicht scheuten, mit Geldforderungen an die Oper heranzutreten. Aber auch in moralischer und politischer Hinsicht hätten die Philharmoniker eine »kulturelle und zivilisatorische Aufgabe« zu erfüllen. Es ginge darum, die symphonische Musik, die höchste Form der Kunstmusik, auf die vollendetste Weise erklingen und auf ihre Mitmenschen einwirken zu lassen. In der Folge legte er die Gründe für die Überlegenheit der symphonischen Musik dar: In der Oper habe das Orchester mit der Konkurrenz durch das Bühnengeschehen zu kämpfen und verliere immer mehr seine Autonomie – Wortführer dieser Debatte war im 19. Jahrhundert der Musikkritiker Eduard Hanslick –, und auch die Kammermusik könne mit der Brillanz und dem Klangreichtum eines modernen Orchesters nicht mithalten. Seit dem Verschwinden von Flöten- oder Klarinettenkonzerten sei es das Orchester, welches den Blasinstrumenten am meisten Spielraum biete. »Die Blasinstrumente sind die Sänger des Orchesters«, zitierte er den ehemaligen Chefdirigenten Hans Richter. Was die Streicher angehe, seien die Anforderungen der modernen Orchestermusik in puncto Technik, rhythmischer Sicherheit und komplizierter Harmonik enorm. Daher sei das ideale Orchester jenes, das dem Dirigenten auf halbem Weg entgegenkomme, um gemeinsam mit ihm den Aufbau des Werkes zu erkunden. Diese Konzeption eines Orchesters, das sich nicht alle Arbeit vom Maestro erwartet, ist und bleibt eine Grundregel des philharmonischen Selbstverständnisses.
Stefan Wahl kam sodann auf den einmaligen künstlerischen Charakter der Philharmoniker zu sprechen und verglich sie mit anderen berühmten Orchestern der Zeit, zum Beispiel mit der Meininger Hofkapelle. Mit ihren Dirigenten Hans von Bülow und Richard Strauss hatte sie sich Ende des 19. Jahrhunderts einen erstklassigen Ruf erworben und 1876 für das erste Orchester der Bayreuther Festspiele die meisten Musiker gestellt. Auch die Uraufführung von Brahms’ 4. Symphonie hatte in Meiningen stattgefunden. 1884, also 20 Jahre zuvor, hatte das Meininger Orchester in Wien gespielt, was das erste auswärtige Orchestergastspiel in Wien gewesen sein dürfte.
»Sie kamen, frappierten mehr als sie siegten, hauptsächlich durch Präzision und Exaktheit ihres Zusammenspiels. Aber wenn man die Herren so stramm dastehen sah, auf jeden Augenblick, jede Muskelbewegung ihres Dirigenten wie elektrisch reagierend, hatte man das Gefühl, gleich dem Lehrbataillon des I. preussischen Grenadierregiments im Stechschritt abmarschieren. An Wärme und Schwung blieben sie uns Vieles, um nicht zu sagen Alles, schuldig. Gewiss zählt man draussen auch ausgezeichnete Instrumentalisten, einer der hervorragendsten ist Kammervirtuose Mühlfeld. Doch, trotz seiner durchgeistigten, kühlempfundenen und akademisch-berechneten Wiedergabe von Kammermusikern, ist mir eine warmempfundene Cantilene von unserem Bartolomey geblasen, lieber als ein ganzes Mühlfeldisches Trio.«
Dieser Text, der auf den ersten Blick anekdotisch wirkt, ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. So wie Hanslick auf das unterschiedliche Geigenspiel von Josef Hellmesberger sen. und Joseph Joachim aufmerksam gemacht hat, betont Wahl den Gegensatz zwischen Kälte und Wärme des Spiels, wobei er Letzterer mehr Gewicht beimisst als der Präzision des Spiels: Ohne es ausdrücklich zu sagen, gibt Wahl zu verstehen, dass es bessere Orchester als die Wiener Philharmoniker in puncto Zusammenspiel und Aufstellung gibt, aber dass diese Strenge auf Kosten des Ausdrucks und des Gefühls geht. Er vergleicht nicht die Alte und die Neue Welt, sondern Österreich und Preußen, nicht zuletzt weil die Meininger unter der Leitung Hans von Bülows standen beziehungsweise das Berliner Philharmonische Orchester inzwischen in Wien gespielt hatte: Es ist nicht auszuschließen, dass Wahl indirekt auf die Berliner abzielen wollte. Über Preußen hinaus spielt, wie in den meisten damaligen Kritiken, der Gegensatz zu Deutschland eine erhebliche Rolle. Nicht zufällig bedient sich der Geiger eines militärischen Vokabulars, um die Disziplin der Meininger Hofkapelle mit der einer marschierenden Armee zu vergleichen. Die mit der österreichischen Identität verbundenen Klischees stützen sich meistens auf den Gegensatz zu Preußen: hier das feminine und sensible Österreich, dort das maskuline und unerbittliche Preußen. So lässt sich Stefan Wahl deuten, auch wenn er nie direkt auf diese Kategorien verweist.
Für Stefan Wahl ist dieses Österreich der Wärme und Sensibilität keineswegs der verlängerte Arm des deutschen Nationalismus, sondern eine eigenständige multikulturelle Nation. Wohl ohne zu ahnen, dass der Gesamtstaat in Bälde auf seine deutsche Komponente reduziert werden würde, entwirft Stefan Wahl ein idealisiertes Donaureich, in dem es kein Problem ist, Tscheche oder Ungar zu sein. Seine Art, den Begriff »österreichisch« als komplementär und nicht ausschließlich als deutsch-österreichisch zu verstehen, zeugt von einer Welt, die im Begriff ist, zur Welt von gestern zu werden.
Nur zehn Jahre später rief der Beginn des Ersten Weltkrieges in Österreich entgegengesetzte, deutschnationale Auffassungen hervor, in denen die Musik eine erhebliche Rolle spielte. Hermann Bahr, einstige Galionsfigur der Wiener Moderne, gab seine europäische, kosmopolitische Einstellung auf und segnete den Krieg als Vollendung der deutschen Kultur von Bach bis Wagner, wobei er die Angriffspläne der deutschen Armee mit einer Partitur Wagners verglich. Hier war nicht mehr von einem multiethnischen österreichischen Vaterland im Sinne von Stefan Wahl die Rede, sondern von einem germanischen Kampf gegen die slawische Welt. Politische Hintergedanken waren Stefan Wahl vermutlich fremd, aber seine Rede bleibt nichtsdestoweniger ein Paradebeispiel für die Identitätsproblematik.
Dass er das Spiel des Klarinettisten Franz Bartolomej lieber hat als das von Richard Mühlfeld, begründet Wahl so: »Er ist zwar ein Böhme, werden Sie sagen, aber zugleich ein warmfühlender Österreicher. Hans Richter sagte: ›Franz Weber ist der beste Pauker‹! er ist zwar ein Ungar, zugleich aber auch ein warmfühlender Österreicher, womit ich sagen will, dass unsere Kunst eine ›specifisch österreichische‹ ist, nicht allein durch das Menschenmaterial, durch die hier übertragenen und grosserzogenen Traditionen, sondern auch durch den Boden auf welchem wir leben, durch die Luft welche wir atmen! Und alle, die noch hierher kamen, haben sich uns früher oder später, mehr oder weniger assimiliert, haben sich unserem herrlichen Mosaik eingefügt. Ja, ich versichere Sie, es ist etwas an der Sache: wir spielen gewissermassen die Vermittlerrolle der gemässigten Zone, welche die Gegensätze von Nord und Süd auszugleichen hat.«
In dieser Absichtserklärung wird Österreich zum Schmelztiegel der Integration. Dass der Redner selbst in Galizien geboren ist, hat sicher zu seiner idealisierten Konzeption der Donaumonarchie beigetragen. Bezeichnend ist auch, dass er sich auf den Klarinettisten Franz Bartolomej bezieht, diesen ersten Repräsentanten einer Generation von Philharmonikern, die aus Böhmen kamen und den Aufstieg des tschechischen Nationalismus erlebt hatten. Bartolomej hat die Wiener Klarinettenschule gegründet, so wie ein halbes Jahrhundert zuvor der Prager Anton Slama die Wiener Kontrabass-Schule ins Leben gerufen hatte. Doch 15 Jahre nach Stefan Wahls Rede sollten der Erste Weltkrieg und die Verträge von Versailles und Saint-Germain-en-Laye dazu führen, dass tschechische Musiker das Orchester verließen.
Um die Jahrhundertwende entschlossen sich mehrere jüdische Philharmoniker zu konvertieren, zwei von ihnen änderten sogar ihre Namen. Damit stellten sie in diesen Jahren keine Ausnahme dar. Der Geiger Dionys Mayer, Orchestermitglied seit 1898, der noch unter dem Namen David Mayer beim Konservatorium inskribiert war, verließ die israelitische Glaubensgemeinschaft am 18. April 1894, ließ sich am 10. Januar 1896 auf den Vornamen Dionys taufen und änderte 1911 seinen Familiennamen in Martens. In den Registern des Orchesters sollte er nunmehr unter diesem Namen geführt werden. Sein Kollege Heinrich Rosenthal, seit 1880 Philharmoniker, konvertierte am 2. Mai 1902 und nannte sich fortan Heinrich Rémi.36
Unter Mahler zählte das Orchester 22 jüdische Musiker, 18,6% und mehr denn je in der Geschichte des Orchesters; zum Beispiel 4% mehr gegenüber dem Anteil von 14% im Jahr 1869. Es waren 10% mehr als der lokale Durchschnitt, da damals die jüdischen Einwohner nur 8,6% der Wiener Bevölkerung ausmachten.37 Steven Beller zufolge waren 48% der Medizinstudenten, 63% der Anwälte, 63,2% der Journalisten sowie ein Drittel der Klavier- und Geigenschüler am Wiener Konservatorium jüdischen Glaubens.38 Somit lag der Anteil jüdischer Mitglieder bei den Philharmonikern zwar über dem der Gesamtbevölkerung, aber unter dem der Akademiker. Was die nichtdeutschen Monarchiebewohner angeht, so findet man 1903 zwar noch 15 Böhmen, jedoch nur 1 Ungar, 2 Mährer, 2 Galizier, 1 Bukowiner und 1 in Rumänien geborenen Österreicher im Orchester. Dagegen war mit 7 Deutschen, 1 Serben und 2 Niederländern der Anteil der nicht zur Monarchie gehörenden Mitglieder angestiegen.