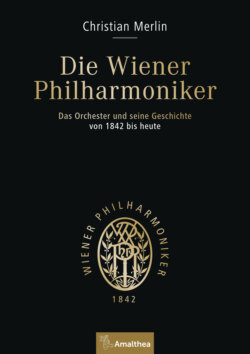Читать книгу Die Wiener Philharmoniker - Christian Merlin - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Rekord an Neuengagements
ОглавлениеIn der Zeit zwischen 15. Oktober 1897 und 31. Dezember 1907, in der Mahler als Hofoperndirektor amtierte, engagierte er 79 neue Orchestermitglieder, eine Rekordzahl. Darunter gab es allerdings auch kurze Intermezzi. Als Felix Weingartner 1908 Mahler nachfolgte, waren von den 117 aktiven Orchestermitgliedern 64 von seinem Vorgänger engagiert worden, 54,7%: 18 von 34 Geigern, 9 von 10 Cellisten, die Hälfte der Kontrabassisten und Posaunisten, 3 von 5 Flötisten und Oboisten, 4 von 6 Trompetern waren Neueinstellungen von Mahler. Warum kam diesen Engagements so viel Gewicht zu? Gustav Mahler, der sehr wenig von seiner Macht delegierte, betrachtete die Neueinstellungen als sein persönliches Vorrecht, als Chefsache. Diese Haltung trug nicht wenig zu den Spannungen zwischen ihm und dem Orchester bei, das mehr denn je auf seiner Autonomie bestand. Auch entsprachen Mahlers Methoden bei Neueinstellungen nicht immer der Wiener Tradition.
Als erste Konsequenz dieser extensiven Besetzungspolitik waren einige Engagements nur von kurzer Dauer. Die Flötisten Eurysthenes Ghisas und Marko Radosavljevic blieben wie der Posaunist Johannes Ablöscher drei Jahre, der Harfenist Edmund Schuecker, der Klarinettist Franz Prem, der Paukist Heinrich Knauer zwei Jahre, Konzertmeister Bruno Ahner, Solocellist Rudolf Krasselt, der Harfenist Josef Ziegenheim, der Trompeter Paul Handke ein Jahr, der Harfenist Roman Mosshammer sechs Monate. Sechs Musiker blieben so kurz, dass sie nicht einmal auf der Philharmonikerliste standen: der Cellist Ludwig Herckenrath, die Klarinettisten Anton Powolny und August Lohmann, die Hornisten Adolf Kratky und Carl Schmid sowie der Trompeter Josef Pfandler.
Doch 35 der von Mahler Engagierten blieben mehr als 30 Jahre im Orchester; einige wurden zu prägenden Musikern, etwa die Geiger Gustav Hawranek (späterer Vorstand) und Franz Mairecker (späterer Konzertmeister), Solocellist Friedrich Buxbaum, der Kontrabassist Otto Stix, der Oboist Alexander Wunderer oder Solohornist Karl Stiegler.
Um sich ein homogenes Ensemble von Musikern seines Vertrauens zu schaffen, berief Mahler gerne Instrumentalisten, die er von seinen früheren Wirkungsfeldern kannte, besonders aus Hamburg, wo er Kapellmeister war, bevor er den Ruf nach Wien erhielt. So wurde der Geiger Julius Stwertka 1902 neben Rosé und Prill dritter Konzertmeister und blieb es bis 1936. Mahler zögerte nicht, weitere Hamburger Musiker abzuwerben, wie den Kontrabassisten Otto Stix, den Harfenisten Viktor Heinisch oder den Klarinettisten Franz Behrends. Andere, die ihren ehemaligen Chef in guter Erinnerung hatten, bewarben sich ihrerseits in Wien, wie der Trompeter Max Schöniger. Der Harfenist Roman Mosshammer und der Hornist Karl Romagnoli wurden von der Budapester Oper abgeworben. Dort war Mahler tätig, bevor er nach Hamburg ging. Im Fall des Kontrabassisten Carl Baumgartner misslang allerdings der Versuch. Dieser verzichtete darauf, sich beim Probespiel am 24. August 1898 zu beteiligen. Auf andere Musiker wurde Mahler als Gastdirigent bei Aufführungen seiner eigenen Werke aufmerksam, wie zum Beispiel auf den Posaunisten Franz Dreyer, der im Gürzenich-Orchester Köln tätig war, als dort am 9. Juni 1902 die 3. Symphonie Mahlers uraufgeführt wurde. Er muss den Komponisten mit seinem großen Solo im ersten Satz derart beeindruckt haben, dass er ihn auf der Stelle als Soloposaunisten nach Wien holte. Dasselbe hätte Mahler auch gerne mit dem Kölner Trompeter Alfred Matthes gemacht: Er bat schriftlich die Generalintendanz der Hoftheater um die Genehmigung für diesbezügliche Verhandlungen, erhielt jedoch keine Antwort, vermutlich, weil der Trompeter Max Schöniger, dessen Entlassung erwogen wurde, schlussendlich auf seinem Posten blieb.