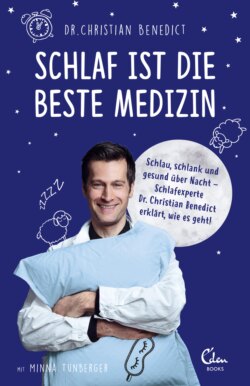Читать книгу Schlaf ist die beste Medizin - Dr. Christian Benedict - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LEICHTSCHLAF – DER ÜBERGANG VOM WACHSEIN ZUM SCHLAFEN
ОглавлениеEs ist Nachmittag, und Sie sitzen nach einer Konferenz in Hamburg im Zug nach Hause. Nach mehrmaligem Umsteigen kommen Sie endlich an und gehen noch schnell im Supermarkt an der Ecke vorbei, um Zutaten für das Abendessen einzukaufen. Zu Hause kochen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, legen sich danach auf die Couch und schauen sich die Nachrichten im Fernsehen an. Sie gähnen und spüren, wie sich eine starke Müdigkeit in Ihnen ausbreitet. Es dauert nicht lange, bis das Fernsehbild vor Ihren Augen verschwimmt und der Ton immer entfernter klingt. Dann schlummern Sie ein.
Im Wachzustand ist das Gehirn sehr aktiv, und die Nervenzellen kommunizieren über unterschiedliche Frequenzen intensiv miteinander. Diese Gehirnaktivitäten lassen sich mithilfe einer EEG (Elektroenzephalografie) messen. Wenn man müde wird, werden die Gehirnwellen, also die Kommunikation zwischen den Nervenzellen, etwas langsamer und haben weniger Ausschläge pro Sekunde. Das Gehirn beginnt, sich zu entspannen. Sobald man sich hingelegt und seine Augen geschlossen hat, sinkt die Wellenfrequenz weiter ab. In dieser Phase kann es zu plötzlichen Zuckungen in Armen oder Beinen kommen, denn wenn man einschläft, nimmt der Muskeltonus des Körpers ab – die natürliche Spannung in den Muskeln, die für das Gleichgewichtssystem des Körpers wichtig ist. Weil unser Gleichgewichtssystem aber nicht so schnell in den Schlafmodus wechselt wie das restliche Hirn, versucht es bis zuletzt, den Muskeltonus wiederherzustellen. Und das kann sich in Form von Muskelzuckungen beim Einschlafen zeigen, sogenannten hypnagogic jerks. Außerdem können in dieser Phase Halluzinationen auftreten. Aussagen wie »Ich habe schon Bilder gesehen« von einer Person, die beim Einschlafen gestört wird, sind auf diese Halluzinationen zurückzuführen. Diese erste Schlafphase ist Teil des Leichtschlafs und die kürzeste der vier Schlafphasen. Sie macht nur fünf Prozent des gesamten Schlafs aus. Schon nach etwa fünf Minuten geht man in die nächste Schlafphase über, den zweiten Teil des Leichtschlafs. Diese dauert wesentlich länger und macht fünfzig bis sechzig Prozent des Schlafs aus. Es handelt sich um eine aufregende Phase, die sich durch zwei verschiedene Arten von Hirnaktivität auszeichnet: langsame Gehirnwellen und sogenannte Schlafspindeln. Letztere sind Mikroereignisse im Gehirn mit sehr schnellen, rhythmischen Gehirnwellen, die vom Thalamus zur Großhirnrinde wandern. Der Thalamus ist ein Bereich unseres Hirns, den man auch als »Tor zum Bewusstsein« bezeichnet. Sämtliche sensorischen Informationen (mit Ausnahme von Düften) gelangen über den Thalamus in die Großhirnrinde, wo sie analysiert und eingeordnet werden.
Eine Schlafspindel besteht aus zehn bis 15 Gehirnwellen pro Sekunde. Man kann sie sich wie eine Stimme vorstellen, die so laut und durchdringend ist, dass sie von der Großhirnrinde klar vernommen wird und dadurch die Verankerung von Erinnerungen im Gedächtnis erleichtert. Weil die Schlafspindeln in der zweiten Schlafphase in Regionen der Großhirnrinde auftreten, die für motorische Fähigkeiten zuständig sind, werden insbesondere Erinnerungen, die mit der Beherrschung bestimmter Tätigkeiten zusammenhängen, wie Tischlern, Gitarrespielen, Nähen oder Radfahren, gut im Gedächtnis verankert. Wenn wir in dieser zweiten Schlafphase viele Schlafspindeln bilden, bringt das also unsere motorischen Fähigkeiten voran. Studien konnten nachweisen, dass Kinder, deren Gehirn im Wachstum ist und die jeden Tag mit vielen neuen Informationen konfrontiert werden, deutlich mehr Schlafspindeln bilden als ältere Menschen. Man hat zudem festgestellt, dass Menschen, die sich geistig stark betätigen, viele Schlafspindeln aufweisen. Wie wir in Kapitel 5 noch genauer ausführen werden, tragen Schlafspindeln auch zur Verfestigung von neu erlernten Fakten im Tiefschlaf bei. Dass bei Älteren meist weniger Schlafspindeln entstehen als bei Jüngeren, könnte einerseits daran liegen, dass das alte Gehirn schlechter Schlafspindeln produzieren kann. Möglicherweise setzen sich viele ältere Menschen aber auch seltener neuen Reizen aus. Sie haben meist weniger soziale Kontakte, weil sie aus dem Berufsleben ausgeschieden sind oder Freunde und Partner versterben. Eventuell bewegen sie sich auch aufgrund von körperlichen Einschränkungen weniger als in jüngeren Jahren. In jedem Fall lässt sich auch im Hinblick auf den Schlaf sagen: »Wer rastet, der rostet!«
Wer nun aber nur wenige Schlafspindeln hat, wacht nachts leichter auf und schläft schlechter. Die Schlafspindeln haben nämlich noch eine weitere wichtige Aufgabe: Sie sorgen dafür, dass man durchschläft und nicht andauernd wach wird. Vermutlich soll so dem Gehirn genug Zeit und Ruhe gegeben werden, um Erinnerungen zu verankern. Denn jedes Mal, wenn man aus dieser Schlafphase gerissen wird, werden die Erinnerungskonsolidierung und die Erholung des Körpers gestört.