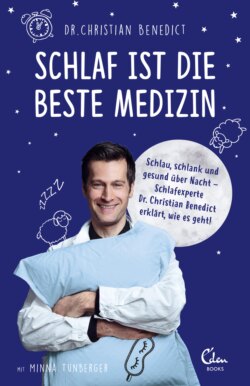Читать книгу Schlaf ist die beste Medizin - Dr. Christian Benedict - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MUSIKALISCHE EINLAGE
ОглавлениеHören Sie abends vor dem Einschlafen Musik? Den Erkenntnissen einer neuen Untersuchung mit fünfzig jungen Erwachsenen zufolge könnte dies eine schlechte Idee sein. Denn nächtliche Ohrwürmer können zu Einschlafproblemen und einem weniger tiefen Schlaf führen. Ohrwürmer am Tag haben hingegen keinen Einfluss auf den Nachtschlaf.
Im Vergleich zu den anderen Schlafphasen kommunizieren im Tiefschlaf die Nervenzellen in der Großhirnrinde bedächtiger und synchronisierter miteinander, was zu langsamen Gehirnwellen mit hohen Ausschlägen nach oben und unten führt. Die Gehirnwellen haben also eine niedrige Frequenz. Der Tiefschlaf entsteht zwar in der gesamten Hirnrinde, der tiefste Tiefschlaf mit einer Frequenz von ein bis zwei Wellen pro Sekunde findet aber hauptsächlich in den Bereichen des Gehirns statt, die im Wachzustand besonders aktiv waren. Das gilt besonders für den Frontallappen (auch Stirnlappen genannt), der im Wachzustand ständig gefordert ist: wenn es darum geht, sich zu konzentrieren, Entscheidungen zu fällen, Stress zu bewältigen oder Neues zu lernen.
Es ist wie gesagt schwierig, jemanden zu wecken, der sich im Tiefschlaf befindet. Und wenn man dann aufwacht, fühlt man sich wie benommen. Das Gehirn braucht ungefähr 15 Minuten, um wieder richtig wach zu werden. Dieser Zustand, den man auch sleep inertia (Schlaftrunkenheit) nennt, kann problematisch sein, wenn man beispielsweise Arzt ist und nachts aufgeweckt wird, um sich um einen Patienten zu kümmern, oder wenn man als Feuerwehrmann in der Feuerwache geschlafen hat und binnen weniger Minuten im Feuerwehrauto sitzen muss. Doch warum spricht man im Tiefschlaf so wenig auf äußere Reize an? Der Grund dafür ist, dass der Thalamus die Großhirnrinde von genau solchen Reizen abschirmt. Er ist eine Art Türsteher, der dafür sorgt, dass das Gehirn alles tagsüber Gelernte und Erlebte ungestört bearbeiten kann. Die Großhirnrinde nimmt Kontakt mit dem Thalamus auf, der daraufhin Schlafspindeln sendet (Schlafspindeln treten vor allem in der zweiten Schlafphase in Gehirnregionen auf, die unsere motorischen Funktionen unterstützen, aber auch im Tiefschlaf). Die Großhirnrinde kommuniziert aber auch mit dem Hippocampus, der weiß, welche Hirnregionen der Großhirnrinde involviert waren, als man im Laufe des Tages etwas gelernt oder erlebt hat. Der Hippocampus sendet daraufhin hundert bis hundertfünfzig Wellenpakete pro Sekunde, die sogenannten ripples, in diese Bereiche. Diese perfekt aufeinander abgestimmte Kommunikation zwischen Großhirnrinde, Thalamus und Hippocampus (mehr dazu später auf den Seiten 94–97) ist eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau des Langzeitgedächtnisses.
Der Tiefschlaf hat aber noch eine weitere Aufgabe, nämlich die Wiederherstellung der »Festplatte« des Gehirns. Frisch angelegte Nervenzellenverbindungen (Synapsen), die als überflüssig eingestuft werden, werden entfernt, damit im kommenden Wachzustand ausreichend freie Kapazitäten zum Lernen und Verarbeiten neuer Dinge zur Verfügung stehen. Man nennt diesen Vorgang auch »synaptisches Downscaling«.
Doch welche Faktoren sind bestimmend dafür, wie viel Tiefschlaf wir nachts bekommen? Eine Arbeitshypothese ist, dass Vielleser, Studierende oder andere geistig sehr aktive Menschen mehr Tiefschlaf benötigen, um all die neuen Informationen verarbeiten zu können. Stress hat aufgrund des damit einhergehenden hohen Cortisolspiegels einen negativen Effekt auf die Tiefschlafmenge. Auch Koffein wirkt sich negativ aus, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass sein Einfluss die Wellenhöhe und -tiefe der langsamen Gehirnwellen im Tiefschlaf reduziert. Die Folge ist ein flacherer Tiefschlaf. Weitere Studien zeigten, dass der Tiefschlaf bei einer Ernährung mit einem hohen Anteil an schnellen Kohlenhydraten und gesättigten Fettsäuren oberflächlicher ausfällt als bei einer ausgewogenen Ernährung.
Auch viele ältere Menschen klagen über einen oberflächlichen Schlaf. Tatsächlich schlafen Ältere, insbesondere Männer, in der Regel weniger tief. Ein Grund könnte sein, dass die Nervenzellen des Frontallappens durch Beta-Amyloide (sogenannte Alzheimer-Proteine) geschädigt wurden. Als Folge werden die Nervenzellen der Hirnrinde »taub«, sie können nicht mehr richtig synchron miteinander kommunizieren und produzieren deshalb keine langsamen, synchronisierten Gehirnwellen mehr.