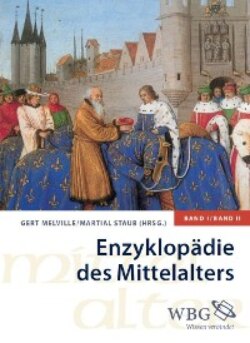Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 73
Verwandtschaftssysteme
ОглавлениеDas mittelalterliche Verwandtschaftssystem war ein dreigliedriges: Deszendenz (in väterlicher und mütterlicher Linie), Heiratsallianz („affinity“, Affinalverwandtschaft) und geistliche Verwandtschaft (insbesondere Taufpatenschaft). Seit den 1980er Jahren ist, angeregt durch anthropologische Studien, herausgearbeitet worden, daß die Geschichte der Verwandtschaft in Europa nur unter Einbeziehung der geistlichen Verwandtschaft verstanden werden kann (A. Angenendt, B. Jussen, J. H. Lynch, J. Goody, A. Guerreau-Jalabert, M. Mitterauer).
Kognatisch oder agnatisch? Gegenwärtig gibt es keinen Konsens über die Organisationsform hoch- und spätmittelalterlicher Deszendentengruppen. Die von K. Schmid angeregte und von G. Duby übernommene Entwicklungsgeschichte vom kognatischen Früh- zum agnatischen Hochund Spätmittelalter (Schmid-Duby-These) bestimmt gegenwärtig noch die deutschsprachige Forschung (trotz K.-H. Spieß): „Das Vererbungssystem“, so die opinio communis auch in jüngsten Handbüchern, „wurde im 10./11. Jahrhundert auf die agnatische Patrilinie eingeschränkt“ (H. Röckelein). Doch inzwischen wird die Schmid-Duby-These mit einer Vielzahl von Argumenten bestritten zugunsten des von J. Goody entworfenen, durchgängig bilateralen Mittelalters: „Im ganzen Zeitraum war Abstammung (‚filiation‘, ‚consanguinité‘) kognatischer Natur, das heißt, daß sie gleichermaßen in weiblicher wie in männlicher Linie wahrgenommen wurde“ (A. Guerreau-Jalabert). Von den praktischen Vollzügen über Namengebung und Verwandtschaftsterminologie bis zur Logik der Grablegung (M. Mitterauer) oder dem sehr kurzen generationellen Gedächtnis des Adels (K.-H. Spieß) spricht, diesen Forschungen zufolge, nichts für die Annahme eines seit dem Hochmittelalter herrschenden agnatischen Systems.
Die neue These vom durchgängig kognatisch (oder bilateral) organisierten Mittelalter hat noch viele Probleme zu meistern, etwa die Deutung der seit dem Hochmittelalter oft agnatisch aussehenden Weitergabe der Herrschaft. Aussichtsreich sind Deutungsversuche, die „Erbe“ und „Sukzession“ analytisch trennen und in dem Signalwort Geschlecht („lignage“) weniger eine Verwandtschaftskategorie sehen als eher ein Legitimationsmedium des Herrschaftszugangs. „Lignage“ meint demnach nicht „agnatisch“ und kann nicht für eine „mutation lignagère“ des Verwandtschaftssystems in Anspruch genommen werden. Vielmehr bildet der Stammbaum eines Geschlechts die ortsbezogene Sukzessionslinie einer Herrschaft ab, eine „topolignée“ (A. Guerreau-Jalabert, J. Morsel), nicht aber eine Verwandtschaft. Nicht Verwandtschaft ist nach dieser Deutung agnatisch organisiert, sondern die Monopolisierung der Herrschaft durch eine kleine Gruppe wird durch eine agnatische Repräsentation der Herrschaftsträger legitimiert (D. Sabean, S. Teuscher) [↗ Adel].
Der Dissens gründet nicht zuletzt in unterschiedlichen Perspektiven. Augenscheinlich ließen sich die deutschen Forscher bei ihren Deutungen weitgehend von der diskursiven Ebene leiten, von „Bewußtsein“ und „Selbstverständnis“, und fanden ein agnatisches System, während die von J. Goody angeregten Forschungen eher die praktischen Operationen der Verwandtschaft wie Besitztransmissionen und Heiratsstrategien deuteten und dabei ein kognatisches System fanden.
Paritätisch und kontraktuell. In der Folge der Impulse K. Schmids ist es zur Gewohnheit geworden, in einer Art polarer Erzählung die „gewachsenen“ hierarchischen Bindeformen des Mittelalters wie Verwandtschaft und Stand den kontraktuellen, paritätischen Bindeformen wie Gilde, Kommune und ritueller Freundschaft (amicitia) gegenüberzustellen. In der Betonung der nicht-verwandtschaftlichen Formen entwirft man das moderne Mittelalter und setzt es ab gegen das traditionale Mittelalter der verwandtschaftlichen und ständischen Sozialbindungen. Dieser Antagonismus wird zu Recht bestritten mit dem Argument, daß das lateineuropäische Verwandtschaftssystem – da es auf das konjugale Paar konzentriert war – nicht anders organisiert gewesen sei als die „modernen“ kontraktuellen Institutionen des Mittelalters, nämlich paritätisch und kontraktuell (M. Mitterauer). Der gesamte Regulierungsapparat des Verwandtschaftssystems richtete sich, wie oben dargestellt, darauf, das Gewachsene zu verhindern zugunsten immer neuer exogamer Kontrakte. In patrilinearen Systemen ist der kontraktuelle Aspekt einer Ehe, der Aspekt der verwandtschaftlichen Allianz, schwach, in bilateralen Systemen, also im Gros des lateinischen Europa, hingegen stark.
Freunde statt Verwandte. Ebenso scheint die erneute Betrachtung der Freundschaft Potential zu bergen, um das Bild der dominanten Verwandtschaft weiter zu schwächen [↗ Liebe, Freundschaft]. Die von M. Bloch und O. Brunner initiierte und bis heute akzeptierte weitgehende Identifizierung der amici mit den Verwandten wird inzwischen bezweifelt, ohne daß das neue Bild schon Kontur hätte. Ausgangspunkt des Neuentwurfs ist die Beobachtung, daß es in den philosophischen Texten des Mittelalters (wie schon in der Antike) keine Reflexion über Verwandtschaft gebe, wohl aber über Freundschaft: „Den für das Mittelalter prägenden Philosophen, von Aristoteles über Cicero, den Kirchenvätern, den Theologen der Scholastik bis hin zu den Humanisten, gilt Freundschaft als die optimale Form menschlicher Beziehungen“ (J. Schmidt).
Entfamiliarisierte Totensorge. Das Christentum hat Abstammung nicht religiös prämiert. In der christlichen Kreation des Witwenstandes ist paradigmatisch abzulesen, daß nun zu Lasten von Verwandtschaft und Ahnen die lebenslange (sogar in der Memoria des/der Überlebenden überlebenslange) monogame Ehe prämiert wurde.
Der Gegensatz des mittelalterlichen Memorialwesens zu den Institutionen römischer Totensorge könnte kaum größer sein: Waren die Memorialpflichten in der römischen Gesellschaft Aufgabe des pater familias, so wurde seit dem fünften Jahrhundert von den christlichen Autoren die hinterbliebene Ehefrau in der ständischen Figur der vidua als Trägerin der Gedenkpflichten konzipiert (auch der hinterbliebene Mann war theoretisch als vidua konzipiert). Doch diese von den Predigern als neuer sozialer Typus erfundene vidua erbte keineswegs die Memorialaufgaben des mit dem Ende der römischen Gesellschaft untergehenden pater familias. Zum einen war sie nicht mehr wie der pater familias für alle Ahnen zuständig, sondern nur noch für ihren eigenen verstorbenen Gatten. Auch nahm die Witwe, wenn sie ihrerseits starb, diese Memorialpflicht mit ins Grab. Familiale Memorialpflicht war also ausgesprochen endlich, nämlich gebunden an den Ehepartner und dessen oder deren Lebensdauer. Schließlich waren mit der Konzeption der vidua als einer Figur im Dienst am toten Ehemann zwar große paränetische, aber nie rechtliche Anstrengungen verbunden. Während die römische Gesellschaft erheblichen Rechtsaufwand betrieben hat, um die Fortführung des pater familias unter allen Umständen zu gewährleisten (Adoptionsinstitut), haben die christlichen Gesellschaften des Mittelalters keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die von den Witwen (und bisweilen Witwern) erwarteten Memorialdienste sicherzustellen. Sie haben nirgends und zu keiner Zeit etwas dagegen getan, daß viele Witwen ihren Memorialaufgaben nicht nachkamen und statt dessen erneut heirateten (B. Jussen). Diese um 400 entstandene Form der konjugalen statt familienväterlichen, auf den Gatten statt die Ahnen bezogenen, kaum bindenden Totensorge zeigt schlaglichtartig, daß nicht mehr Abstammung, sondern das lebenslang verbundene konjugale Paar im Zentrum der religiösen Anstrengungen stand – zu Lasten von Verwandtschaft und Ahnensorge.
Die Totensorge und damit das Verhältnis von Verwandtschaft und Memorialsystem wurde völlig neu organisiert. Obgleich die Forschung der letzten Jahrzehnte Verwandtschaft und Memoria wie zwei Seiten einer Medaille erforscht hat, ist nicht zu übersehen, daß die Belange der Toten im lateineuropäischen Verwandtschaftssystem keinen systematischen Platz hatten. Auf keiner verwandtschaftlichen Position lastete der institutionalisierte, durch ius oder mos gesicherte Druck dieser Aufgabe in der Art der römischen patria potestas oder des semitischen Levirats.
Mit der von Anbeginn der Kirche sehr starken Rolle der Gemeinde für das Seelenheil und mit dem früh etablierten Modell der Fürbitte durch besonders ausgewiesene Interzessoren („Viel vermag das Gebet des Gerechten“, Jak 5,16) begegneten die frühen poströmischen Gesellschaften sogleich mit ihrer Christianisierung einer funktionierenden Memorialpraxis, die auf der kirchlichen Infrastruktur, nicht aber auf der Verwandtschaft gründete (A. Angenendt). Die Memorialleistungen für Verstorbene oblagen spezialisierten Institutionen, seien es Klöster (Privatmessen etc.), kirchliche Amtsträger oder Gemeinden (Fürbitten etc.), also Institutionen, die als geistliche und zölibatäre Institutionen ausdrücklich Gegenentwürfe zur fleischlichen Verwandtschaft waren [↗ Memoria]. Verwandte konnten sich engagieren (und taten es oft), mußten es aber nicht. Zumindest an Stichproben wird inzwischen die nur sehr geringe genealogische Erinnerungstiefe spätmittelalterlicher adliger Verwandtschaften deutlich (K.-H. Spieß). Wenn über Jahrhunderte Gedächtnisvorsorge und Weitergabe des Erbes im selben Dokument geregelt wurden (dem Testament), so deutet dies an, daß die Betroffenen sich selbst um ihr Seelenheil kümmerten, da es in der Familie (ungeachtet faktischer Aktivitäten familialer Totensorge) keinen systematischen Platz dafür gab.
Entfamiliarisierung des Sozialen. Inzwischen hat sich die Auffassung durchgesetzt, daß die „Entwertung der fleischlichen Verwandtschaft als strukturierendes Element der Gesellschaft“ das dominierende Grundmuster mittelalterlicher Verwandtschaft war. Konsequent zog die Kirche die geistliche Verwandtschaft der fleischlichen vor, und konsequent schützte sie das konjugale Paar gegen die Verwandten. Diese „Entfamiliarisierung“ („déparentelisation“, J. Morsel) des Sozialen ist in vergleichbaren Gesellschaften außerhalb Lateineuropas ausgeblieben. Allein in Lateineuropa ist Verwandtschaft im frühen Mittelalter von einer das Soziale strukturierenden Institution zu einer Institution geworden, die der Strukturierungslogik anderer Institutionen unterworfen war (A. Guerreau-Jalabert, J. Morsel).
In dieser Beobachtung steckt ein Forschungsprogramm, das erst in Umrissen abgeschritten ist. Die These von der Entfamiliarisierung des Sozialen bedeutet, daß soziale Regelungsbereiche mit ihren Rechten und Pflichten, die in patrilinearen Gesellschaften von der Verwandtschaft übernommen oder zumindest strukturiert werden, in Lateineuropa von anderen Institutionen organisiert wurden – man denke an die Ausübung des Verheiratungsrechts (grundherrschaftliche Endogamie), die Vormundschaft (z.B. des Grundherrn), die Reduktion des Namenbestandes um 1200 durch Nachbenennung (u.a. nach Lehensherren) oder die Art der Öffentlichkeit einer Heirat (vor der Gemeinde statt der Verwandtschaft). Wer das Proprium der Verwandtschaftsgeschichte im europäischen Mittelalter erforschen will, muß also nicht zuletzt auf jene Funktionen sehen, die in Lateineuropa nicht verwandtschaftlich organisiert waren. Dazu bedarf es eines komplizierten Instrumentariums. Zu überprüfen ist dabei der gesamte Bestand an Aufgaben, die eine Gesellschaft bewältigen mußte, um neue Mitglieder so zu sozialisieren, daß sie Erwachsenenrollen wahrnehmen konnten. Die eigentümliche Strukturschwäche der lateineuropäischen Verwandtschaft läßt sich in der Beobachtung all jener Regelungsbereiche aufspüren, die zur sozialen Ersetzung nötig waren – von der Funktion der Genitores über die Initiation in die Gesellschaft (Taufe), Erziehung, Weitergabe von (elementarem, spezifischem, gelehrtem) Wissen, Initiation in die Erwachsenenwelt, Übertragung von materiellen Gütern, von familialem und sozialem Status bis zur Versorgung der Alten und zur Sepulkral- und Memorialkultur. Die verschiedenen Gesellschaften unterscheiden sich nicht nur durch die sozialen Typen, auf die diese Funktionen normalerweise verteilt waren, sondern auch dadurch, ob und wie sie delegiert waren, wenn die „normalen“ Inhaber der Rechte oder Pflichten aus irgendeinem Grund ausfielen (B. Jussen).
BERNHARD JUSSEN