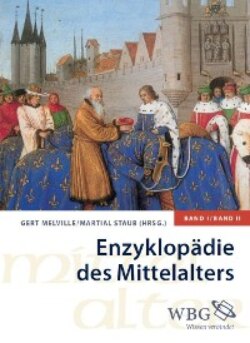Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 74
Gentile Ordnungen
ОглавлениеDer Begriff „gentil“ ist aus dem lateinischen Wort gens abgeleitet, das „Stamm“, „Volk“, aber auch „Sippe“, „Dynastie“ bedeuten kann und dabei den Aspekt gemeinsamer Abstammung betont [↗ Verwandtschaftssysteme]. In die Mittelalterforschung kam „gentil“ (oder „gentilizisch“, davon abgeleitet „Gentilismus“) einerseits vermittelt durch die Arbeit von F. Engels über die „Geschichte des Privateigentums, der Familie und des Staates“ (1884), von wo es vor allem marxistisch orientierte Gelehrte übernahmen (z.B. J. Herrmann). Andererseits hatte den Begriff A. Dove in seinen 1916 postum erschienenen, vielbenützten „Studien zur Vorgeschichte des deutschen Volksnamens“ benutzt. Man verstand darunter eine ursprüngliche, „auf Geschlechterbande begründete“ (Engels) und dem überethnisch-imperialen, aber auch dem politisch-nationalen Prinzip entgegengesetzte Ordnung. Besondere Konjunktur hatte der Begriff nach 1945, wo er in der deutschen Forschung das anstößig gewordene Wort „völkisch“ ersetzen sollte. Paradoxerweise erlaubte gerade der etymologisch auf gemeinsame Abstammung verweisende Begriff in der Frühmittelalterforschung die Distanzierung vom biologischen Volksbegriff. Besonders einflußreich war in diesem Zusammenhang das Werk „Stammesbildung und Verfassung“ von R. Wenskus (1961). Er arbeitete das „gentile Bewußtsein“ als „Denkform“ der Germanen heraus, die das römische Reichsbewußtsein verdrängt habe und damit die Durchsetzung gentiler Ordnungen im werdenden Abendland ermöglichte. H. Beumann und H. Löwe verbanden die „gentile Betrachtungsweise“ als geistige Haltung mit dem Personenverbandsstaat als früh- bis hochmittelalterlicher Verfassungsform. W. Fritze untersuchte die fränkische Wahrnehmung einer „Welt von Gentes“ und erweiterte damit den Blickwinkel, ebenso wie F. Graus, auf die gentilen Ordnungen der Slawen. A. Angenendt und L. von Padberg untersuchten die Aufspaltung des universalen populus Christianus in (germanische) „Gentilkirchen“, deren völliges Auseinanderfallen mühsam von Papsttum und Kaisertum verhindert wurde. Die „deutschen Stämme“, also Franken, Bayern, Sachsen etc. betrachtete man als „gentile Bausteine“ (Beumann) der werdenden deutschen Nation. Schon dadurch war die „gentile Ordnung“ als pränational gekennzeichnet.
Bei näherer Betrachtung ist der Begriff „gentil“ freilich aus mehreren Gründen problematisch; das hat auch dazu geführt, daß sein Gebrauch seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts deutlich zurückgegangen ist. Am wenigsten Schwierigkeiten macht noch die damit implizierte Vorstellung von gemeinsamer Abstammung; seit Wenskus ist im wesentlichen unbestritten, daß für die Gentes des Frühmittelalters nicht die tatsächlich gemeinsame Abstammung konstitutiv war, sondern der durch Herkunftsmythen vermittelte Glaube daran. Störender sind die Interferenzen mit anderen Bedeutungen des Wortes „gentil“. Die mittellateinische Bedeutung gentilis = „heidnisch“ ist heute im Englischen vorherrschend, während französisch und italienisch „gentil(e)“ „höflich“ bedeutet; der deutsche Forschungsbegriff bleibt also unübersetzbar und wurde demgemäß international kaum rezipiert. „Gentil“ heißt nicht einfach „ethnisch“, sondern deckt nur einen vormodernen Teilbereich dieses in den Kultur- und Sozialwissenschaften ungleich häufigeren Begriffes ab. Eigentlich steckt in „gentil“ ein wenn auch meist implizit bleibender Epochenbegriff (nur zuweilen ist explizit vom „Gentilzeitalter“ die Rede).
Meist wird der Begriff recht unreflektiert eingesetzt. Welche Ordnungen sind eigentlich „gentil“, wann beginnen sie und wann enden sie? Im marxistischen Gebrauch wurde als „gentil“ die familiengebundene und lokal beschränkte Ordnung der Urgesellschaft verstanden, die mit sozialer Differenzierung und Herrschaftsbildung endete; das Frankenreich wäre sicher nicht mehr gentil zu nennen. Bei Wenskus beschreibt „gentil“ vor allem die Verhältnisse am Übergang von der Antike zum Mittelalter. In der (west-)deutschen Mediävistik seit 1945 geht es meist um etwas anderes, nämlich um die Beschreibung herrschaftlicher Großverbände, deren staatlicher Durchgriff durch die starke Bindung der Akteure in lokalen und regionalen Gemeinschaften oder Interessen beschränkt ist. Vor allem soll der beschränkte „gentile“ Horizont der „deutschen Stämme“ zu erklären helfen, wieso das ostfränkische Reich und das römisch-deutsche Imperium sich nicht direkt zum modernen Staat entwickelt konnten. Auch hier sind beträchtliche Schattierungen des Begriffs festzustellen: Einerseits wird die fränkische Reichseinheit von den „gentilen Bausteinen“ im Sinne Beumanns, nämlich Bayern, Sachsen und anderen, in Frage gestellt; andereseits ist auch die fränkische Reichskirche eine „Gentilkirche“ im Sinn Angenendts, da sie mehr an der fränkischen Ecclesia als an der römischen Universalkirche orientiert ist.
Demgemäß weichen auch die Vorstellungen, wann denn gentile Ordnungen abgelöst wurden, voneinander ab oder werden vielmehr nicht präzisiert. Einerseits gelten bereits das Karolingerreich und die Errichtung des abendländischen Imperiums als wichtiger Schritt zu ihrer Überwindung. Andererseits hat gerade die neuere deutsche Forschung die Staatlichkeit des frühund hochmittelalterlichen „Reiches“ sehr niedrig eingeschätzt und den archaischen Charakter seiner Ordnungen betont. Meist wird daher angenommen, erst der politische Zerfall der „gentilen Bausteine“ habe zur Auflösung der gentilen Ordnungen geführt; an die Stelle der bayerischen, schwäbischen oder sächsischen Gens traten im 13./14. Jahrhundert stärker territorial strukturierte Länder, Landesbewußtsein löste das gentile Bewußtseins ab; allmähliche Herrschaftsverdichtung (allerdings wieder regional gebunden) verstärkte den staatlichen Zugriff. Für das Verständnis der deutschen Entwicklung bietet dieses Modell manchen Vorteil; der Nachteil ist, daß es kaum auf den Rest Europas übertragbar ist. Zudem stellt sich die Frage, ob die früh- und hochmittelalterliche Ordnung mit Erkenntnisgewinn als „gentil“ zu beschreiben ist – gleichgültig, wie hoch oder gering man ihre Integrationskraft, Staatlichkeit oder Organisationskapazität einschätzt.
Welche Ordnungen können überhaupt als gentil betrachtet werden? Im Aufbau dieser Enzyklopädie gehören sie gemeinsam mit den ständischen und verwandtschaftlichen zu den sozialen Ordnungen und werden damit von den herrschaftlichen und politischen Ordnungen abgehoben. Das sollte freilich die vor allem politische Bedeutung der Gens nicht verdecken. Falls man den Begriff „gentil“ verwenden will, ergeben sich aus der Literatur etwa folgende Kriterien und Begriffsinhalte. Gentile Ordnungen erfassen und gestalten die Welt vor allem von der Gens her. Sie verorten die ausschlaggebende Zugehörigkeit in einer Abstammungsgemeinschaft. Gentiles Bewußtsein greift dabei über die lebensweltlich unmittelbar erfahr- und erinnerbaren Verwandtschaftsverhältnisse hinaus auf einen umfassenderen, aber immer noch bis zu einem gewissen Grad überblickbaren Verband. Diese grundlegende Bestimmung der gentilen Ordnungen von der Gens her stößt allerdings auf die Schwierigkeit, daß der Begriff gens im Frühmittelalter Verbände von außerordentlich unterschiedlicher Größe bezeichnen konnte. Selbst wenn man die dynastische Bedeutung beiseite läßt, kommen etwa für einen Bewohner von Wessex als gentiler Bezugsrahmen die Westsachsen von Wessex, die in England lebenden oder alle Sachsen insgesamt, die gens Anglorum (im Sinne Bedas) oder Anglo-Saxonum (seit dem 9. Jahrhundert) in Betracht. Gentile Zuordnung konnte durchaus mehrdeutig oder flexibel sein, wobei noch das Spannungsverhältnis von Selbstund Fremdbezeichnung zu berücksichtigen ist. Gentile Ordnung ist nicht quasi-naturwüchsig und unentrinnbar aufgeprägt, sondern traditionell vermittelt, aber kontextuell veränderbar.
Orientierungspunkt der Gens ist laut Wenskus die Tradition, die vor allem Herkunftssage und „gentile Verfassung“ überliefert. Gehütet wird diese Tradition von einem „Traditionskern“, einer kleinen Gruppe, die (modern gesprochen) die Identitätsressourcen und das gruppenspezifische kulturelle Gedächtnis bewahrt. Dabei kann es sich um die Angehörigen eines Herrschaftszentrums (etwa eine Königsfamilie samt Anhang), aber auch um „weise“ Männer oder Frauen, Priester, Druiden, Skalden etc. handeln. Der Erfolg dieser Kerngruppe, aber auch die Attraktivität der Tradition führen zum Anschluß weiterer Gruppen, die sich bald zugehörig fühlen und sich schließlich zur selben Abstammungsgemeinschaft zählen, was zur Stammesbildung (R. Wenskus) oder Ethnogenese (H. Wolfram) führt. Das Werk von Wenskus bleibt grundlegend, auch wenn es noch sehr in heute aufgegebenen Denkmustern der „germanischen Altertumskunde“ verhaftet war. Aus heutiger Sicht muß die Vorstellung der Weitergabe von Traditionen durch einen stabilen „Kern“ wohl modifiziert werden, denn kulturelle Erinnerung kann auch dezentral (und nicht zuletzt durch Frauen) weitergegeben werden. Auch wird man die Anpassungsfähigkeit dieser Traditionen an neue Umstände und die Notwendigkeit des ständigen Ausgleichs zwischen verschiedenen Versionen wohl höher einschätzen als das Wenskus getan hat. Wenskus, der ideengeschichtlich dachte, betonte die Rolle der geistigen Durchdringung und der Durchsetzung von Normen der „gentilen Verfassung“ für die Stammesbildung; heute sieht man Identitätsbildung vor allem als soziokulturellen Prozeß, für dessen Erfolg die „ethnische Praxis“ ausschlaggebend ist. Dennoch hat das Modell von Wenskus weiterhin grundlegende Bedeutung bei der Erklärung ethnischer Prozesse in Spätantike und Frühmittelalter. Unbedingt zu berücksichtigen ist allerdings die auf Wolfram zurückgehende Beobachtung, daß in den aus schriftlicher Überlieferung bekannten Fällen die „Anerkennung und Integration“ in der römischchristlichen Welt Voraussetzung einer erfolgreichen Ethnogenese war. Bei den Gentes der Goten, Franken oder Langobarden handelte es sich also nicht, wie das noch Wenskus angenommen hatte, um die Verpflanzung gentiler Ordnungen aus der Germania auf Reichsboden, sondern um Ergebnisse eines komplexen Integrationsprozesses in die spätrömische Welt.
Zentrales Element der Tradition war ein Bestand gemeinsamer identitätsstiftender Mythen, vor allem einer Herkunfts- und Wandersage [↗ Völkerwanderung]. Gute Beispiele sind die Herkunftsberichte der Goten und Langobarden aus Skandinavien (bei Jordanes bzw. Paulus Diaconus) oder die Legende von der Überfahrt von Hengist und Horsa nach Britannien bei Beda. Solche origines gentium berichten meist, woher ein Volk kam, wieso es aufbrach, erzählen von der Überwindung von Hindernissen (Meeresoder Flußüberquerungen, Schlachten und „primordiale Taten“) und der Abstammung der Könige, skizzieren den Wanderweg und markieren den Einzug und die „Landnahme“ im neuen Siedlungsgebiet. Manchmal, etwa bei den Langobarden, wird auch die Namengebung begründet. Oft spielen zu Beginn Frauen eine bedeutende Rolle, deren Einfluß im Lauf der Wanderung zurückgedrängt wird, wie P. Geary gezeigt hat. Freilich sind nicht von allen frühmittelalterlichen Völkern Herkunftssagen erhalten (sie fehlen etwa bei den Alemannen) bzw. sie wurden sehr spät fabriziert (wie die Geschichte von der armenischen Herkunft der Bayern). In vielen Fällen ist schwer entscheidbar, ob es sich um gelehrte Fiktionen von geringer Resonanz handelte oder tatsächlich um identitätswirksame Legenden [↗ Fiktionen]. Hier hilft auch nicht die in der älteren Forschung versuchte Unterscheidung zwischen „authentischen“ Abstammungssagen aus Volksüberlieferung (etwa der langobardischen Origo aus Skandinavien) und den literarischen Fabrikationen von Gelehrten (wie der fränkischen Trojasage); denn kaum eine origo gentis ist im Mittelalter so breit rezipiert worden wie die trojanische Herkunft der Römer und Franken. Immerhin bieten „vorethnographische“ Informationen (Wolfram) in den erhaltenen origines gentium Anhaltspunkte dafür, daß es sich nicht ausschließlich um Erzählungen lateinischer Gelehrter handelte. Die Vielfalt der überlieferten frühmittelalterlichen Herkunftsberichte beweist insgesamt das Interesse daran; doch daß sie vielerorts fehlen, spät auftreten oder wenig rezipiert wurden, scheint auch darauf hinzudeuten, daß gemeinsame kulturelle Erinnerung nicht unbedingt eine Abstammungssage erforderte.
Das zweite Element „gentilen Bewußtseins“ bei Wenskus, und grundlegend für gentile Ordnungen, ist dasjenige, was er „gentile Verfassung“ nannte. Dieser Begriff geht über den Gegenstand der Verfassungsgeschichte hinaus und zielt auf alle traditionell normierten oder legitimierten Lebensordnungen. Er umfaßt vor allem jene mündlich überlieferten Rechtsbräuche, die im Langobardenrecht cawarfida genannt werden und sich etwa in den ältesten Schichten der fränkischen Lex Salica schattenhaft abzeichnen. Auch die Berichte des Tacitus über die Lebensordnungen der Germanen lassen sich als Hinweis darauf verstehen. Hier bewegt man sich freilich, wie in der Forschung zunehmend klar geworden ist, am Rande des methodisch sauber Erfaßbaren. Daß die Leges der Westgoten, Franken, Angelsachsen oder Langobarden unter anderem aus vorschriftlichen Rechtsbräuchen gespeist werden, scheint naheliegend [↗ Germanisches Recht]. Wo das im einzelnen der Fall ist, läßt sich aus den (bis auf das Angelsachsenrecht) lateinisch überlieferten Texten der Leges aber kaum anders als durch mehr oder weniger begründete Spekulation ergründen. Sind die in den Leges in römischer Währung aufgezählten Bußen und Kompensationen für Totschlag, Verletzungen und Beleidigungen archaisch oder ein Versuch, in den Regna die zuvor unumgängliche Rache einzudämmen? Sind die so altertümlich anmutenden Feuerproben und andere Gottesurteile nicht vielleicht ein christliches Element? All das ist in der jüngeren Forschung diskutiert worden. Inhaltlich sind hier die Unterschiede zwischen den einzelnen Leges, aber auch ihre Gemeinsamkeiten mit spätrömischen bzw. byzantinischen Rechten, etwa aus dem Orient, zu berücksichtigen. Fraglich ist überhaupt die Wirksamkeit und Effektivität der Normen. Daß die Germanen stärker als andere, vor allem aber spätere Gesellschaften in ihrem Normengeflecht verwurzelt waren, wie es V. Grønbech einst so suggestiv dargestellt hat, ist außerhalb der literarischen Stilisierung der nordischen Sagas nicht zu begründen – die Merowinger- oder Langobardenkönige geben zu drastische Gegenbeispiele ab.
Bei den Rechtsordnungen begegnen wir zudem wiederum einem Datierungsproblem. Ist „gentile Ordnung“ im vollen Sinn nur die schattenhaft erkennbare, vorschriftliche Rechtsordnung? Dann wäre schon die Promulgation der Leges (bei den Westgoten im 5., bei den Franken im 6. und bei den Langobarden im 7. Jahrhundert) in lateinischer Fassung und angereichert mit Bestimmungen, die Fragen der Kirche, des Königtums oder der Grundherrschaft betreffen, ein Bruch damit. Oder sind gerade die Leges mit ihrem jeweils ethnisch definierten Geltungsbereich Zeugnisse gentiler Ordnung? Dann hätte erst das Karolingerreich mit der Durchsetzung der Personalität des Rechtes in seinem Bereich eine ausgereifte gentile Ordnung verwirklicht. Endete die gentile Ordnung dann mit dem Wirken der Rechtsschule von Pavia, die mit an römischem und kanonischem Recht geschulter Gelehrsamkeit das Langobardengesetz kommentierte, systematisierte und ausdeutete? Oder erst, als die Leges Langobardorum außer Gebrauch kamen? Wären „Sachsen-“ und „Schwabenspiegel“ noch Zeugnisse gentiler Ordnung? Immerhin, daß Rechtsbücher im Frühmittelalter in der Regel überhaupt ethnisch bezeichnet wurden, ist bemerkenswert. Doch kann man darin auch einen Vorläufer des heutigen nationalstaatlichen Rechtes sehen.
Als gentile Ordnung ist in der Forschung zuweilen auch ein Stadium des Herrschaftsaufbaues und der Verfassungsentwicklung (in einem engeren Sinn als bei Wenskus, der darunter die normgebundene Lebensordnung überhaupt verstand) aufgefaßt worden. Diese Auffassung stand im Kontext der deutschen verfassungsgeschichtlichen Schule der Mitte des 20. Jahrhunderts, die mit O. Brunner statt an abstrakten konstitutionellen Formen an „konkreten Ordnungen“ interessiert war, mit H. Dannenbauer das Mittelalter von autonomen Adelsherrschaften geprägt sah, mit O. Höfler vom germanischen Charakter des mittelalterlichen Staates ausging und insgesamt das Wesen der politischen Ordnung in den ritualisierten persönlichen Verbindungen der Akteure sah. Das Volk war aus dieser Sicht das Konkrete, der Staat das Abstrakte, in der Realität daher wenig mehr als die Summe (in heutigen Begriffen gesprochen) der Interaktionen seiner Akteure und der Spielregeln, nach denen sie abliefen. Lang war aus dieser Sicht der Weg zur Herausbildung eines überpersönlichen, territorial fixierten und von der Herrschaftsausübung der Mächtigen begrifflich geschiedenen Staates, der sich erst im Spätmittelalter abzuzeichnen begann und in der Neuzeit Gestalt annahm. Die Zeit bis dahin war geprägt von persönlichen, verwandtschaftlichen und eben gentilen Loyalitäten und Feindschaften, die mühsam gebändigt wurden von einem archaischen Normensystem und von den Anstrengungen einer Kirche, die selbst tief von dieser Denkweise geprägt war. In manchem ist dieses Modell heute aufgegeben; in vielen Ausprägungen sind solche Vorstellungen von einem Früh- und Hochmittelalter ohne überpersönliche Gemeinschaftsvorstellungen und institutionelle Bindungen heute noch in der deutschen Mediävistik verbreitet, auch wenn die Bezeichnung „gentile Ordnung“ dafür nicht mehr allgemein gebräuchlich ist. Deshalb ist es hier nicht notwendig, auf die Einwände gegen das Modell vom „archaischen“ Frühmittelalter einzugehen.
Entscheidend für den Begriff von gentiler Ordnung ist, wie sich aus dem Bisherigen ergibt, die Entstehung einer „Welt von Gentes“ am Ende der Antike, die das universal orientierte Imperium Romanum weitgehend auflöste und ersetzte. Der Befund ist tatsächlich trotz einiger Einwände recht eindeutig. An die Stelle eines Imperators, der ethnische Bezeichnungen im Titel allenfalls als Triumphnamen nach der Überwindung fremder Völker trug (Gothicus, Germanicus etc.), traten Könige, die nach ihrem Volk benannt wurden: rex Gothorum, rex Francorum etc. Diese ethnischen Königstitel wurden zwar zunächst nicht ausschließlich geführt (Theoderich etwa trug einfach den Titel rex, „König“, ohne ethnische Bezeichnung), doch sie waren in der Fremdwahrnehmung selbstverständlich und setzten sich letztlich durch. Gesetzbücher und viele Chroniken orientierten sich an dieser Einteilung der Welt nach Gentes. In diesem Sinn war das Frühmittelalter in Europa (mit Ausnahme von Byzanz und den islamischen Gebieten) tatsächlich „gentil“.
Die Völkernamen kamen fast ausschließlich aus dem außerrömischen Bereich; deswegen ist diese gentile Weltordnung als archaisch betrachtet worden. Doch war Rolle und Aufbau der Gentes vor und nach der Reichsgründung auf römischem Boden sehr unterschiedlich. Erfolgreiche Reichsgründungen nach diesem Modell setzten die Ansiedlung auf Reichsboden, später die Christianisierung voraus. Die Durchsetzung „gentiler“ Ordnungen (gentiler Königstitel, Personalität des Rechtes, Verbreitung von origines gentium) ging den Reichsgründungen nicht voraus, sondern nahm teils Jahrhunderte in Anspruch. Es ist daher unwahrscheinlich, daß es sich einfach um ein archaisches, von Barbaren im Römerreich durchgesetztes Prinzip handelte. Die Selbstzuordnung in Stammesgesellschaften funktioniert meist nach der grundlegenden Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Allenfalls wird diese Begrenzung der „In-Group“ ergänzt durch spezifische Bezüge auf Nachbarn oder Feinde. Die gentile Welt des Frühmittelalters war hingegen eine Welt von Völkern, die darin alle ihren Platz hatten. Wo neue Feinde auftauchten, das hat J. Fried am Beispiel der Normannen des 9. Jahrhunderts gezeigt, wurden sie ebenfalls als Gens in das Weltbild eingeordnet, auch wo das an den Verhältnissen vorbeiging; diese Sichtweise setzte bereits eine beträchtliche Abstraktionsleistung voraus. Sie beruhte sowohl auf der römischen Ethnographie, die den Bereich jenseits der Reichsgrenzen nach Völkern geordnet hatte, als auch auf der christlichen Lehre. Zwar forderte die Kirche nach Paulus die unterschiedslose Eingliederung in das Volk Gottes, den populus Christianus; doch andererseits lautete der apostolische Missionsauftrag, alle Völker, gentes, zu lehren. Das Alte Testament bot reiches Material sowohl für die Selbstvergewisserung einer Gott besonders wohlgefälligen Gens als auch für die Wahrnehmung der Umwelt als einer Welt von Völkern. A. Borst hat in seinem großem Werk über den „Turmbau von Babel“ reiches Material über die Herleitungsversuche der Vielfalt von Völkern und Sprachen aus der babylonischen Sprachverwirrung und von den Söhnen Noahs gesammelt.
Das gentile Element war also kein archaisches, das politischer Integration im Weg stand und Herrschaftsbildung an partikulare Interessen band, so daß Staatsbildung behindert wurde. Es bot Integrationsmöglichkeiten, die schließlich zur Voraussetzung für die widersprüchliche und komplexe Entwicklung europäischer Nationalstaaten werden konnten. Die von der Kirche sanktionierte Verbindung von Gens und Regnum gehört ebenso zur politischen Grammatik der europäischen Geschichte wie das römischimperiale Modell und der christliche Universalismus. In diesem, allerdings sehr speziellen Sinn ist die früh- und hochmittelalterliche Gesellschaft tatsächlich eine gentile Ordnung gewesen. Doch waren die ethnisch begründeten Königreiche untereinander durchaus unterschiedlich, von den regionalen angelsächsischen Reichen über das territorial konsolidierte Westgotenreich des 7. Jahrhunderts zum imperialen Karolingerreich des 9. Jahrhunderts. Gemeinsame „gentile“ Ordnungen der Herrschaft lassen sich hier kaum konstruieren, allenfalls in sehr pauschaler Art im Gegensatz zum modernen Staat, was aber recht wenig Erkenntniswert hat. Die für „gentile Ordnungen“ grundlegenden ethnischen Bezüge der Herrschaft und die Wahrnehmung der Welt als einer Welt von Völkern wiederum wurden erst in den Nationalstaaten der Moderne in vollem Umfang geschichtswirksam.
WALTER POHL