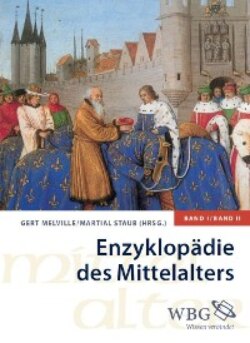Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 84
Gesetze, Satzungen
ОглавлениеIn der Zeit der absoluten Monarchie wird die Gesetzgebung zu einer ausschließlichen Funktion des Herrschers. Jean Bodin († 1596) stützte seinen Souveränitätsbegriff auf die potestas legibus soluta und sieht im Gesetz, das nach staatlichen Zweckmäßigkeitserwägungen geändert werden kann, „le commandement de celuy qui a la souveraineté“. Dieser Auffassung liegt rechtstheoretische Grundlagenarbeit der gelehrten Juristen seit dem 12. Jahrhundert zugrunde. Diese erarbeiteten die gedanklichen Voraussetzungen, wonach Recht gesetzt und damit instrumental zweckfunktional verfügbar wird und temporal und situationsbedingt beweglich ist. Zwei Elemente sind in der historischen Retrospektive besonders zu beachten, nämlich die Entwicklung eines Bewußtseins von der willkürlichen Setzbarkeit von Recht und damit einhergehend die Institutionalisierung von Rechtssetzungsinstanzen und Verfahren.
In der oral geprägten Kultur nördlich der Alpen mit ihrer Dominanz mündlich tradierter Gewohnheiten, in der die Vergangenheit in einem unmittelbaren Funktionszusammenhang mit der Gegenwart steht, findet Rechtsveränderung mehr oder weniger unbewußt statt. Die Vorstellung bewußter Rechtsänderung setzt voraus, daß die „Vergangenheit als eine von der Gegenwart unterscheidbare Existenzweise“ erfaßt wird, eine Entwicklung, die von der Kirche und insbesondere vom Religiosentum [↗ Religiosenrecht] mit ihrer – allerdings zeitlich unterschiedlich intensiven – Schriftlichkeit eingeleitet wird und im 11. Jahrhundert das Paradigma der dominierenden Oralität grundsätzlich zur Disposition stellt. Erst „als die Kirche wirklich die Vergangenheit als eigene Größe entdeckte“ – so H. Vollrath –, „löste sie eine Revolution in Europa aus, die als Investiturstreit und Scholastik das politische wie das religiöse und geistige Leben von Grund auf erschütterte“ [↗ Schriftlichkeit und Mündlichkeit].
Die Vorstellung der Änderbarkeit von Recht war auch dem Frühmittelalter geläufig. Soweit römisches und/oder kirchliches Recht auf einheimische Rechtsvorstellungen einwirkte, wurde auch die Veränderbarkeit von Recht ausdrücklich bewußt. So wird etwa im Prolog der Lex Baiuvariorum von einer Gesetzgebung der Frankenkönige Theuderich, Childebert und Chlotar sowie einer abschließenden Überarbeitung Dagoberts berichtet. Derartige Belege auf dem Hintergrund einer prägenden Oralität können aber in ihrer Wertigkeit schwer eingeschätzt werden, sind oft nur „bloße Lesefrüchte“. Demgegenüber blieb die Idee der Rechtsänderung in der Kirche wach. Die necessitas temporis ermöglichte eine kritische Prüfung der Vergangenheit durch die Gegenwart und verdichtete sich bei Papst Gregor VII. zu einer Rechtsetzungsgewalt (Dictatus papae VII: Quod illi soli licet pro temporibus necessitate novas leges condere). Dieser Anspruch auf Setzung neuen Rechts wurde von der Kanonistik zum umfassenden Gesetzgebungsanspruch des Papstes ausgebaut. Parallel dazu wurde, ausgehend von den wiederentdeckten Texten des römischen Rechts, im Kaiser der rechtmäßige Nachfolger der antiken Imperatoren gesehen, der das Recht als lex animata sichtbar darstellte und als conditor et interpres legum die Einheit von Reich und Recht gewährleistete. Der justinianische Satz vom Gesetzgebungsrecht des Kaisers wurde mit der Lehre vom rex imperator in regno suo auf die Könige ausgedehnt und verbreitete sich, meist mit dem Zusatz superiorem in temporalibus non recognoscens im lateinischen Europa. Begleitet wurde diese Entwicklung mit einer allgemeinen rechtstheoretischen Erfassung von Recht und damit auch des Gesetzes. Im Anschluß an Isidor von Sevilla (†636) beschreibt Gratian im 12. Jahrhundert die lex als constitutio scripta. Deutlich unterscheidet die Kanonistik die lex von sententia und praeceptum und beschreibt sie unter anderem mit Zukunftsgeltung, Dauergeltung und personaler Allgemeinheit. Im Laufe des 12. Jahrhunderts erscheint wiederholt die Differenzierung eines vom Menschen geschaffenen ius positivum und eines vorgegebenen ius naturale, von S. Gagnér als einer „der Keime des zukünftigen Gesetzespositivismus“ beschrieben. Mit ihren rechtstheoretischen Bemühungen liefern insbesondere die Kanonisten den Grundstock für eine rational gesteuerte Gesetzgebung. Konsequenterweise setzt sich mit der Veränderung des Herrschers vom custos zum conditor legum auch die Interpretationsmaxime des lex posterior derogat legibus prioribus durch. Damit korrespondiert auch das seit dem 13. Jahrhundert aufkommende mittelhochdeutsche Wort setzunge (Satzung), das unter anderem auch Festsetzung, gesetzliche Bestimmung meint.
Im Anschluß an die aristotelische Tugendlehre entwickelt Thomas von Aquin († 1274) einen Gesetzesbegriff, dessen Konstituenten die rechtsphilosophische Diskussion bis in unsere Tage bestimmten. Nach ihm ist das Gesetz eine Anordnung der Vernunft im Hinblick auf das Gemeinwohl, erlassen und öffentlich bekanntgemacht von dem, der die Sorge für die Gemeinschaft innehat.
In der rechtshistorischen Diskussion ist keine Einigkeit erzielt worden, welche mittelalterlichen Rechtsquellen dem Gesetzesbegriff subsumiert werden können. Die jeweilige Einteilung hängt vom gewählten Gesetzesbegriff ab. H. Krause geht in seinem Beitrag im „Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte“ von „abstrakten Rechtsnormen mit dem Willen zur generellen Geltung aus“, eine Annäherung, die „erst seit dem Aufkommen des modernen Staates im späten Mittelalter einige Richtigkeit beanspruchen (kann)“. Können auf diesem Hintergrund auch frühmittelalterliche Normen als „Gesetze“ bezeichnet werden? W. Sellert behauptet diese Qualität pauschal für die Stammesrechte. Sie seien „eine schriftlich verkörperte und staatsautoritative Fassung von Rechtsregeln“, mit dem Geltungsanspruch gegenüber Dritten, die „nach wie vor mit gutem Gewissen als Gesetzgebungen bezeichnet werden können“. Allerdings, die „staatsautoritative Fassung wie auch der Geltungsanspruch (und die Effektivität) sind in der Forschung bis heute umstritten. Um den Schwierigkeiten eines inhaltlich aufgeladenen Gesetzesbegriffes in seiner Anwendung auf „mittelalterliches Recht“ zu entgehen, stellt A. Wolf primär auf eine formale Begrifflichkeit ab und versteht Gesetz als „allgemeine Rechtsnorm in Urkundenform“. Bezogen auf das Frühmittelalter kann dann zum Beispiel diskutiert werden, ob den Kapitularien „Gesetzesqualität“ zukommt, für die eine „gewisse formale wie materielle […] Ähnlichkeit […] mit Herrscherdiplomen behauptet wird“ (R. Schneider). Doch sind einige Fragezeichen anzubringen. Nach der berühmten Definition von F. Ganshof waren Kapitularien „Erlasse der Staatsgewalt, deren Texte gemeinhin in Artikel gegliedert waren, und deren sich mehrere karolingische Herrscher bedient haben, um Maßnahmen der Gesetzgebung oder der Verwaltung bekanntzugeben“. An dieser Definition ist allerdings nur die Einteilung in Kapitel unumstritten; ansonsten gilt das Diktum H. Mordeks, daß auf dem Feld der Kapitularienforschung nichts so unumstritten sei wie die Divergenz der Meinungen. Für die Eingliederung in die von Wolf gebotene Definition von Gesetz ist die Frage der Schriftlichkeit von Kapitularien essentiell. Wurde lange Zeit in der Forschung im verbum regis das entscheidende Moment für den Geltungsgrund gesehen, so betont R. Schneider die Forcierung von Schriftlichkeit mit einer damit auch verbundenen rechtlichen Bedeutung.
Unübersehbar wird mit dem Arbeitsbegriff Wolfs der Übergang von mündlich festgelegten Rechtsnormen zu schriftlich beurkundeter kontinuierlicher Gesetzgebung im allgemeinen Kontext der Intensivierung „pragmatischer Schriftlichkeit“ (H. Keller) seit dem Hochmittelalter erfaßt. Vor diesem Zeitraum besaßen Reichsitalien und England eine ungebrochene gesetzgeberische Tradition. Im Liber legis langobardorum aus dem 11. Jahrhundert wurden zum Beispiel Gesetze der langobardischen Könige seit Rothari († 652) bis zum Jahre 1052 in chronologischer Reihenfolge aneinandergereiht. Die Überlieferung in England setzt mit der Aufzeichnung von Gesetzen seiner Vorgänger durch Alfred den Großen (871–901) ein.
Aus dem Blickwinkel des Zustandekommens und damit zusammenhängend des Geltungsanspruches unterscheidet Wolf drei Formen: Neben Befehlen eines Herrschers allein, vor allem im Kontext der Beanspruchung des Gesetzgebungsrechts der römischen Kaiser (z.B. Liber Augustalis Friedrichs II. 1231), und Beschlüssen von Ständen allein (vor allem während Thronvakanzen oder Abwesenheit des Königs, zum Beispiel Wormser Statuten des Rheinischen Bundes 1254) ist der Normalfall der Gesetzgebung die Übereinkunft zwischen Herrscher und Optimaten (Ständen). Consilium im Sinne von consensus oder assensus der meliores et maiores charakterisiert die Gesetzgebungstätigkeit des Spätmittelalters. Für diese notwendige Konsensbildung von Herrscher und bevorrechteten Adelspersonen wurde von den Kanonisten durch Neuinterpretation eines Satzes aus dem römischen Vormundschaftsrechts eine Rechtsgrundlage geschaffen, die seit dem 13. Jahrhundert im weltlichen Recht nachzuweisen ist: „Was alle [in ähnlicher Weise] angeht, muß von allen bewilligt werden“ (Quod omnes [similiter] tangit, ab omnibus comprobetur; C 5.59.5.2). Dabei konnten auch „Mischformen“ auftreten. So ist der Reichslandfriede Kaiser Friedrichs I. von Aachen und Köln (1152) als reiner Herrscherbefehl, sein Nürnberger Reichslandsfriede von 1186 de coniventia et consilio principum erhalten. Unter dem Gesichtspunkt der Form sind Einzelgesetze und Gesetzbücher (Codices) zu unterscheiden. Eine Zusammenfassung gesetzgeberischer Tätigkeit in einer Kodifikation wurde im Mittelalter nur in einem Teil der europäischen Länder erreicht. Die erste Kodifikationswelle setzt im 13. Jahrhundert ein, die zweite um die Mitte des 14. Jahrhunderts, eine dritte, die eine Reihe von systematischen Statutensammlungen, die als Ganzes die gesetzliche Sanktion erhielten, hervorbrachte, ging im 15. Jahrhundert über Europa hinweg.
HERBERT KALB