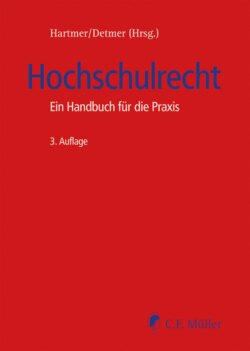Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Die Lernfreiheit der Studierenden
Оглавление97
Die Lehrfreiheit findet in der Lernfreiheit der Studierenden ihr notwendiges Korrelat.[16] Wissenschaftliche Lehre setzt voraus, dass die Lernenden genau so frei sind wie die Lehrenden. Nur so ist der wissenschaftliche Kommunikationsprozess möglich, den Art. 5 Abs. 3 GG im Blick hat. Eine Konzeption, die den Lehrenden zwar als Träger von Wissenschaftsfreiheit, den Lernenden aber nur als Nutzer oder Kunden betrachtet, der von seiner Berufsfreiheit Gebrauch macht, verkennt, dass in der wissenschaftlichen Lehre der Lehrende immer auch Lernender und der Lernende in gewisser Weise immer auch Lehrender ist. Die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden wird auch und gerade in der gemeinschaftlichen Inhaberschaft der Lehr- bzw. Lernfreiheit des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG deutlich.
98
Die Lernfreiheit umschließt das individuelle Recht, das Studium im Rahmen der einschlägigen Studienordnung eigenverantwortlich zu organisieren, Wahlmöglichkeiten zu nutzen und Prüfungszeitpunkte zu bestimmen. Zur Lernfreiheit gehört auch das Recht, eigene Meinungen im Zusammenhang der wissenschaftlichen Lehre zu bilden und Kritik zu äußern. Ein grundrechtlich geschütztes Recht, anonym Kritik zu üben, und sei es auch in Form von sog. Lehrevaluationen, gibt es, ungeachtet des Nutzens solcher Verfahren, nicht. Das Recht, kraft eigener Entscheidung und im Rahmen der Studienordnung den universitären Lehrveranstaltungen fern zu bleiben und den Prüfungsstoff auf andere Weise zu verinnerlichen, ist ebenfalls durch die Lernfreiheit der Studierenden geschützt. Präsenzpflichten sind – rechtfertigungsbedürftige und -fähige – Eingriffe in die Lernfreiheit. Im Ergebnis hängt die rechtliche Beurteilung von Präsenzpflichten ganz vom Charakter der in Rede stehenden konkreten Lehrveranstaltung ab: Bei Exkursionen, Laborübungen und Seminaren wird eine Präsenzpflicht zulässigerweise bestehen, bei Vorlesungen eher nicht.
99
Die im nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz verankerte obligatorische „Studierendenschaft“ mit weit ausgreifendem hochschulpolitischem Mandat kann nicht auf eine grundrechtliche Fundierung zurückgreifen.[17] Die Studierfreiheit oder Lernfreiheit verlangt keineswegs nach der Einrichtung einer solchen beitragspflichtigen Zwangskörperschaft. Der Studierendenschaft selbst ist es verwehrt, unter Berufung auf die Studierfreiheit den gesetzlich definierten Aufgabenkreis in Richtung eines allgemeinen politischen Mandats zu erweitern. Gegen Aufgabenüberschreitungen kann sich das einzelne Zwangsmitglied verwaltungsprozessual zur Wehr setzen, wobei die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab bildet.[18]
1. Kapitel Grundfragen des institutionellen Hochschulrechts › III. Freiheit der Lehre › 4. Die Zulassung zum Studium