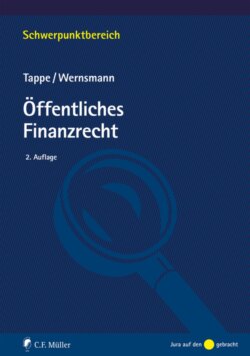Читать книгу Öffentliches Finanzrecht - Henning Tappe - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen (Art. 104b GG)
Оглавление156
Art. 104b GG ermöglicht dem Bund unter bestimmten Voraussetzungen die Gewährung von Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und der Gemeinden. Die Regelung verfolgt zwei Ziele: Einerseits soll sie notwendige Investitionen fördern und ermöglichen, andererseits sollen externe Effekte (Vorteile für andere Bundesländer und den Gesamtstaat), die mit Investitionen einzelner Länder einhergehen, ausgeglichen werden[68]. Ebenso wie Art. 104a Abs. 3 GG ermöglicht die Vorschrift eine Mitfinanzierung von Landesaufgaben durch den Bund. Sie hat aber nicht die Finanzierung von Geldleistungsgesetzen zum Gegenstand, sondern zielt auf die Finanzierung konkreter Projekte[69].
157
Eingeführt wurde Art. 104b GG im Zuge der Föderalismusreform I als Folgeregelung zu Art. 104a Abs. 4 GG aF. Im Gegensatz zur Vorgängerregelung ermöglicht die Vorschrift Finanzhilfen grds nur noch in Bereichen, in denen dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse zustehen (Rn 166). Dadurch werden die Einflussmöglichkeiten des Bundes eingeschränkt, und das Konkurrenzverhältnis zum Finanzausgleich wird zumindest abgemildert. Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 GG) setzt die Gewährung von Finanzhilfen iSd Abs. 1 Satz 1 damit auch das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG voraus.
158
Die Mittelgewährung über Art. 104b GG ist von der Einnahmeverteilung im Länderfinanzausgleich (Art. 106, 107 GG) zu unterscheiden. Abgrenzungskriterium ist die Zweckbindung der gewährten Finanzmittel im Rahmen des Art. 104b GG. Diese werden nicht – wie zB Bundesergänzungszuweisungen (Rn 393) – zur Verbesserung der allgemeinen Finanzsituation, sondern zur Erledigung konkreter Aufgaben gewährt. Folglich handelt es sich bei Art. 104b GG um eine dem Finanzausgleich vorgeschaltete Lastenverteilungsregel[70].
159
Förderungsfähig sind nur besonders bedeutsame Investitionen, die zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Nr 1), zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet (Nr 2) oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums (Nr 3) erforderlich sind. Außerhalb dieser Förderungsziele und der in Art. 104c, 104d GG geregelten Sondertatbestände (Rn 172 ff) ist eine Einflussnahme des Bundes auf die Aufgabenerfüllung durch die Länder über die Gewährung von Zuschüssen bzw Finanzhilfen nicht zulässig.
160
Finanzhilfen des Bundes sind damit kein Instrument zur Durchsetzung allgemeiner wirtschafts-, währungs-, raumordnungs- oder strukturpolitischer Ziele des Bundes in den Ländern[71]. Das Merkmal der besonderen Bedeutsamkeit verlangt, dass die Investition „in Ausmaß und Wirkung besonderes Gewicht“[72] hat. Investitionsvorhaben müssen damit erstens einen erheblichen finanziellen Umfang haben, in der Investitionspolitik eines Landes also einen besonderen Rang einnehmen, und zweitens überregionale, gesamtwirtschaftliche Effekte auslösen[73].
161
Förderungsfähig sind nur Sach-, nicht aber Finanzinvestitionen[74], wie zB die Gewährung von Darlehen oder verlorenen Zuschüssen. Die Förderung darf folglich nicht auf bloße Konsumsteigerung ausgerichtet sein, sondern muss die Errichtung konkreter Vorhaben, die Wachstumseffekte auszulösen geeignet sind, zum Gegenstand haben.
162
Die Varianten des Art. 104b Abs. 1 Satz 1 GG lassen sich anhand der lokalen Ausrichtung und der Förderungsdauer unterscheiden: Zur Abwehr von Störungen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Nr 1) sind nur kurzzeitige Investitionen zulässig. Gemeint sind Maßnahmen zur Glättung von Konjunkturschwankungen. Diese dürfen aufgrund der kurzzeitigen Ausrichtung vom Ansatz her nicht über einen Konjunkturzyklus (s.a. Rn 429, 450) hinausreichen.
163
Investitionen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft (Nr 2) und zur Förderung des Wirtschaftswachstums (Nr 3) sind jeweils auf eine längerfristige Förderung ausgerichtet. Während die Nr 3 aber eine bundesweite Förderung ermöglicht, bezweckt die Nr 2 die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und lässt Differenzierungen zwischen den Bundesländern zu. Aufgrund des föderativen Gleichbehandlungsgebots sind allerdings nur sachlich gerechtfertigte Differenzierungen zulässig.
164
Insb bei Investitionen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet können sich Überschneidungen zur Gemeinschaftsaufgabe des Art. 91a Abs. 1 Nr 1 GG (Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) ergeben. Vereinzelt wird ein Wahlrecht des Bundes zwischen den Instrumenten befürwortet[75]. Aufgrund der weiterreichenden Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundes und der konkreten Vorgaben des Art. 91a Abs. 3 Satz 1 GG zu den Finanzierungsanteilen hat Art. 91a Abs. 1 Nr 1 GG als speziellere Vorschrift allerdings Vorrang. Finanzzuschüsse des Bundes sind daher auf Grundlage des Art. 104b Abs. 1 Nr 2 GG unzulässig, soweit der Anwendungsbereich des Art. 91a Abs. 1 Nr 1 GG eröffnet ist[76].
165
Auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse kann der Bund gem. Art. 104b Abs. 1 Satz 2 GG im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, finanzielle Unterstützung leisten.
166
Die Ausnahme von der Bindung an die Gesetzgebungskompetenz wurde erst im Zuge der Föderalismusreform II (2009) in Art. 104b GG aufgenommen[77] und bildet eine Parallele zu Art. 109 Abs. 3 Satz 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG (dazu Rn 456 ff). Damit soll sichergestellt werden, dass zur Bewältigung solcher Notsituationen erforderliche Programme zur Belebung der Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand mit Unterstützung des Bundes in allen Investitionsbereichen durchgeführt werden können[78]. Außergewöhnliche Notsituationen in diesem Sinne können unter anderem Unglücksfälle, menschliches Versagen oder terroristische Anschläge sein[79]. Vor allem auch die Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2007–2010 war nach der Vorstellung des Gesetzgebers eine solche Notsituation[80].
167
Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe in Art. 104b Abs. 1 GG gewährt dem Bund eine Einschätzungsprärogative auf Tatbestandsebene[81]. Auf der Rechtsfolgenseite steht dem Bund grds ein Ermessen zu, ob und in welchem Umfang Finanzhilfen geleistet werden sollen. Allerdings kann sich die Option des Bundes in bestimmten Situationen auch zu einer Hilfeleistungspflicht verdichten[82].
168
Eingeschränkt wird der mögliche Umfang der finanziellen Unterstützung durch den Begriff „Finanzhilfen“. Daraus folgt zum einen, dass der Bund die Unterstützung nicht aufdrängen kann, die Länder diese mithin ablehnen dürfen und die Gewährung der Hilfe nicht von Einvernehmens-, Zustimmungs- oder Genehmigungsvorbehalten oder auch Einspruchsrechten im Einzelfall abhängig gemacht werden darf[83]. Zum anderen können Hilfen nur unterstützender Natur sein. In der Folge darf der Bund immer nur einen Teil der Investitionskosten übernehmen[84].
169
Die nähere Ausgestaltung der Finanzhilfen kann gem. Art. 104b Abs. 2 Satz 1 GG durch zustimmungspflichtiges Bundesgesetz oder auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt werden. Dies bedeutet aber keine Ermächtigung zu Regelungen, die dem Bund Verwaltungsbefugnisse einräumen[85]. Die Gewährung ist zu befristen, degressiv, dh im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeiträgen, auszugestalten[86] und die Verwendung der Mittel in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen, Art. 104b Abs. 2 Sätze 5 und 6 GG. Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten, Art. 104b Abs. 3 GG[87].
170
Mit der Grundgesetzänderung vom Juli 2017[88] wurde die mit dem ursprünglichen Art. 104b GG angestrebte Entflechtung (Rn 157) teilweise zurückgenommen. In Art. 104b Abs. 2 Satz 2, 3 GG ist nunmehr vorgesehen, dass durch Bundesgesetz (bzw die Verwaltungsvereinbarung) auch Bestimmungen über die Ausgestaltung der jeweiligen Länderprogramme getroffen werden können. In Satz 4 wurden Kontrollmöglichkeiten des Bundes eingeführt, zur Gewährleistung der zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung danach Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Erhebungen bei allen Behörden durchführen.
171
Weil die Verwaltungsvereinbarung nur mit allen betroffenen Ländern zugleich abgeschlossen werden darf bzw das konkretisierende Bundesgesetz der Zustimmung des Bundesrates bedarf (Art. 104b Abs. 2 Satz 1 GG), haben die Länder bei der Frage, ob und was gefördert werden soll, gewisse Mitwirkungsrechte[89]. Auch die Festlegung der Kriterien zur Ausgestaltung der jeweiligen Länderprogramme muss im Einvernehmen mit den betroffenen Ländern erfolgen. In einem zweiten Schritt entscheiden die Länder dann über die konkrete Umsetzung. Diese zweistufige Vorgehensweise[90] trägt der Rechtsprechung des BVerfG Rechnung, nach der „die Entscheidung darüber, welches Investitionsvorhaben gefördert werden soll, allein dem betreffenden Land“ zusteht[91].