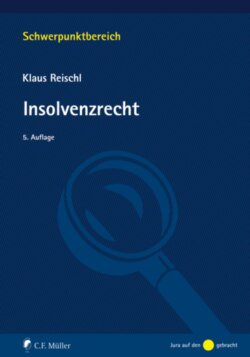Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Prüfungsvorgehen
Оглавление94
Zur Feststellung eines „Mangels an Geldmitteln“ sind die am maßgeblichen Stichtag (s Rn 104) verfügbaren Geldmittel mit den bestehenden und fälligen Verbindlichkeiten rechnerisch gegenüber zu stellen[4]; man spricht hier von einer Liquiditätsbilanz oder einem Liquiditätsstatus. Die Prüfung des Tatbestands der Illiquidität beginnt also mit der Erstellung eines auf den maßgeblichen Stichtag bezogenen (Stichtags-)Liquiditätsstatus. Ist dieser negativ, muss man zur abschließenden Feststellung der Zahlungsunfähigkeit aber eine Prognose anstellen und die weitere finanzielle Entwicklung über einen gewissen Zeitraum hinweg in die Prüfung einbeziehen, da sich die Vermögenslage eines aktiven Schuldners auch nach dem Stichtag verändert (s Rn 100).
95
In der Betriebswirtschaftslehre werden zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit auch andere Methoden angewandt (Zahlungsausfallrechnung, Bugwellenmethode), aber nur die Liquiditätsbilanz ermöglicht die Berücksichtigung neuer Verbindlichkeiten und ist verlässlich[5] (s Rn 100). Wird der (potenzielle) spätere Insolvenzverwalter in diesem Stadium vom Insolvenzgericht als Sachverständiger eingesetzt und mit der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit beauftragt (§§ 5 Abs. 1, 22 S. 2 Nr 3 InsO), wird er sich in seinem Gutachten an dem vom Fachausschuss Recht für Wirtschaftsprüfer verabschiedeten Prüfungsstandard (bisher IDW PS 800, jetzt IDW ES 11)[6] orientieren, der einschlägige Kriterien und Anweisungen zur Beurteilung eingetretener oder drohender Zahlungsunfähigkeit bei Unternehmen enthält. Danach muss man zur Prüfung, ob die Zahlungsunfähigkeit besteht oder zumindest droht, zunächst die Stichtags-Liquidität ermitteln und sodann hieraus einen (dynamischen bzw zeitraumbezogenen) Finanzplan entwickeln (IDW ES 11 Abschn. 4.4.1). Zahlungsunfähigkeit besteht, wenn dieser Finanzplan ergibt, dass die liquide Deckungslücke der angelaufenen Verbindlichkeiten am Ende eines dreiwöchigen Zeitraums (s Rn 104) zehn Prozent oder mehr beträgt, darunter handelt es sich um eine bloße Zahlungsstockung. Von diesen Parametern ist abzuweichen, wenn die Schließung der relevanten Deckungslücke mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit binnen der nächsten sechs Monate zu erwarten ist und den Gläubigern ein Zuwarten zumutbar ist. Im Falle einer dauerhaften Deckungslücke von unter zehn Prozent kommt es ebenfalls auf den Einzelfall an (s auch Rn 100). Wird erst in späterer Zukunft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine wesentliche nicht behebbare Liquiditätsunterdeckung auftreten, spricht man von lediglich drohender Zahlungsunfähigkeit.