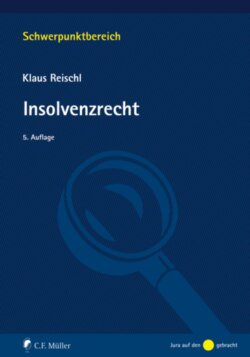Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Überschuldung
Оглавление116
Bei der Prüfung der Überschuldung im Sinne von § 19 InsO werden (anders als bei der Zahlungsunfähigkeit, Rn 94) nicht nur die liquiden Geldmittel und kurzfristigen Verbindlichkeiten betrachtet, sondern das Gesamtvermögen und alle Verbindlichkeiten. Die Überschuldung gilt gemäß § 19 Abs. 1 InsO als alternativer Insolvenzeröffnungstatbestand nur für juristische Personen, bei denen die Haftung für Verbindlichkeiten kraft Rechtsform auf das vorhandene (gewillkürte) Vermögen beschränkt ist; im Übrigen nur bei Nachlassinsolvenzverfahren, in denen naturgemäß kein Weiterwirtschaften mehr möglich ist (vgl § 320 InsO). Der Gesetzgeber hat die in § 19 InsO enthaltene Regelung als Korrelat zur Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen eingeführt[74], denn die Fortführung einer juristischen Person jenseits der Insolvenzreife erfolgt immer auf Kosten der (potenziellen) Gläubiger. Ziel der Überschuldungsprüfung ist demzufolge, nicht nur das liquide, sondern das tatsächlich vorhandene Schuldendeckungspotenzial zu ermitteln und (nach derzeitigem Recht) mit den Ertragschancen des Unternehmens in Bezug zu setzen, vgl § 19 Abs. 2 S. 1 InsO. Der Tatbestand bezweckt also den präventiven Schutz der Gläubiger des noch zahlungsfähigen Schuldners.
117
[Bild vergrößern]
118
In der Praxis bereitet die Aufstellung des Überschuldungstatbestandes erhebliche Schwierigkeiten, da er nicht einfach aus der handels- oder steuerrechtlichen Bilanz herausgelesen werden kann. Ein bilanzieller Jahresfehlbetrag hat nicht zwingend die insolvenzrechtliche Überschuldung zur Folge, wenn die Bilanz nach HGB-Maßstäben aufgestellt wurde, da diese weder die sog. stillen Reserven (Verkehrswert zB von Grundstücken ist höher als Bilanzwert) noch die tatsächlichen Marktverhältnisse berücksichtigt. Vorsicht ist jedoch geboten bei folgenden Krisenindikatoren, die eine Prüfung des Überschuldungsstatus indizieren: drohende Zahlungsunfähigkeit, bilanzieller Jahresfehlbetrag, Aufzehrung des Eigenkapitals zu mehr als 50%, außerordentliche Verluste, Kreditkündigungen[75]. Es ist darauf zu verweisen, dass der Überschuldungsbegriff für das Insolvenzverfahren selbst eine untergeordnete Rolle spielt, hier dominiert das Zahlungsunfähigkeitskriterium. Relevant ist die Überschuldung aber für persönliche Schadensersatzansprüche und die strafrechtliche Verantwortlichkeit der antragspflichtigen Organe gemäß §§ 823 Abs. 2 BGB, 15a InsO sowie § 64 GmbHG[76]. Seit der Entfristung der zunächst nur bis 31.12.2013 vorgesehenen (jetzigen) Fassung des § 19 InsO ist die Bedeutung weiter gesunken, denn die „Prädominanz der Prognose“[77] lässt die Überschuldung auch weiterhin meistens entfallen.
§ 3 Die Begründetheit des Insolvenzantrags › III. Überschuldung › 1. Definition der Überschuldung