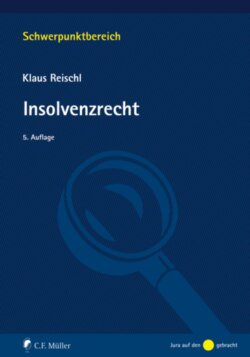Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Erstellung eines Liquiditätsstatus
Оглавление96
Zunächst erstellt man einen aktuellen Liquiditätsstatus, also eine stichtagbezogene Bestandsaufnahme der derzeit liquide verfügbaren Aktiva und der fälligen Passiva. Dazu ermittelt man das tagesaktuell zur Verfügung stehende Finanzmittelpotenzial (zB Bankguthaben, abrufbare Kreditlinien, Kassenbestand, zugesagte und realisierbare Einlagen) und stellt diese den objektiv bestehenden, fälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten gegenüber. Diese Daten lassen sich dem schuldnerischen Rechnungswesen entnehmen, sofern dieses (noch) vorhanden und geordnet ist. Dabei sind aber realistische Korrekturen vorzunehmen, denn nicht jede eingebuchte eigene Forderung ist tatsächlich durchsetzbar und nicht jede eingebuchte Verbindlichkeit besteht tatsächlich in Höhe des Nennbetrags; insoweit ist also eine überschlägige rechtliche Bewertung indiziert und auf die Wahrscheinlichkeit der Einbringlichkeit bzw Inanspruchnahme abzustellen, gegebenenfalls ist mit prozentualen Ansätzen zu operieren[7]. Bei den aktiven Finanzmitteln kommt es nur auf deren realistischen Zufluss und auch nicht darauf an, ob sich der Schuldner die Zahlungsmittel auf redliche oder unredliche Weise beschafft hat, so dass selbst aus Straftaten bzw Delikten (zB Kapitalanlagebetrug) herrührende Mittel als liquide Mittel anzusetzen sind[8].
97
Der Betrachtungszeitraum der sich an den Liquiditätsstatus anschließenden Liquiditätsprüfung (Rn 100) wird vom Verfahrenszweck der Insolvenzordnung (§ 1 InsO) geprägt. Auf der einen Seite müssen die Gläubiger zwar davor geschützt werden, an einen Schuldner Vorleistungen zu erbringen, bei dem absehbar ist, dass er diese nicht mehr bezahlen kann. Andererseits dürfen dem Schuldner die weitereichenden Sanktionen der Insolvenzeröffnung nicht auferlegt werden, wenn seine Verbindlichkeiten zwar nominal die Zahlungsmittel übersteigen, aber im Betrachtungszeitraum gar nicht bezahlt werden müssen, oder wenn der Schuldner in absehbarer Zeit wieder ausreichend liquide wird. Es muss also verhindert werden, dass das Insolvenzverfahren mit seinen einschneidenden Konsequenzen für den Schuldner bereits bei bloßer Zahlungsstockung eröffnet wird, die es in jedem Betrieb einmal geben kann. Andererseits ist eine dauerhafte Illiquidität nicht erforderlich, damit auch die Gläubiger kurzfristiger Verbindlichkeiten ausreichenden Schutz bekommen. S dazu unten Rn 104 ff.
98
Das Zahlungsunfähigkeitskriterium ist anhand des Verfahrenszwecks so auszulegen, dass sich für Schuldner und Gläubiger ein ausgewogenes Schutzsystem vor übereilter Verfahrenseröffnung ergibt. Auch der BGH hat in seiner Grundsatzentscheidung aus dem Jahre 2005 auf den Zweck des § 17 InsO abgestellt, nämlich den richtigen Zeitpunkt für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu finden. Dieser gebietet einerseits die Berücksichtigung auch solcher Gläubiger, die den Schuldner zur Zahlung aufgefordert, dann aber weitere Bemühungen eingestellt haben, ohne damit ihr rechtliches Einverständnis zum Ausdruck zu bringen, dass der Schuldner seine Verbindlichkeit vorerst nicht erfüllt. Andererseits dürfe man die Forderung eines Gläubigers, der mit der späteren oder nachrangigen Befriedigung im Sinne eines Stillhaltens einverstanden ist, nicht berücksichtigen, auch wenn keine entsprechende Vereinbarung getroffen worden ist[9].
Bezüglich der Passivierung von Verbindlichkeiten sind daher Besonderheiten zu beachten. Wurden Forderungen durch vertragliche Vereinbarungen gestundet (zB Ratenzahlung, Zahlungsaufschub), sind sie nicht in den Liquiditätsstatus einzustellen, da sie derzeit nicht fällig sind. Etwas anders gilt für erzwungene Stundungen, zum Beispiel wenn die Arbeitnehmer trotz rückständiger Löhne weiterarbeiten, ohne Zahlungsklage zu erheben[10]. Aber entsprechend den eingangs skizzierten Grundsätzen kann auch ein rein tatsächliches, also ohne rechtlichen Bindungswillen und ohne erkennbare Erklärung erfolgtes faktisches Stillhalten des Gläubigers die insolvenzrechtliche Zahlungspflicht im Sinne von § 17 Abs. 2 S. 1 InsO beseitigen. Um voreilige Verfahrenseröffnungen zu vermeiden, darf man vor allem nicht von der zivilrechtlichen Fälligkeit (§ 271 Abs. 1 BGB) schematisch auf die Zahlungspflicht im Sinne von § 17 Abs. 2 S. 1 InsO schließen[11]. Vielmehr muss man auch bei zivilrechtlich fälligen Forderungen im Einzelfall prüfen, ob eine Gläubigerhandlung zu erkennen ist, aus der sich der ernsthafte Wille ergibt, vom Schuldner die Erfüllung zu verlangen[12]; nur dann ist der Gläubiger schutzbedürftig. Zur Feststellung dieses Einforderungswillens gelten jedoch geringe Anforderungen. Die Zusendung einer Rechnung ist ausreichend[13], aber nicht erforderlich, vielmehr genügt beispielsweise eine einfache Zahlungsaufforderung, auch mündlich und ohne explizite Mahnung[14]. Ist die Fälligkeit kalendermäßig vereinbart (zB Darlehensrückzahlung), macht der dadurch eintretende Verzug eine weitere Zahlungsaufforderung des Schuldners ohnehin entbehrlich[15]. Ebenso reicht es aus, wenn der Schuldner selbst das Darlehen kündigt und damit fällig stellt sowie überdies die alsbaldige Rückzahlung ankündigt[16]. Ist eine Verbindlichkeit in der Buchhaltung des Schuldners enthalten, ist vom ernsthaften Einfordern des Gläubigers auszugehen[17]. Nicht ausreichend ist es aber, wenn eine Forderung zwar rechtlich besteht, aber weder in Rechnung gestellt noch eingefordert wird, es besteht dann ein faktisches Einverständnis mit dem Gläubiger[18] (sogleich Rn 99).
99
Lösung Fall 6 (Rn 87):
Der Insolvenzantrag wird im Fall 6 zur Verfahrenseröffnung führen, wenn er zulässig und begründet ist. Hier stellt sich die Frage der Begründetheit und gemäß § 16 InsO ist zu prüfen, ob S zahlungsunfähig im Sinne von § 17 InsO ist. Das setzt voraus, dass S nicht mehr in der Lage ist, binnen einer Frist von höchstens drei Wochen mindestens 90% seiner Zahlungspflichten zu erfüllen[19] (s Rn 106).
Die liquiden Aktiva des S belaufen sich auf € 25 000, denn er hat noch € 5000 in bar und weitere € 20 000 als offene Kreditlinie bei B. Fraglich ist, ob er damit alle fälligen Verbindlichkeiten im Sinne von § 17 Abs. 2 S. 1 InsO tilgen kann. Die Forderung der G ist zwar entstanden und fällig, aber es gibt zumindest das Einverständnis der G über die aktuelle Nichtzahlung (ohne dass eine rechtsverbindliche Stundungsvereinbarung erforderlich ist), denn G hat zu erkennen gegeben, dass sie nicht auf sofortige Bezahlung besteht. Diese Forderung wird also derzeit nicht ernsthaft eingefordert, so dass sie auf der Passivseite der Liquiditätsbilanz nicht anzusetzen ist (s Rn 98). Der Anspruch der B auf Rückzahlung der vereinbarten (unbefristeten und ungekündigten) Kontokorrentlinie entsteht erst mit Kündigung der Kontokorrentvereinbarung, er ist deshalb derzeit nicht zu berücksichtigen. Streitige bzw rechtshängige Forderungen sind liquiditätsmäßig nicht vor ihrer vorläufigen Vollstreckbarkeit zu passivieren; vorher sind sie zur Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit ungeeignet, denn die Fälligkeit im Sinne von § 17 InsO erfordert die rechtliche Durchsetzbarkeit der Forderung, also dass sie frei von Einreden und Einwendungen ist[20]. Ob die vorläufige Vollstreckbarkeit ausreicht, kann man durchaus bezweifeln. Auf der einen Seite ist die Prüfung der Forderung eine Sache des zuständigen Prozessgerichts. Auf der anderen Seite soll die Vollstreckbarkeit den Obsiegenden vor dem Vermögensverfall des Gegners schützen und der Schuldner könnte durch Berufungseinlegung seinen Liquiditätsstatus verbessern. Im Fall 6 ist die Forderung jedenfalls nicht anzusetzen, denn wer aus einem vorläufig vollstreckbaren Titel nicht vorgeht, zeigt keinen aktuellen Willen zur Geltendmachung der Forderung. Damit sind Verbindlichkeiten nur in Höhe von € 25 000 anzusetzen. Demnach ist im Fall 6 der Insolvenzantrag derzeit unbegründet und demzufolge (momentan) erfolglos.