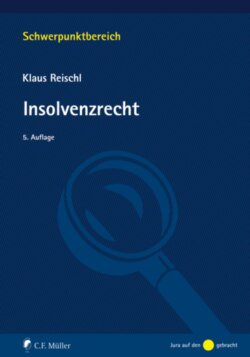Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Drohende Zahlungsunfähigkeit
Оглавление113
Die drohende Zahlungsunfähigkeit gilt als Insolvenzeröffnungsgrund allein für den Schuldner, § 18 Abs. 1 InsO. Sie hat überwiegend Optionscharakter[65], denn der Schuldner, bei dem sich die zukünftige Insolvenz abzeichnet, kann sich unter den Schirm des § 270b InsO begeben; dort ist eine Abgrenzung zur bereits bestehenden Zahlungsunfähigkeit unerlässlich, § 270b Abs. 1 InsO. Durch Stellung eines Insolvenzantrags wegen drohender Zahlungsunfähigkeit kann sich der frühzeitig die Krise erkennende Schuldner damit unter den Schutz des gerichtlichen Verfahrens begeben, ohne die Strafsanktionen des § 15a InsO befürchten zu müssen. Allerdings ist bereits in diesem Stadium die Strafbarkeit gem. §§ 283 ff StGB zu beachten, so dass vor allem von einer übertragenden Sanierung durch den Schuldner selbst abzuraten ist[66]. Probleme bereitet die drohende Zahlungsunfähigkeit jedoch im Anfechtungsrecht, denn bei § 133 InsO stellt sie nach hM ein starkes Beweisanzeichen für den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners sowie eine gesetzliche Vermutung auf Gläubigerseite dar (§ 133 Abs. 1 S. 2 InsO), s Rn 679.
114
Anders als bei der Feststellung der aktuellen Zahlungsunfähigkeit, ist der Betrachtungszeitraum der Liquiditätsbilanz zur Prüfung der drohenden Zahlungsunfähigkeit auf längerfristige Zeiträume zu erstrecken, er enthält (auch nach Meinung des BGH) eine Prognose des künftigen Eintritts einer Zahlungsunfähigkeit[67]. Dabei kann man sich grundsätzlich an der längsten Laufzeit der aktuellen und künftig fälligen Verbindlichkeiten orientieren, hat aber zu bedenken, dass eine Prognose über mehr als zwei bis drei Jahre kaum mehr verlässlich getroffen werden kann[68]. Es empfiehlt sich daher eine Beschränkung auf das laufende und das nächste Geschäftsjahr, mehr kann man von einer Finanzplanung nicht erwarten[69]; bei kürzeren Laufzeiten von Verbindlichkeiten ist der Zeitraum entsprechend zu verkürzen. Grundlage der Prognose bilden die aktuellen und geplanten betrieblichen Abläufe, die über den Betrachtungszeitraum möglichst realistisch fortzuschreiben sind. Folglich sind auch künftig entstehende Verbindlichkeiten einzustellen, falls deren Begründung zwar nicht sicher, aber überwiegend wahrscheinlich oder absehbar ist[70].
Häufig zeichnen sich künftige Verbindlichkeiten bereits frühzeitig ab, beispielsweise bei Zugang oder Vorankündigung einer schriftlichen Kündigung von Bankdarlehen zu einem späteren Zeitpunkt; regelmäßige Zahlungen für Löhne, Mieten, Versorgung usw. sind ebenfalls lange vorher bekannt. Demgegenüber passiviert die hM mit Verweis auf den Wortlaut von § 18 Abs. 2 InsO nur die zum Prognosezeitpunkt bereits begründeten Verbindlichkeiten und fragt, ob diese von künftigen Finanzmitteln abgedeckt werden können[71]; man verzichtet also im Unterschied zur Prüfung des § 17 Abs. 2 InsO nur auf das Fälligkeitsmerkmal, bezieht aber zumindest künftige Verbindlichkeiten aus bereits begründeten Dauerschuldverhältnissen (Arbeitsverträge, Mietverträge) ein. Im Hinblick auf die Ausführungen zur Zahlungsunfähigkeit oben Rn 102 f sind aber auch hier alle zu erwartenden Verbindlichkeiten einzubeziehen, gegebenenfalls ist deren Wertansatz zu korrigieren.
115
Die Prognose muss gemäß § 18 Abs. 2 InsO ergeben, dass der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit wahrscheinlicher ist als deren Vermeidung[72]. Eine zur Annahme drohender Zahlungsunfähigkeit ausreichende Gefährdung der Interessen der Gläubiger besteht rechnerisch ab einer Eintrittswahrscheinlichkeit von über 50%[73], wobei man zu dieser Zahl wiederum nur mittels vager Prognosen kommen kann. Es ist zwar zu berücksichtigen, dass ein hierauf gestützter Eröffnungsantrag nach § 18 InsO immer vom Schuldner kommt und die Beweisanzeichen ausgeräumt werden können; insoweit ist es ausreichend, wenn die Angaben plausibel sind und das Verfahren nicht missbräuchlich instrumentalisiert werden soll. Ein strengerer Maßstab muss jedoch gelten, wenn die drohende Zahlungsunfähigkeit als Beweisanzeichen im Rahmen eines Anfechtungsprozesses nach § 133 InsO (s Rn 679) herangezogen wird.
§ 3 Die Begründetheit des Insolvenzantrags › III. Überschuldung