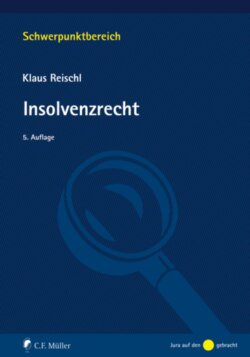Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
d) Fortbestehensprognose
Оглавление123
Da zur Begründung der Überschuldung die Resultate der Prüfung beider Merkmale kumulativ betrachtet werden müssen, beginnt man zweckmäßigerweise mit der Prüfung der unternehmerischen Fortführungsaussichten. Die insolvenzrechtliche Fortführungsprognose, zur Abgrenzung von der handelsrechtlichen Fortführungsprognose aus § 252 Abs. 1 Nr 2 HGB gerne auch „Fortbestehensprognose“ genannt[85], beinhaltet inhaltlich im Wesentlichen die Zahlungsfähigkeitsprognose[86], deren Basis wiederum der qualifizierte Liquiditätsplan als sachgerechte und justiziable Ertrags- und Finanzplanung ist (vgl Rn 102). Da ein Insolvenztatbestand vorrangig die Aufgabe hat, der Gefährdung der Gläubigeransprüche vorzubeugen, kann die Fortführung nämlich allenfalls dann als wahrscheinlich (zumindest wahrscheinlicher als eine Stilllegung) angesehen werden, wenn die künftig zu erwartenden Zahlungen bedient werden können. Für die Erstellung dieser Prognose gibt es zwar keine besonderen Formvorschriften (s aber § 270b InsO); damit sich der Schuldner aber später gegen Insolvenzverwalter und Staatsanwalt verteidigen kann, sollte er die Ergebnisse entsprechend dokumentieren.
124
Gegenüber der Zahlungsfähigkeitsprüfung ist jedoch der Betrachtungszeitraum erheblich zu erweitern, da es nicht mehr um die aktuelle, sondern um die längerfristige Liquidität geht. Auszugehen ist zwar von der Fälligkeit aller bestehenden Verbindlichkeiten, aber aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die Prognose (nur) den Zeitraum umfassen, für den die Erstellung einer betriebswirtschaftlich belastbaren Kalkulation möglich ist. Dementsprechend ist der Prognosezeitraum regelmäßig auf das aktuelle und das nachfolgende Geschäftsjahr zu beziehen[87], vorbehaltlich branchenspezifischer Besonderheiten[88]. Ergibt sich jedenfalls nach Ablauf dieses Zeitraums ein Überschuss, dann ist die Zahlungsfähigkeit als Grundlage der Betriebsfortführung gegeben. Die Feststellung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit (s Rn 113) lässt also die Fortbestehensprognose negativ ausfallen, weil man davon ausgehen kann, dass dann ein Insolvenzverfahren zu eröffnen sein wird.
125
Neben den finanziellen sind auch die betrieblichen Umstände zu berücksichtigen, die einer Betriebsfortführung entgegenstehen können. Ohne Fortführungswillen auf Seiten der Gesellschafter und der Geschäftsführung, bei Engpässen bei der Beschaffung von Rohstoffen und bei Abwanderung von zentralen Kunden ist die Fortführung genauso unmöglich wie bei bereits erfolgter Kündigung der Geschäftsräume. Zusätzlich zum Finanzplan muss also ein plausibles und tragfähiges Unternehmenskonzept erstellt werden[89]. Solche Faktoren sind zwar gegenüber den finanziellen untergeordnet, sie können aber im Rahmen der Gesamtwertung zu einem negativen Ergebnis führen[90].
126
Die Fortführung muss nach dem Gesetzeswortlaut zumindest überwiegend wahrscheinlich sein. Da der Schwerpunkt der Prognose auf den finanziellen Umständen liegt, kann man die Wahrscheinlichkeit bejahen, wenn in dem betrachteten (Zwei-) Jahreszeitraum ein Liquiditätsüberschuss zu erwarten ist, oder, um es in betriebswirtschaftlicher Terminologie auszudrücken, wenn der Finanzplanüberschuss als Netto-Cash-Flow positiv ist[91]. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass die Prognose trotz defizitärer Liquidität im ersten Jahr gegeben ist, wenn diese mit Überschüssen aus dem zweiten Jahr ausgeglichen werden kann. Fällt die Prognose positiv aus, erübrigt sich die nachfolgend beschriebene Ermittlung der bilanziellen Situation. Ist die Liquiditätssituation nicht positiv gesichert, kann hingegen auch eine positive Einschätzung der künftigen Ertragslage nicht zu einer positiven Prognose führen[92].