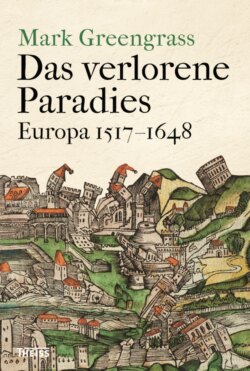Читать книгу Das verlorene Paradies - Mark Greengrass - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inflation und Münzentwertung
ОглавлениеDie Inflation gehörte im 16. und frühen 17. Jahrhundert zum Leben. Der Durchschnittspreis für ein setier (einen Sack Getreide mit einem Inhalt von zwölf Scheffeln, was circa 436 Litern entspricht) Weizen von bester Qualität kostete im Jahr 1500 auf dem Pariser Markt etwas mehr als ein livre. Von da an stieg der Preis beständig: 1550 waren es 4,15 livres, 1600 dann 8,65, und 1650 lag der Preis bei 18 livres. Aufs Jahr gerechnet war der Anstieg moderat. Insgesamt gesehen war es die bis dahin längste Inflationsperiode überhaupt – ein Phänomen, das die christlichen Vorstellungen von Wohlstand und gerechtem Lohn infrage stellte.
Im 16. Jahrhundert fand eine lebhafte Diskussion über die Ursachen der Teuerung statt. Manche Kommentatoren machten die wachsenden Geldbestände für die Preiserhöhungen verantwortlich, konnten sich aber die Beziehung zwischen Geldmenge und -wert nicht recht erklären. Der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus beschäftigte sich ausführlich mit den Auswirkungen der Münzentwertung im Land und stellte in einem Gutachten über die preußische Münze fest: „Es kann ouch die Müncze in vorachtunge kommenn aus derselbige unmesigen fylheit.“ Francisco López de Gómara mutmaßte in seiner Historía general de las Indias (Geschichte der Westindischen Inseln, 1552), die steigenden Preise in Amerika seien dadurch zu erklären, dass „der Reichtum der Inkas in spanische Hände geriet“. Martín de Azpilcueta (mit dem Beinamen „Navarrus“, weil er aus Navarra in den Westpyrenäen stammte), ein berühmter Professor und Vertreter der Scholastik an der Universität Salamanca, verallgemeinerte Gómaras Sichtweise in seiner Abhandlung über Wechsel- und Wuchergeschäfte (Comentario resolutorio de cambios, 1556): „Ceteris paribus sind in Ländern, wo große Geldknappheit herrscht, alle anderen verkäuflichen Güter und sogar die menschlichen Arbeitskräfte für sehr viel weniger Geld erhältlich als dort, wo es im Überfluss vorhanden ist.“ Das Problem, wie er und seine Kollegen, die an der Universität Naturrecht und Moraltheologie lehrten, es sahen, bestand darin, diese Marktkräfte mit den Imperativen sozialer Gerechtigkeit, fairer Preise und dem Schutz der Interessen der Armen in Einklang zu bringen.
Wurde die Inflation durch die Silberimporte aus der Neuen Welt verursacht? Die Verbindung zwischen Preiserhöhungen und Importen ist nicht so eng wie vormals angenommen. Die Inflation begann im 16. Jahrhundert bereits, bevor die Importe überhaupt einsetzten, und die lückenhaften Quellenbelege nach 1600 lassen die Verbindung später als instabil erscheinen. Das widerlegt allerdings nicht die allgemeinere, von soliden ökonomischen Theorien gestützte Annahme, dass die Inflation sehr viel mit den Veränderungen in der Geldmenge zu tun hatte. Die entscheidende Frage lautet nun: Warum führten diese Veränderungen zu einer allmählichen und nicht etwa zu einer galoppierenden Inflation? Wir können hier nur feststellen, dass es glückliche Umstände gab, dank derer ein bedeutender Anteil der Edelmetallgewinne abgezweigt wurde, um den Handel mit Russland und dem Fernen Osten anzuheizen. Ohne diese Sicherheitsventile wäre es mit Europas „silbernem Zeitalter“ schnell zu Ende gegangen.
Dass die europäischen Herrscher diese Mechanismen nicht verstanden, ist anhand der diversen Münzentwertungen zu erkennen, die sie selbst vornahmen, auch um die Geldmenge zu beeinflussen. Eine solche Maßnahme zielte darauf ab, das Gewicht einer Münze oder ihren Gehalt an Edelmetall zu verringern, um so die Anzahl der Münzen mit einem bestimmten Nennwert, die aus einer gegebenen Menge Edelmetall hergestellt werden konnten, zu vermehren. Die Operation war so verlockend, dass sie in regelmäßigen Abständen durchgeführt wurde. Die habsburgische Verwaltung in Burgund verschlechterte die Silbermünzen in puncto Feingehalt und Gewicht zwischen 1521 und 1644 zwölfmal. Die englischen Münzen verloren zwischen circa 1520 und 1650 mehr als 35 Prozent ihres Silbergehalts; am meisten in einem Jahrzehnt wirtschaftlichen Wahnsinns, das zum Ende der Regierungszeit Heinrichs VIII. begann und als „Great Debasement“ (1544–1553) bekannt wurde. In Frankreich führten wiederholte Verschlechterungen dazu, dass die vorherrschende Silbermünze (der écu blanc) um 1650 weniger als die Hälfte des Silbergehalts besaß als ihr Vorgänger 1488. In den deutschen Territorien nutzten die Münzbetreiber ihre Konzession, um das Geld zu verschlechtern, was zur sogenannten Kipper- und Wipperzeit führte. In der Bevölkerung machte sich Hass auf die „Fälscher“ und „Betrüger“ breit, die ihrer Meinung nach hinter der Verschlechterung steckten. Die ganze Periode wurde allgemein als Omen für das nahende Zeitenende verstanden. Selbst die spanische Krone, die im 16. Jahrhundert von Verschlechterung noch Abstand nahm, führte 1607 bei geringwertigen Münzen eine besonders katastrophale Operation durch.
Der Münzentwertung war eine eigene Fachdebatte gewidmet. Der englische Autor Sir Thomas Smith sah in seiner Schrift De republica Anglorum (Über den Staat der Engländer; veröffentlicht 1583, geschrieben aber früher) die Verschlechterung als Betrug seitens der Fürsten. Auf der anderen Seite des Kanals vertrat Jean Cherruyer (oder Cherruyl), Seigneur de Malestroit, ein Geldspezialist der französischen Krone, 1566 die Auffassung, dass die Inflation wegen der wiederholten Münzentwertung eher imaginär als real sei. Es sei ein „Paradox“, dass die Waren sich verteuert hätten. Vielmehr könne mit derselben Menge Silber, dank der Wirkung der Münzentwertung, weiterhin dieselbe Menge an Getreide erworben werden. Zwei Jahre später fand er seinen Meister in dem aufstrebenden Juristen Jean Bodin. Seine Antwort auf Malestroits „Paradox“ berief sich auf empirische Beweise, um gegen Malestroit zu zeigen, dass es tatsächlich eine umfassende Inflation gegeben habe. Zumindest in der zweiten Auflage seines Buches neigte Bodin zu der Ansicht, dass dies das Ergebnis der Silberimporte aus Amerika gewesen sei. In jedem Fall hielt er es für ein Zeichen von Tyrannei, wenn Fürsten auf Kosten des Gemeinwohls Währungen manipulierten. Besser wäre es, wenn die Münzen jeweils das an Edelmetallgehalt enthielten, was die Prägung besagte. Bodin erkannte, dass es zwischen Münze und guter Regierung einen fundamentalen Zusammenhang gab, auch wenn schon zu seinen Lebzeiten die Werte eines Gemeinwesens der härteren und stärker autoritären Tonart des Gehorsams gegenüber dem absoluten Willen eines Fürsten weichen mussten.
Im 17. Jahrhundert wurde Reichtum an Edelmetallen als so etwas wie ein Giftkelch betrachtet. „Kolumbus hat einem von euren Königen Gold angeboten“, schrieb der englische politische Denker James Harrington, „doch weil dieser glücklicherweise skeptisch war, trank ein anderer Fürst das Gift, selbst zum Verderben seines eigenen Volks.“ Es war Gott selbst, meinte der berühmte spanische Diplomat Diego de Saavedra Fajardo in seinen Empresas políticas (Politische Sinnsprüche, 1640), der die Edelmetalle tief im Erdboden versteckt hatte, damit nie mehr davon verwendet würde, als man zu Handelszwecken benötigte. Unbegrenzter Reichtum wie der aus den Minen von Mexiko und Peru war im Grunde nichts anderes als Katzengold (Eisenkies), aber „Wer hätte nun nicht meinen sollen“, spielte er auf eine berühmte Bemerkung von Justus Lipsius an, „daß das Gold der neuen Welt nicht auch noch mehrers sollte erlanget werden?“
In einer tieferen Schicht beinhaltete die Debatte um den Wert des Geldes noch eine andere Diskussion, die von Humanisten unter Berufung auf die antiken Denker geführt wurde. Dabei ging es um das richtige Verhältnis zwischen Geschäft (negotium) und einem Leben in Muße (otium). Aristoteles hatte gelehrt, dass der Erwerb von Reichtum zur guten Haushaltsführung gehöre, solange er zur Beschaffung von Lebensnotwendigem verwendet werde. Ansonsten verderbe Reichtum diejenigen, die ihn anhäuften. Andere, wie etwa der holländische Gelehrte Dirck Volckertszoon Coornhert, hielten dagegen, ein Kaufmann könne durchaus ein guter Christ sein, wenn er nämlich Reichtum erwerbe, um ihn für gute Zwecke zu verwenden. Im 17. Jahrhundert erhielt die Diskussion neue Akzente. In den 1630er- und 1640er-Jahren argumentierten französische Intellektuelle, amour propre (Eigenliebe) sei der eigentliche Antrieb für moralisches Verhalten: Freundschaft könne auf der Verfolgung gemeinsamer und doch eigennütziger Interessen beruhen, und die Jagd nach Reichtum um seiner selbst willen führe nicht in die Korruption, sondern liege im allgemeinen Interesse. Der holländische Jurist Hugo Grotius behauptete, das grundlegendste Gesetz der Natur sei das Recht auf Selbsterhaltung, und demzufolge sei das natürlichste Menschenrecht das Eigeninteresse. Es ist also, folgerte er, nicht notwendigerweise schlecht, das eigene Interesse, worunter auch der Erwerb persönlichen Reichtums falle, zu verfolgen. Solche Ideen gehörten zwar nicht zum Mainstream, zeigten aber, wie weit man sich in Europa um 1650 schon von jenem moralischen Konsens entfernt hatte, der am Vorabend der Reformation im Christentum geherrscht hatte.
Thomas Hobbes, der einige Zeit in Gesellschaft französischer Intellektueller verbracht hatte, veröffentlichte seinen Leviathan 1651. Der Titel bezog sich auf jenes in der Bibel erwähnte Meerungeheuer, das man sich als schreckenerregenden Wächter am Höllentor vorstellte. Bei Hobbes ist der „Levia-than“ ein moralisch neutraler Souverän, der über die menschlichen Individuen herrscht, die ihrerseits von ihren jeweiligen eigensüchtigen Wünschen und Begierden beherrscht werden. Diese aber sind, sagt Hobbes, an und für sich weder gut noch böse, „denn diese Worte … werden stets mit Beziehung auf die Person benutzt, die sie gebraucht; nichts ist nämlich einfach und absolut so“. Im Naturzustand hat jeder Mensch ein Recht auf alles, „sogar auf den Körper eines anderen“, was im Ergebnis einen Krieg aller gegen alle bedeute, in dem das Leben der Menschen „einsam, armselig, widerwärtig, vertiert und kurz“ sei. Für Hobbes ist es die kluge Vereinigung aller Eigeninteressen, welche die Macht des souveränen Herrschers schafft: Die Menschen kommen darin überein, einige ihrer Konkurrenztriebe aufzugeben, damit sich unter der Herrschaft von Recht und Gesetz eine zivile Gesellschaft bilden kann. Freilich behauptet Hobbes nirgendwo, dass das Streben nach Reichtum und Gewinn jenseits dessen, wozu der souveräne Herrscher es erklärte, an sich gut oder schlecht sei, weshalb die Zeitgenossen im Leviathan den Aufriss eines politischen Universums sahen, in dem der Fürst bestimmte, was moralisches Verhalten in der Gesellschaft war.