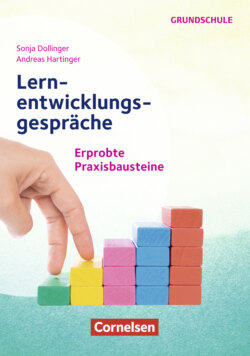| Ziele setzen |
| Ein Ziel ist „die für eine gerichtete Handlung oder das Ergebnis einer konkreten Leistung mögliche und notwendige Vorgabe eines Endzustands oder Endprodukts“ (Kleinbeck, 2019), oder anders ausgedrückt: Wer ein Ziel hat, richtet sein Verhalten planvoll auf etwas Wünschenswertes, in der Zukunft Liegendes aus, dessen Erreichung positiv erlebt wird (vgl. Brandstätter & Hennecke, 2018). Im schulischen Kontext lassen sich nach Dweck (vgl. zit. n. Brandstätter & Hennecke, 2018; Kleinbeck, 2006; Köller & Schiefele, 2010) vor allem zwei Arten von Zielen unterscheiden: Lernziele und Leistungs- bzw. Performanzziele. Erstere dienen dazu, neues Wissen oder Können zu erwerben und vorhandene Kompetenzen zu erweitern. Zweitere verfolgen den Zweck, die eigene Leistungsfähigkeit zu präsentieren bzw. das, was nicht gekonnt wird, zu verbergen. |
| Unabhängig von der Intention eines Ziels, lassen sich eine Reihe weiterer Dimensionen von Zielen ausmachen (vgl. zsfd. Brandstätter & Hennecke, 2018; Kleinbeck, 2006): Hierzu gehört beispielsweise der Wert eines Ziels für die jeweilige Person. Je höher dieser ist, desto attraktiver ist das Ziel. Eine weitere Dimension stellt die Zielschwierigkeit dar. Die Schwierigkeit ist solange leistungsförderlich, solange sie nicht überfordert. Darüber hinaus spielt auch die Spezifität von Zielen eine Rolle. Vor allem im Zusammenhang mit Zielen, die auf ein bestimmtes Ergebnis ausgelegt sind, gilt, dass spezifische Ziele zu besseren Leistungen führen als allgemeine. Des Weiteren wirkt sich eine feste Zielbindung positiv aus. Zudem lassen sich Ziele hinsichtlich der Zeitperspektive, des Bewusstheitsgrades sowie der Zielkomplexität unterscheiden. |
| Nun stellt sich die Frage, wie davon ausgehend Ziele zu formulieren sind, damit vor allem die leistungsförderlichen Dimensionen Berücksichtigung finden. Hier helfen die sogenannten S.M.A.R.T.-Kriterien (vgl. Doran, 1982), wonach Ziele spezifisch, messbar, aktivitätsorientiert, realistisch und terminiert (siehe Kap. 7.1) formuliert sein sollen. Durch die Messbarkeit wird die Möglichkeit der (Selbst-)Kontrolle gegeben, die Realisierbarkeit bezieht sich auf den Schwierigkeitsgrad. Die Aktivitätsorientierung soll verdeutlichen, dass das Ziel durch eigenes Handeln erreicht werden kann. |
| Vor allem bei der Arbeit mit Kindern kann es allerdings sinnvoll sein, das Ziel allgemein zu formulieren und dann eine dazu passende Maßnahme nach den S.M.A.R.T.-Kriterien zu fixieren (siehe Kap. 7.1). |
| Ebenso können zu einem allgemeinen Ziel sogenannte Wenn-Dann-Pläne formuliert werden, die sich in verschiedenen Untersuchungen als hilfreich bei der Zielerreichung erwiesen haben, da sie die Erfolgsquote erhöhen (vgl. zsfd. Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009). Solche Wenn-Dann-Pläne sind nach dem Muster „Wenn Situation X eintritt, dann will ich das Verhalten Y ausführen!“ (vgl. ebd., S. 211) formuliert. Allein durch das Eintreten der entsprechenden Situation wird dann automatisch die dazugehörige Handlung abgerufen, z. B. „Wenn mich jemand ärgert, dann hole ich mir Hilfe bei der Lehrkraft oder den Streitschlichtern.“ Doch auch hier gilt, dass Wenn-Dann-Pläne umso erfolgreicher sind, je mehr sich die jeweilige Person diesem Plan verpflichtet fühlt (vgl. ebd.). Vor allem bei Zielen bzw. Maßnahmen, die eine Verhaltensänderung im Sozialverhalten, bspw. im Umgang mit Konflikten, beabsichtigen, könnte dies eine gute Möglichkeit sein, da sich hier durch Wenn-Dann-Pläne im Gegensatz zu den S.M.A.R.T.-Kriterien leicht (und in einfacher Sprache) positive Formulierungen und zielführende Maßnahmen finden lassen (siehe Kap. 7). Das obige Beispiel könnte in der S.M.A.R.T.-Variante lauten: „Ich gehe zur Lehrkraft oder den Streitschlichtern, bevor ich zuschlage.“ Der Wenn-Dann-Plan setzt hier eine Stufe früher an, nämlich schon bei der auslösenden Situation, die für das sonstige Zuschlagen verantwortlich ist. Das zu ändernde negative Verhalten des Zuschlagens findet somit keinen Platz in der Zielvereinbarung. |
| Von Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Motivation im Zielerreichungsprozess bzw. im Hinblick auf das Verfolgen weiterer Ziele sind (qualitative) Rückmeldungen zu (Zwischen-)Ergebnissen, auch durch entsprechende Formen der Selbstkontrolle (vgl. Kleinbeck, 2006). Darüber hinaus ist auch bedeutsam, dass Ziele im „Gedächtnis aktiviert bleiben, auch wenn sich gerade keine Gelegenheit zum Handeln ergibt oder aber eine Handlungssequenz unterbrochen werden muss“ (Brandstätter & Hennecke, 2018, S. 333; auf Grundlage von Goschke & Kuhl, 1993). Dies spielt im schulischen Kontext eine besondere Rolle, da an vielen vereinbarten Zielen nicht zwingend täglich gearbeitet werden kann, z. B. wenn sich diese auf eine Verhaltensänderung in Konfliktsituationen beziehen. |