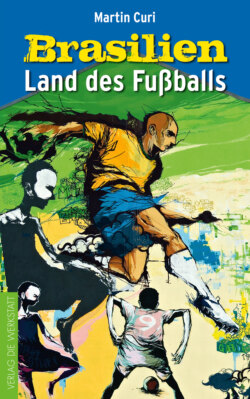Читать книгу Brasilien - Martin Curi - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1934: Streit um Profispieler
ОглавлениеVargas gilt als Gründer des modernen Brasiliens. Er strukturierte den Staatsapparat mit seinen Ministerien um, verabschiedete auf Druck der Industriearbeiter neue Sozialgesetze und erweiterte das Wahlrecht. Unter ihm wandelte sich Brasilien von einem Agrar- zu einem Industriestaat. Das hatte auch Konsequenzen für die Organisation des Fußballs, denn in Vargas Amtszeit fällt die gesetzliche Zulassung des Profifußballs im Jahr 1933 ebenso wie im Jahr 1941 die Bildung einer zentralen staatlichen Verwaltung des Sports durch die Gründung des Nationalen Sportbeirats.
Während der Weltmeisterschaft 1934 in Italien diskutierte man in Brasilien noch immer, ob Fußball nun ein Amateursport sei oder die Bezahlung der Spieler erlaubt werden solle. Obwohl am 23. Januar 1933 die Professionalisierung beschlossen worden war, hatten die alten Eliten noch einmal ihre Macht bewiesen und ein Amateurteam als Nationalmannschaft erzwungen. Es konnten zwar auch Profispieler nominiert werden, diese durften aber während der WM keinen Lohn erhalten. Weil sich die Arbeiterteams um das Wohl ihrer Spieler sorgten und diese den Einkommensausfall fürchteten, war kein Profi unter den WM-Spielern der Seleção. Einige Klubs sollen sogar ihre Spieler auf Fazendas im Hinterland versteckt haben – vermutlich, um eigenmächtige Abreisen der Spieler nach Italien zu verhindern.
Erneut konnte Brasilien also nur eine von Ausfällen gebeutelte Auswahl zur WM entsenden, und aufgrund des damaligen Regelwerks, das keine Gruppenphase, sondern nur K.-o.-Spiele vorsah, schied man nach nur einem Spiel (1:3 gegen Spanien) aus. Vargas beschloss daraufhin, in den Fußball zu investieren, um über ihn eine brasilianische Identität zu formen. Es war ihm wichtig, nationale Symbole zu stärken, um eine Einheit zu fördern.
War Brasilien vor Vargas Machtergreifung noch durch den tiefen Gegensatz zwischen weißer Elite und von ehemaligen Sklaven abstammenden schwarzen Arbeitern gekennzeichnet, so sollte dieser nun überwunden werden. Den intellektuellen Unterbau dafür lieferte der brasilianische Soziologe Gilberto Freyre, der in seinem 1933 veröffentlichten Buch „Herrenhaus und Sklavenhütte“ die Ansicht vertrat, dass die Präsenz der afrikanischstämmigen Bevölkerung nicht mehr als Nachteil, sondern als Vorteil interpretiert werden sollte. Vargas nahm diese Idee auf und machte sie zu einem wichtigen Bestandteil der nationalen Identität.