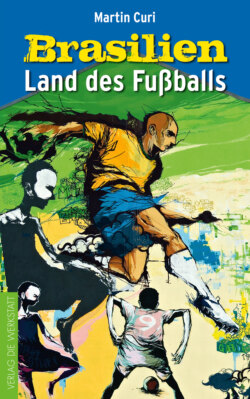Читать книгу Brasilien - Martin Curi - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1982: Die größte Katastrophe seit 1950
ОглавлениеBei der WM 1982 lag der letzte Sieg über Argentinien bereits zwölf Jahre zurück. Brasilien stellte erneut ein Superteam um Zico, Junior, Falcão und Socrates auf. Die Seleção fuhr als hoher Favorit nach Spanien. Diesmal gab es keine Militärdiktatur, die dem Sieg im Weg stehen könnte. Die brasilianische Fangemeinde vertraute blind den spielerischen Fähigkeiten ihrer Mannschaft. Alles andere als der Titelgewinn würde eine Enttäuschung sein. Doch das Turnier wurde im brasilianischen Kollektivgedächtnis zur größten Katastrophe seit 1950.
Die Vorrunde wurde mit Siegen gegen die Sowjetunion (2:1), Schottland (4:1) und Neuseeland (4:0) locker bewältigt. In der Zwischenrunde gelang dann beim 3:1 über Argentinien die Revanche für 1978. Und weil der abschließende Gegner Italien Argentinien nur mit 2:1 besiegt hatte, würde Brasilien ein Unentschieden zum Einzug ins Finale reichen. Am 5. Juli 1982 trafen die beiden Mannschaften im Sarrià-Stadion in Barcelona aufeinander. Während Brasilien alle seine Spiele gewonnen und die alte Fußballkunst der Pelé-Zeit wiederbelebt hatte, war Italien mit drei Unentschieden nur mit Ach und Krach durch die Vorrunde gekommen. Der italienische Stürmerstar Rossi hatte noch keinen einzigen Treffer erzielt. Das angestrebte Unentschieden sollte also nur Formsache sein.
Schon nach fünf Minuten stand es in der brütend heißen spanischen Sommersonne 1:0 für Italien. Torschütze: Rossi. Socrates konnte in der zwölften Minute zwar ausgleichen, doch Rossi sorgte noch in der ersten Halbzeit für das 2:1. Anschließend entwickelte sich eine drückende Überlegenheit der Brasilianer, die eine Angriffswelle nach der anderen fuhren. In der 68. Minute schien Falcão Brasilien dann mit dem 2:2 endlich zu erlösen. Doch kurz darauf der nächste Schock: Mit einem grotesken Billardtor entschied Rossi das Spiel. Brasilien war ausgeschieden.
Die Niederlage führte in der brasilianischen Öffentlichkeit zu einer aufgeregten Diskussion und der Suche nach den Schuldigen, die bis heute andauert. Was war so anders an dieser Niederlage? Brasilien war einer der Favoriten, und der Gegner Italien hatte keine allzu berauschende WM gespielt. Doch Außenseitersiege sind relativ normal im Fußball. In diesem Zusammenhang ist es allerdings interessant, sich anzuschauen, wie leicht Brasilianer im täglichen Leben ihr Schicksal annehmen. Viele Brasilianer glauben, dass sie ihr Schicksal leichter verdauen würden als Europäer, weil sie eine besondere Flexibilität hätten, die sie durch widrige Umstände bringen würde. In einem vom Zufall geprägten Sport wie dem Fußball wird das Schicksal jedoch zum Problem. Brasilianer glauben schnell, sie wären die einzigen, die ein Spiel dominieren könnten. Doch genauso schnell kann eine Niederlage zum nationalen Trauma werden. Das gründet auf einer überzogenen Erwartungshaltung, die 1982 freilich nicht größer war als in Jahren zuvor.
Nach dem Rückzug Pelés hatte Brasilien 1974 wenig Hoffnungen auf einen Sieg gehabt. Vier Jahre später konnte man die Schuld auf die argentinischen Militärs schieben. 1982 jedoch symbolisierte die Seleção jene unbesiegbare brasilianische Fußballkunst, die seit 1970 Teil des nationalen Selbstverständnisses war. Die Niederlage bedeutete also nicht nur das Versagen von elf Männern auf einem Fußballfeld, sondern kratzte auch an der Fassade einer mühsam aufgebauten nationalen Identität. Alles, woran ein durchschnittlicher Brasilianer glaubt, stand bei dieser WM auf dem Spiel: die Flexibilität, der Hüftschwung, die Lebensart und die Überzeugung, dass es aus jeder noch so ausweglos scheinenden Situation einen Ausweg gibt.
Dieses Selbstverständnis war an politische Frühlingsgefühle gekoppelt, denn das Land befand sich im Aufbruch. Die fast 20 Jahre währende Militärdiktatur neigte sich ihrem Ende zu. 1982 gab es erstmals seit 20 Jahren wieder freie Wahlen auf regionaler Ebene. Die Nationalspieler Socrates und Casagrande engagierten sich in der Redemokratisierungsbewegung. Die Seleção wurde zu einem frischen, kreativen, ja fast intellektuellen Symbol dieser Zeit. Man fühlte sich wie neugeboren und glaubte, niemand könnte den brasilianischen Aufschwung stoppen.
Das überbordende Selbstbewusstsein führte dazu, dass man in das Spiel gegen Italien mit einer „Attacke total“-Devise ging, obwohl auch ein Unentschieden gereicht hätte. Gegen einen defensiven Kontrahenten hätten die Italiener vermutlich Probleme gehabt, gegen die offensiven Brasilianer aber konnten sie ihre taktische Disziplin und ihre schnellen Konter exzellent umsetzen. Angeblich hatte Falcão, der seinerzeit in Italien spielte, vor einer offensiven Taktik gewarnt, war jedoch mit einem: „Wir sind Brasilien, wir spielen brasilianisch!“, zum Schweigen gebracht worden. So rannten die kanariengelben Filigrantechniker in ihr Verderben.
Die „Tragödie von Sarrià“, wie die Italien-Niederlage in Brasilien genannt wird, hatte grundlegende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des brasilianischen Spielstils. Überall wurde öffentlich diskutiert, ob man angesichts der Niederlage weiterhin Fußball als Kunst spielen könne oder ob man ebenfalls den anscheinend erfolgreicheren Kraftfußball anwenden müsse. Es könne ja sein, so wurde argumentiert, dass sich die Spielsysteme weltweit geändert hätten und man darauf reagieren müsse. Schließlich stand das Wohl der Nation auf dem Spiel, denn von dem Spielergebnis der Nationalmannschaft wurden Rückschlüsse auf die Lage des Volkes gezogen.